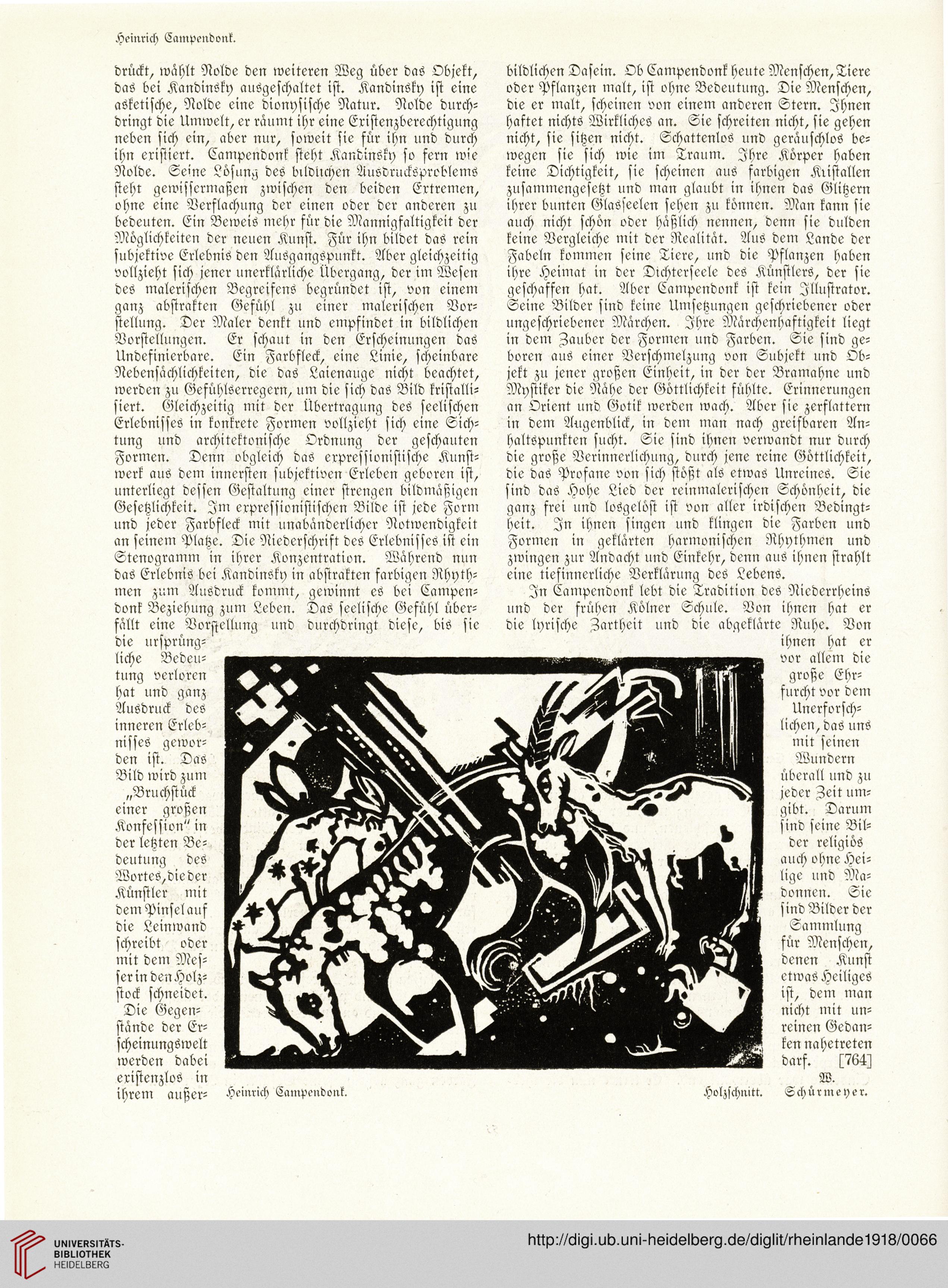Hemrich Campendonk.
drückt, wählt Nolde den weiteren Weg über das Objekt,
das bei Kandinsky ausgeschaltet isi. Kandinsky ist eine
asketische, Nolde eine dionysische Natur. Nolde durch-
dringt die Umwelt, er raumt ihr eine Eristenzberechtigung
neben sich ein, aber nur, soweit sie sür ihn und durch
ihn eristiert. Campendonk steht Kandinsky so sern wie
Nolde. Seine Lösung des bildnchen Ausdrucksproblems
stehl gewissermaßen zwischen den beiden Ertremen,
ohne eine Verflachung der einen oder der anderen zu
bedeuten. Ein Beweis mehr sür die Mannigfaltigkeit der
Möglichkeiten der neuen Kunst. Für ihn bildet das rein
subjektive Erlebnis den Ausgangspunkt. Aber gleichzeitig
vollzieht sich jener unerklarliche Ubergang, der im Wesen
des malerischen Begreifens begründet ist, von einem
ganz abstrakten Gefühl zu einer malerischen Vor-
stellung. Der Maler denkt und empfindet in bildlichen
Vorstellungen. Er schaut in den Erscheinungen das
Undefinierbare. Ein Farbfleck, eine Linie, scheinbare
Nebensächlichkeiten, die das Laienauge nicht beachtet,
werden zu Gefühlserregern, cim die sich das Bild kristalli-
siert. Gleichzeitig mit dcr Ubertragung des seelischen
Erlebnisses in konkrete Formen vollzieht sich eine Sich-
tung und architektonische Ordnung der geschauten
Formen. Denn obgleich das erpressionistische Kunst-
werk aus dem innersten subjektiven Erleben geboren ist,
unterliegt dessen Gestaltung einer strengen bildmaßigen
Gesetzlichkeit. Jm erpressionistischen Bilde ist jede Form
und jeder Farbfleck mit unabanderlicher Notwendigkeit
an seinem Platze. Die Niederschrift des Erlebnisses iit ein
Stenogramm in ihrer Konzentration. Während nun
das Erlebnis bei Kandinsky in abstrakten farbigen Rhyth-
men zum Ausdruck kommt, gewinnt es bei Campen-
donk Beziehung zum Leben. Das seelische Gefühl über-
fällt eine Vorstellung und durchdringt diese, bis sie
die ursprüng-
liche Bedeu-
tung verloren
hat und ganz
Ausdruck des
inneren Erleb-
nisses gewor-
den ist. Das
Bild wird zum
„Bruchstück
einer großen
Konfession" in
der letzten Be-
deutung des
Wortes,dieder
Künstler mit
demPinselauf
die Leinwand
schreibt oder
mit dem Mes-
serindenHolz-
stock schneidet.
Die Gegen-
stände der Er-
scheinungswelt
werden dabei
eristenzlos in
ihrem außer- Heinrich Eampendonk.
bildlichen Dasein. Ob Campendonk heute Menschen, Tiere
oder Pflanzen malt, ist ohne Bedeutung. Die Menschen,
die er malt, scheinen von einem anderen Stern. Jhnen
haftet nichts Wirkliches an. Sie schreiten nicht, sie gehen
nicht, sie sitzen nicht. Schattenlos und geräuschlos be-
wegen sie sich wie im Traum. Jhre Körper haben
keine Dichtigkeit, sie scheinen aus farbigen Kustallen
zusammengesetzt und man glaubt in ihnen das Glitzern
ihrer bunten Glasseelen sehen zu können. Man kann sie
auch nicht schön oder häßlich nennen, denn sie dulden
keine Vergleiche mit der Realität. Aus dem Lande der
Fabeln kommen seine Tiere, und die Pflanzen haben
ihre Heimat in der Dichterseele des Künstlers, der sie
geschaffen hat. Aber Campendonk ist kein Jllustrator.
Seine Bilder sind keine Umsetzungen geschriebener oder
ungeschriebener Märchen. Jhre Märchenhaftigkeit liegt
in dem Aauber der Formen und Farben. Sie sind ge-
boren aus einer Verschmelzung von Subjekt und Ob-
jekt zu jener großen Einheit, in der der Bramahne und
Mystiker die Nähe der Göttlichkeit fühlte. Erinnerungen
an Orient und Gotik werden wach. Aber sie zerflattern
in dem Augenblick, in dem man nach greifbaren An-
haltspunkten sucht. Sie sind ihncn verwandt nur durch
die große Verinnerlichung, durch jene reine Göttlichkeit,
die das Profane von sich stößt als etwas Unreines. Sie
sind das Hohe Lied der reinmalerischen Schönheit, die
ganz frei und losgelöst ist von aller irdischen Bedingt-
heit. Jn ihnen singen und klingen die Farben und
Formen in geklärten harmonischen Rhythmen und
zwingen zur Andacht und Einkehr, denn acis ihnen strahlt
eine tiefinncrliche Verklärung des Lebens.
Jn Campendonk lebt die Tradition des Niederrheins
und der frühen Kölner Schule. Von ihncn hat er
die lyrische Zartheit und die abgeklärte Ruhe. Von
ihnen hat er
vor allem die
große Ehr-
furcht vor dem
Unerforsch-
lichen, das uns
nnt seinen
Wundern
überall und zu
jeder Aeit um-
gibt. Darum
sind seine Bil-
der religiös
auch ohne Hei-
lige und Ma-
donnen. Sie
sindBilderder
Sammlung
für Menschen,
denen Kunst
etwasHeiliges
ist, dem man
nicht mit un-
reinen Gedan-
kennahetreten
darf. f764^
W.
Holzschmtt. Schürmeyer.
drückt, wählt Nolde den weiteren Weg über das Objekt,
das bei Kandinsky ausgeschaltet isi. Kandinsky ist eine
asketische, Nolde eine dionysische Natur. Nolde durch-
dringt die Umwelt, er raumt ihr eine Eristenzberechtigung
neben sich ein, aber nur, soweit sie sür ihn und durch
ihn eristiert. Campendonk steht Kandinsky so sern wie
Nolde. Seine Lösung des bildnchen Ausdrucksproblems
stehl gewissermaßen zwischen den beiden Ertremen,
ohne eine Verflachung der einen oder der anderen zu
bedeuten. Ein Beweis mehr sür die Mannigfaltigkeit der
Möglichkeiten der neuen Kunst. Für ihn bildet das rein
subjektive Erlebnis den Ausgangspunkt. Aber gleichzeitig
vollzieht sich jener unerklarliche Ubergang, der im Wesen
des malerischen Begreifens begründet ist, von einem
ganz abstrakten Gefühl zu einer malerischen Vor-
stellung. Der Maler denkt und empfindet in bildlichen
Vorstellungen. Er schaut in den Erscheinungen das
Undefinierbare. Ein Farbfleck, eine Linie, scheinbare
Nebensächlichkeiten, die das Laienauge nicht beachtet,
werden zu Gefühlserregern, cim die sich das Bild kristalli-
siert. Gleichzeitig mit dcr Ubertragung des seelischen
Erlebnisses in konkrete Formen vollzieht sich eine Sich-
tung und architektonische Ordnung der geschauten
Formen. Denn obgleich das erpressionistische Kunst-
werk aus dem innersten subjektiven Erleben geboren ist,
unterliegt dessen Gestaltung einer strengen bildmaßigen
Gesetzlichkeit. Jm erpressionistischen Bilde ist jede Form
und jeder Farbfleck mit unabanderlicher Notwendigkeit
an seinem Platze. Die Niederschrift des Erlebnisses iit ein
Stenogramm in ihrer Konzentration. Während nun
das Erlebnis bei Kandinsky in abstrakten farbigen Rhyth-
men zum Ausdruck kommt, gewinnt es bei Campen-
donk Beziehung zum Leben. Das seelische Gefühl über-
fällt eine Vorstellung und durchdringt diese, bis sie
die ursprüng-
liche Bedeu-
tung verloren
hat und ganz
Ausdruck des
inneren Erleb-
nisses gewor-
den ist. Das
Bild wird zum
„Bruchstück
einer großen
Konfession" in
der letzten Be-
deutung des
Wortes,dieder
Künstler mit
demPinselauf
die Leinwand
schreibt oder
mit dem Mes-
serindenHolz-
stock schneidet.
Die Gegen-
stände der Er-
scheinungswelt
werden dabei
eristenzlos in
ihrem außer- Heinrich Eampendonk.
bildlichen Dasein. Ob Campendonk heute Menschen, Tiere
oder Pflanzen malt, ist ohne Bedeutung. Die Menschen,
die er malt, scheinen von einem anderen Stern. Jhnen
haftet nichts Wirkliches an. Sie schreiten nicht, sie gehen
nicht, sie sitzen nicht. Schattenlos und geräuschlos be-
wegen sie sich wie im Traum. Jhre Körper haben
keine Dichtigkeit, sie scheinen aus farbigen Kustallen
zusammengesetzt und man glaubt in ihnen das Glitzern
ihrer bunten Glasseelen sehen zu können. Man kann sie
auch nicht schön oder häßlich nennen, denn sie dulden
keine Vergleiche mit der Realität. Aus dem Lande der
Fabeln kommen seine Tiere, und die Pflanzen haben
ihre Heimat in der Dichterseele des Künstlers, der sie
geschaffen hat. Aber Campendonk ist kein Jllustrator.
Seine Bilder sind keine Umsetzungen geschriebener oder
ungeschriebener Märchen. Jhre Märchenhaftigkeit liegt
in dem Aauber der Formen und Farben. Sie sind ge-
boren aus einer Verschmelzung von Subjekt und Ob-
jekt zu jener großen Einheit, in der der Bramahne und
Mystiker die Nähe der Göttlichkeit fühlte. Erinnerungen
an Orient und Gotik werden wach. Aber sie zerflattern
in dem Augenblick, in dem man nach greifbaren An-
haltspunkten sucht. Sie sind ihncn verwandt nur durch
die große Verinnerlichung, durch jene reine Göttlichkeit,
die das Profane von sich stößt als etwas Unreines. Sie
sind das Hohe Lied der reinmalerischen Schönheit, die
ganz frei und losgelöst ist von aller irdischen Bedingt-
heit. Jn ihnen singen und klingen die Farben und
Formen in geklärten harmonischen Rhythmen und
zwingen zur Andacht und Einkehr, denn acis ihnen strahlt
eine tiefinncrliche Verklärung des Lebens.
Jn Campendonk lebt die Tradition des Niederrheins
und der frühen Kölner Schule. Von ihncn hat er
die lyrische Zartheit und die abgeklärte Ruhe. Von
ihnen hat er
vor allem die
große Ehr-
furcht vor dem
Unerforsch-
lichen, das uns
nnt seinen
Wundern
überall und zu
jeder Aeit um-
gibt. Darum
sind seine Bil-
der religiös
auch ohne Hei-
lige und Ma-
donnen. Sie
sindBilderder
Sammlung
für Menschen,
denen Kunst
etwasHeiliges
ist, dem man
nicht mit un-
reinen Gedan-
kennahetreten
darf. f764^
W.
Holzschmtt. Schürmeyer.