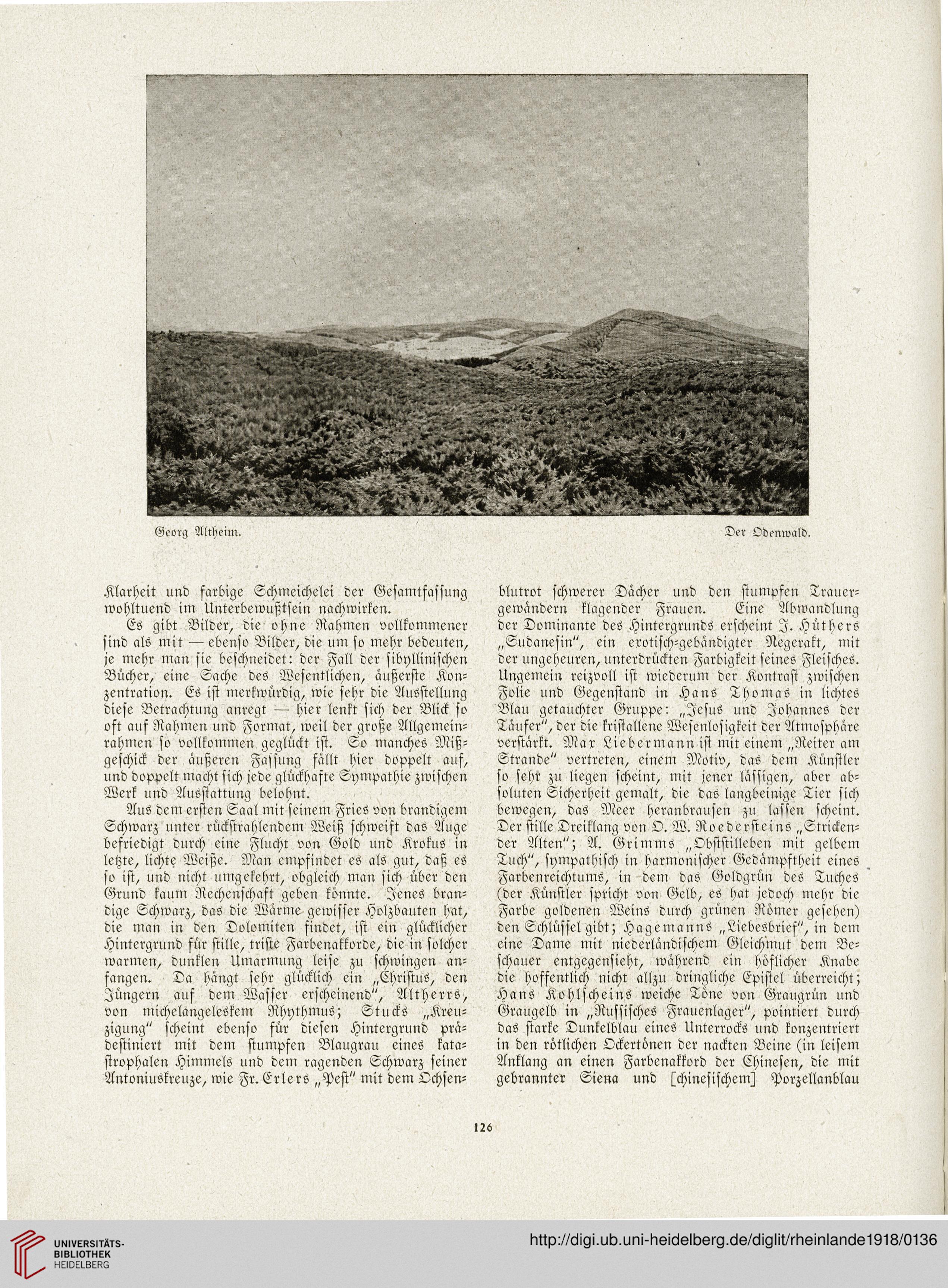Georg Altheim.
Der Odemvald.
Klarheit und farbige Schmeichelei der Gesamtfassung
wohltuend im Unterbewußtsein nachwirken.
Es gibt Bilder, die ohne Rahmen vollkvmmener
sind als mit — ebenso Bilder, die um so mehr bedeuten,
je mehr man sie beschneidet: der Fall der sibyllinischen
Bücher, eine Sache des Wesentlichen, äußerste Kon-
zentration. Es ist merkwürdig, wie sehr die Ausstellung
diese Betrachtung anregt — hier lenkt sich der Blick so
oft auf Rahmen und Format, weil der große Allgemein-
rahmen so vollkommen geglückt ist. So manches Miß-
geschick der äußeren Fassung fällt hier doppelt ailf,
und doppelt macht sich jede glückhafte Sympathie zwischen
Werk und Ausstattung belohnt.
Aus dem ersten Saal mit seinem Fries von brandigem
Schwarz unter rückstrahlendem Weiß schweift das Auge
befriedigt durch eine Flucht von Gold rind Krokus in
letzte, lichte Weiße. Man empfindet es als gut, daß es
so ist, und nicht umgekehrt, obgleich man sich über den
Grund kaum Rechenschaft geben könnte. Jenes bran-
dige Schwarz, das die Wärme gewisser Holzbauten hat,
die man in den Dolomiten findet, ist ein glücklicher
Hintergrund für stille, triste Farbenakkorde, die in solcher
warmen, dunklen Umarmung leise zu schwingen an-
fangen. Da hängt sehr glücklich ein „Christus, den
Jüngern auf dem Wasser erscheinend", Altherrs,
von michelangeleskem Rhythmus; Stucks „Kreu-
zigung" scheint ebenso für diesen Hintergrund prä-
destiniert mit dem stumpfen Blaugrau eines kata-
strophalen Himmels und dem ragenden Schwarz seiner
Antoniuskreuze, wie Fr. Erlers „Pest" mit dem Ochsen-
blutrot schwerer Dächer und den stumpfen Trauer-
gewändern klagender Frauen. Eine Abwandlung
der Dominante des Hintergrunds erschcint I. Hüthers
„Sudanesin", ein ervtisch-gebändigter Negerakt, mjt
der ungeheuren, unterdrückten Farbigkeit seines Fleisches.
Ungemein reizvoll ist wiederum der Kontrast zwischen
Folie und Gegenstand in Hans Thomas in lichtes
Blau getauchter Gruppe: „Jesus und Johannes der
Taufer", der die kristallene Wesenlosigkcit der Ätmosphäre
verstärkt. Mar Liebermann ist mit einem „Reitcr am
Strande" vertreten, einem Motiv, das dem Künstler
so sehr zu liegen scheint, mit jener lassigen, aber ab-
soluten Sicherheit gemalt, die das langbeinige Tier sich
bewegen, das Meer heranbrausen zci lassen schcint.
Der stille Dreiklang von O. W. Roedersteins „Stricken-
der Alten"; A. Grimms „Obststilleben mit gelbcm
Tuch", sympathisch in harmonischer Gedampftheit eines
Farbenreichtums, in dem das Goldgrün des Tuches
(der Künstler spricht von Gelb, es hat jedoch mehr die
Farbe goldenen Weins durch grünen Römer gesehen)
den Schlüssel gibt; Hagemanns „Liebesbrief", in dem
eine Danie mit niederlandischem Gleichmut deni Be-
schauer entgegensieht, wahrend ein höflicher Knabe
die hoffentlich nicht allzu dringliche Epistel überreicht;
Hans Kohlscheins weiche Töne von Graugrün und
Graugelb in „Russisches Frauenlager", pointiert durch
das starke Dunkelblau eines Unterrocks und konzentriert
in den rötlichen Ockertönen der nackten Beine (in leisem
Anklang an einen Farbenakkord der Chinesen, die mit
gebrannter Siena und fchinesischemsj Porzellanblau
126
Der Odemvald.
Klarheit und farbige Schmeichelei der Gesamtfassung
wohltuend im Unterbewußtsein nachwirken.
Es gibt Bilder, die ohne Rahmen vollkvmmener
sind als mit — ebenso Bilder, die um so mehr bedeuten,
je mehr man sie beschneidet: der Fall der sibyllinischen
Bücher, eine Sache des Wesentlichen, äußerste Kon-
zentration. Es ist merkwürdig, wie sehr die Ausstellung
diese Betrachtung anregt — hier lenkt sich der Blick so
oft auf Rahmen und Format, weil der große Allgemein-
rahmen so vollkommen geglückt ist. So manches Miß-
geschick der äußeren Fassung fällt hier doppelt ailf,
und doppelt macht sich jede glückhafte Sympathie zwischen
Werk und Ausstattung belohnt.
Aus dem ersten Saal mit seinem Fries von brandigem
Schwarz unter rückstrahlendem Weiß schweift das Auge
befriedigt durch eine Flucht von Gold rind Krokus in
letzte, lichte Weiße. Man empfindet es als gut, daß es
so ist, und nicht umgekehrt, obgleich man sich über den
Grund kaum Rechenschaft geben könnte. Jenes bran-
dige Schwarz, das die Wärme gewisser Holzbauten hat,
die man in den Dolomiten findet, ist ein glücklicher
Hintergrund für stille, triste Farbenakkorde, die in solcher
warmen, dunklen Umarmung leise zu schwingen an-
fangen. Da hängt sehr glücklich ein „Christus, den
Jüngern auf dem Wasser erscheinend", Altherrs,
von michelangeleskem Rhythmus; Stucks „Kreu-
zigung" scheint ebenso für diesen Hintergrund prä-
destiniert mit dem stumpfen Blaugrau eines kata-
strophalen Himmels und dem ragenden Schwarz seiner
Antoniuskreuze, wie Fr. Erlers „Pest" mit dem Ochsen-
blutrot schwerer Dächer und den stumpfen Trauer-
gewändern klagender Frauen. Eine Abwandlung
der Dominante des Hintergrunds erschcint I. Hüthers
„Sudanesin", ein ervtisch-gebändigter Negerakt, mjt
der ungeheuren, unterdrückten Farbigkeit seines Fleisches.
Ungemein reizvoll ist wiederum der Kontrast zwischen
Folie und Gegenstand in Hans Thomas in lichtes
Blau getauchter Gruppe: „Jesus und Johannes der
Taufer", der die kristallene Wesenlosigkcit der Ätmosphäre
verstärkt. Mar Liebermann ist mit einem „Reitcr am
Strande" vertreten, einem Motiv, das dem Künstler
so sehr zu liegen scheint, mit jener lassigen, aber ab-
soluten Sicherheit gemalt, die das langbeinige Tier sich
bewegen, das Meer heranbrausen zci lassen schcint.
Der stille Dreiklang von O. W. Roedersteins „Stricken-
der Alten"; A. Grimms „Obststilleben mit gelbcm
Tuch", sympathisch in harmonischer Gedampftheit eines
Farbenreichtums, in dem das Goldgrün des Tuches
(der Künstler spricht von Gelb, es hat jedoch mehr die
Farbe goldenen Weins durch grünen Römer gesehen)
den Schlüssel gibt; Hagemanns „Liebesbrief", in dem
eine Danie mit niederlandischem Gleichmut deni Be-
schauer entgegensieht, wahrend ein höflicher Knabe
die hoffentlich nicht allzu dringliche Epistel überreicht;
Hans Kohlscheins weiche Töne von Graugrün und
Graugelb in „Russisches Frauenlager", pointiert durch
das starke Dunkelblau eines Unterrocks und konzentriert
in den rötlichen Ockertönen der nackten Beine (in leisem
Anklang an einen Farbenakkord der Chinesen, die mit
gebrannter Siena und fchinesischemsj Porzellanblau
126