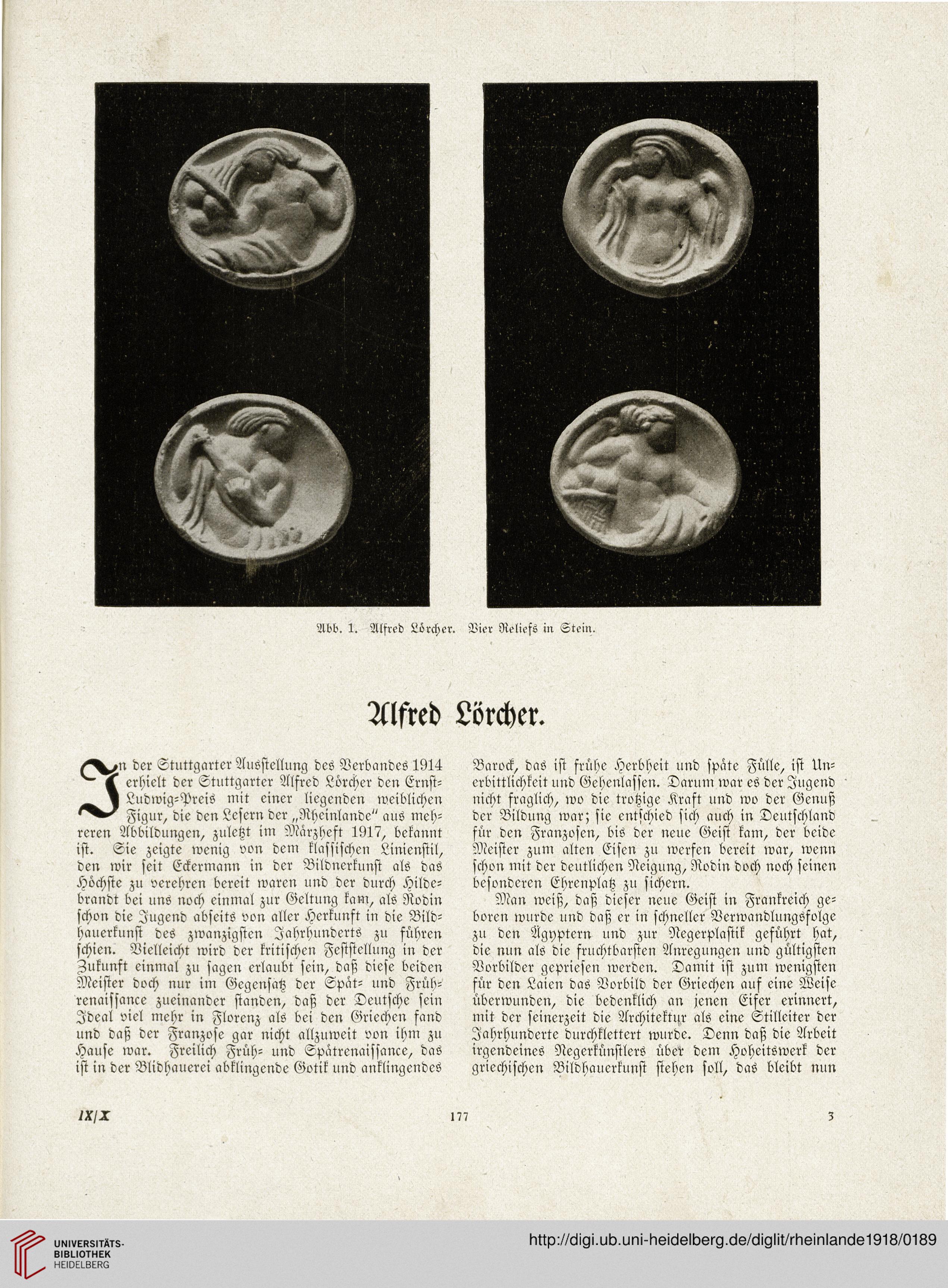Abb. 1. Alfred Lörcher. Vier Reliefs in Stcin.
Alfred Lörcher.
/^^n der Stuttgarter Ausstellung des Verbandes 1914
^ erhielt der Stuttgarter Alfred Lörcher den Ernst-
H Ludwig-Preis mit einer liegenden weiblichen
Figur, die den Lesern der „Rheinlande" aus meh-
reren Abbildungen, zuletzt im Märzheft 1917, bekannt
ist. Sie zeigte wenig von dem klassischen Linienstil,
den wir seit Eckermann in der Bildnerkunst als das
Höchste zu verehren bereit waren und der durch Hilde-
brandt bei uns noch einmal zur Geltung kam, als Rodin
schon die Jugend abseits von aller Herkunft in die Bild-
hauerkunst des zwanzigsten Jahrhunderts zu führen
schien. Vielleicht wird der kritischen Fcststeütlng in der
Aukunft einmal zu sagen erlaubt sein, daß diese beiden
Meister doch nur im Gegensatz der Spat- und Früh-
renaissance zueinander standen, daß der Deutsche sein
Jdeal viel mehr in Florenz als bei den Griechen fand
und daß der Franzose gar nicht allzuweit von ihm zu
Hause war. Freilich Früh- und Spatrenaissance, das
ist in der Blidhauerei abklingende Gotik und anklingendes
Barock, das ist frühe Herbheit und spate Fülle, ist Un-
erbittlichkeit und Gehenlassen. Darum war es der Jugend
nicht fraglich, wo die trotzige Kraft und wo der Genuß
der Bildung war; sie cntschied sich auch in Deutschland
für den Franzosen, bis der neue Geist kam, der beide
Meister zum alten Eisen zu werfen bereit war, wenn
schon mit der deutlichen Neigung, Rodin doch noch seincn
besonderen Ehrenplatz zu sichern.
Maic weiß, daß dieser neue Geist in Frankreich ge-
borcn wurde und daß er in schneller Verwandlungsfolge
zu den Agyptern und zur Negerplastik geführt hat,
die nun als die fruchtbarsten Anregungen und gültigsten
Vorbilder gepriesen werden. Damit ist zum wenigsten
für den Laien das Vorbild der Griechen auf eine Weise
überwunden, die bedenklich an jenen Eifer erinnert,
mit der seinerzeit die Architektur als eine Stillciter der
Jahrhunderte durchklettert wurde. Denn daß die Arbeit
irgendeines Negerkünstlers über dem Hoheitswerk der
griechischen Bildhauerkunst stehen soll, das bleibt nun
177
Z
Alfred Lörcher.
/^^n der Stuttgarter Ausstellung des Verbandes 1914
^ erhielt der Stuttgarter Alfred Lörcher den Ernst-
H Ludwig-Preis mit einer liegenden weiblichen
Figur, die den Lesern der „Rheinlande" aus meh-
reren Abbildungen, zuletzt im Märzheft 1917, bekannt
ist. Sie zeigte wenig von dem klassischen Linienstil,
den wir seit Eckermann in der Bildnerkunst als das
Höchste zu verehren bereit waren und der durch Hilde-
brandt bei uns noch einmal zur Geltung kam, als Rodin
schon die Jugend abseits von aller Herkunft in die Bild-
hauerkunst des zwanzigsten Jahrhunderts zu führen
schien. Vielleicht wird der kritischen Fcststeütlng in der
Aukunft einmal zu sagen erlaubt sein, daß diese beiden
Meister doch nur im Gegensatz der Spat- und Früh-
renaissance zueinander standen, daß der Deutsche sein
Jdeal viel mehr in Florenz als bei den Griechen fand
und daß der Franzose gar nicht allzuweit von ihm zu
Hause war. Freilich Früh- und Spatrenaissance, das
ist in der Blidhauerei abklingende Gotik und anklingendes
Barock, das ist frühe Herbheit und spate Fülle, ist Un-
erbittlichkeit und Gehenlassen. Darum war es der Jugend
nicht fraglich, wo die trotzige Kraft und wo der Genuß
der Bildung war; sie cntschied sich auch in Deutschland
für den Franzosen, bis der neue Geist kam, der beide
Meister zum alten Eisen zu werfen bereit war, wenn
schon mit der deutlichen Neigung, Rodin doch noch seincn
besonderen Ehrenplatz zu sichern.
Maic weiß, daß dieser neue Geist in Frankreich ge-
borcn wurde und daß er in schneller Verwandlungsfolge
zu den Agyptern und zur Negerplastik geführt hat,
die nun als die fruchtbarsten Anregungen und gültigsten
Vorbilder gepriesen werden. Damit ist zum wenigsten
für den Laien das Vorbild der Griechen auf eine Weise
überwunden, die bedenklich an jenen Eifer erinnert,
mit der seinerzeit die Architektur als eine Stillciter der
Jahrhunderte durchklettert wurde. Denn daß die Arbeit
irgendeines Negerkünstlers über dem Hoheitswerk der
griechischen Bildhauerkunst stehen soll, das bleibt nun
177
Z