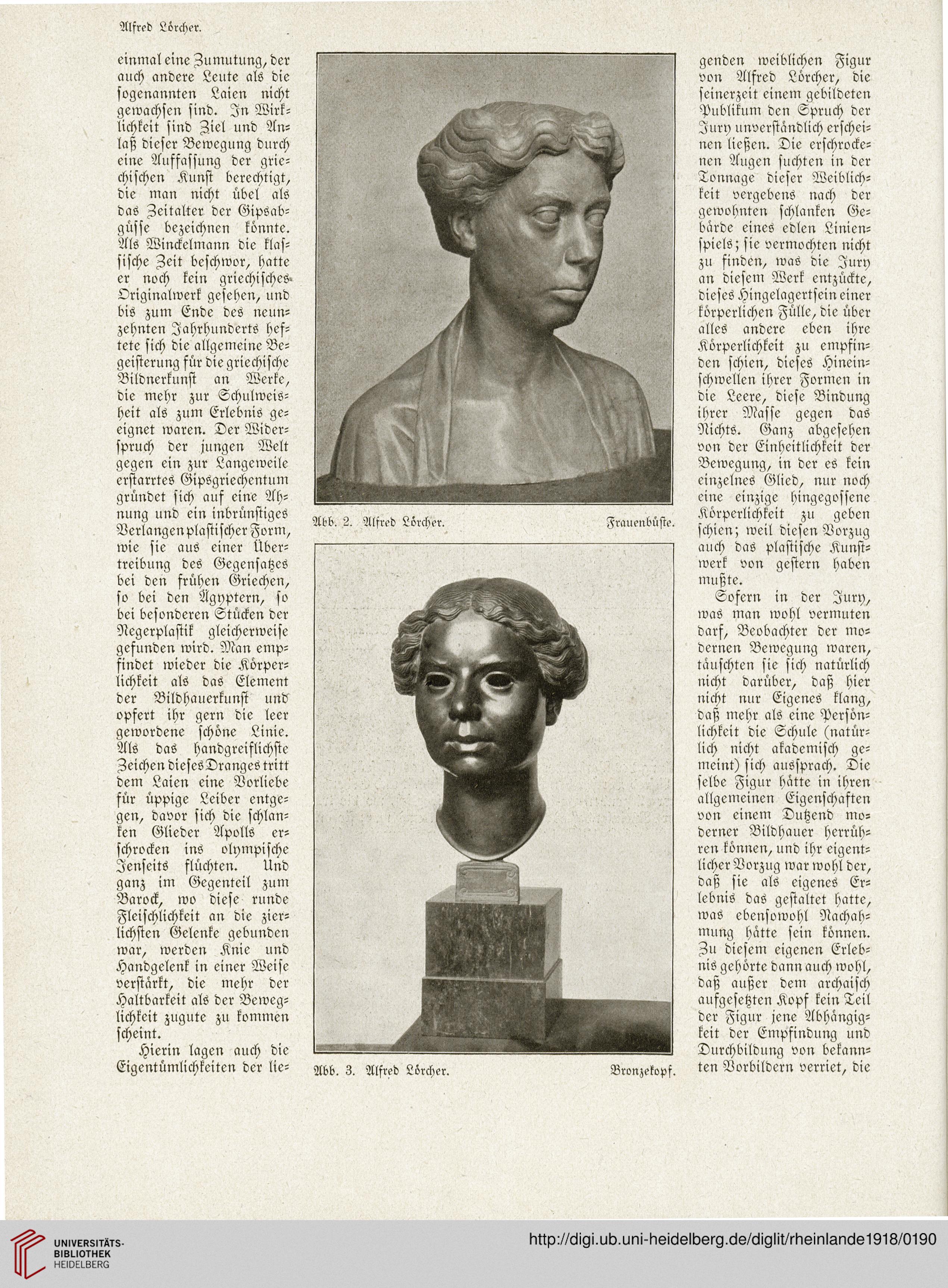Alfred Lörcher.
einmal eine Aumutung, der
auch andere Leute als die
sogenannten Laien nicht
gewachsen sind. Jn Wirk-
lichkeit sind Ziel und An-
laß dieser Bewegung durch
eine Auffassung der grie-
chischen Kunst berechtigt,
die man nicht übel als
das Aeitalter der Gipsab-
güsse bezeichnen könnte.
Als Winckelmann die klas-
sische Zeit beschwor, hatte
er noch kein griechisches-
Originalwerk gesehen, und
bis zum Ende des neun-
zehnten Jahrhunderts hef-
tete sich die allgemeine Be-
geisterung für die griechische
Bildnerkunst an Werke,
die mehr zur Schulweis-
heit als zum Erlebnis ge-
eignet waren. Der Wider-
spruch der sungen Welt
gegen ein zur Langeweile
erstarrtes Gipsgriechentum
gründet sich auf eine Ah-
nung und ein inbrünstiges
VerlangenplastischerForm,
wie sie aus einer llber-
treibung des Gegensatzes
bei den frühen Griechen,
so bei den Ägyptern, so
bei besonderen Stücken der
Negerplastik gleicherweise
gefunden wird. Man emp-
findet wieder die Körper-
lichkeit als das Element
der Bildhauerkunst und
opfert ihr gern die leer
gewordene schöne Linie.
Als das handgreiflichste
Aeichen diesesDranges tritt
dem Laien eine Vorliebe
für üppige Leiber entge-
gen, davor sich die schlan-
ken Glieder Apolls er-
schrocken ins otympische
Jenseits flüchten. Und
ganz im Gegenteil zum
Barock, wo diese runde
Fleischlichkeit an die zier-
lichsten Gelenke gebunden
war, werden Knie und
Handgelenk in einer Weise
verstärkt, die mehr der
Haltbarkeit als der Beweg-
lichkeit zugute zu kommen
scheint.
Hierin lagen auch die
Eigentümlichkeiten der lie-
Atb. 2.
Frauenbüste.
Abb. 3. Alfred LLrcher.
Bronzekopf.
genden weiblichen Figur
von Alfred Lörcher, die
seinerzeit einem gebildeten
Publikum den Spruch der
Jury unverstandlich erschei-
nen ließen. Die erschrocke-
nen Augen suchten in der
Tonnage dieser Weiblich-
keit vergebens nach der
gewohnten schlanken Ge-
bärde cines edlen Linien-
spiels; sie vermochten nicht
zu finden, was die Jury
an diesem Werk entzückte,
dieses Hingelagertsein einer
körperlichen Fülle, die über
alles andere eben ihre
Körperlichkeit zu empfin-
den schien, dieses Hinein-
schwellen ihrer Formen in
die Leere, diese Bindung
ihrer Masse gegen das
Nichts. Ganz abgesehen
von der Einheitlichkeit der
Bewegung, in der es kein
einzelnes Glied, nur noch
eine einzige hingegossene
Körperlichkeit zu geben
schien; weil diesen Vorzug
auch das plastische Kunst-
werk von gestern haben
mußte.
Sofern in der Jury,
was man wohl vermuten
darf, Beobachter der mo-
dernen Bewegung waren,
täuschten sie sich natürlich
nicht darüber, daß hier
nicht nur Eigenes klang,
daß mehr als eine Persön-
lichkeit die Schule (natür-
lich nicht akademisch ge-
meint) sich aussprach. Die
selbe Figur hätte in ihren
allgemeinen Eigenschaften
von einem Dutzend mo-
derner Bildhauer herrüh-
ren können, und ihr eigent-
licher Vorzug war wohl der,
daß sie als eigenes Er-
lebnis das gestaltet hatte,
was ebensowohl Nachah-
mung hätte sein können.
Iu diesem eigenen Erleb-
nis gehörte dann auch wohl,
daß außer dem archaisch
aufgesetzten Kopf kein Teil
der Figur jene Abhängig-
keit der Empfindung und
Durchbildung von bekann-
ten Vorbildern verriet, die
einmal eine Aumutung, der
auch andere Leute als die
sogenannten Laien nicht
gewachsen sind. Jn Wirk-
lichkeit sind Ziel und An-
laß dieser Bewegung durch
eine Auffassung der grie-
chischen Kunst berechtigt,
die man nicht übel als
das Aeitalter der Gipsab-
güsse bezeichnen könnte.
Als Winckelmann die klas-
sische Zeit beschwor, hatte
er noch kein griechisches-
Originalwerk gesehen, und
bis zum Ende des neun-
zehnten Jahrhunderts hef-
tete sich die allgemeine Be-
geisterung für die griechische
Bildnerkunst an Werke,
die mehr zur Schulweis-
heit als zum Erlebnis ge-
eignet waren. Der Wider-
spruch der sungen Welt
gegen ein zur Langeweile
erstarrtes Gipsgriechentum
gründet sich auf eine Ah-
nung und ein inbrünstiges
VerlangenplastischerForm,
wie sie aus einer llber-
treibung des Gegensatzes
bei den frühen Griechen,
so bei den Ägyptern, so
bei besonderen Stücken der
Negerplastik gleicherweise
gefunden wird. Man emp-
findet wieder die Körper-
lichkeit als das Element
der Bildhauerkunst und
opfert ihr gern die leer
gewordene schöne Linie.
Als das handgreiflichste
Aeichen diesesDranges tritt
dem Laien eine Vorliebe
für üppige Leiber entge-
gen, davor sich die schlan-
ken Glieder Apolls er-
schrocken ins otympische
Jenseits flüchten. Und
ganz im Gegenteil zum
Barock, wo diese runde
Fleischlichkeit an die zier-
lichsten Gelenke gebunden
war, werden Knie und
Handgelenk in einer Weise
verstärkt, die mehr der
Haltbarkeit als der Beweg-
lichkeit zugute zu kommen
scheint.
Hierin lagen auch die
Eigentümlichkeiten der lie-
Atb. 2.
Frauenbüste.
Abb. 3. Alfred LLrcher.
Bronzekopf.
genden weiblichen Figur
von Alfred Lörcher, die
seinerzeit einem gebildeten
Publikum den Spruch der
Jury unverstandlich erschei-
nen ließen. Die erschrocke-
nen Augen suchten in der
Tonnage dieser Weiblich-
keit vergebens nach der
gewohnten schlanken Ge-
bärde cines edlen Linien-
spiels; sie vermochten nicht
zu finden, was die Jury
an diesem Werk entzückte,
dieses Hingelagertsein einer
körperlichen Fülle, die über
alles andere eben ihre
Körperlichkeit zu empfin-
den schien, dieses Hinein-
schwellen ihrer Formen in
die Leere, diese Bindung
ihrer Masse gegen das
Nichts. Ganz abgesehen
von der Einheitlichkeit der
Bewegung, in der es kein
einzelnes Glied, nur noch
eine einzige hingegossene
Körperlichkeit zu geben
schien; weil diesen Vorzug
auch das plastische Kunst-
werk von gestern haben
mußte.
Sofern in der Jury,
was man wohl vermuten
darf, Beobachter der mo-
dernen Bewegung waren,
täuschten sie sich natürlich
nicht darüber, daß hier
nicht nur Eigenes klang,
daß mehr als eine Persön-
lichkeit die Schule (natür-
lich nicht akademisch ge-
meint) sich aussprach. Die
selbe Figur hätte in ihren
allgemeinen Eigenschaften
von einem Dutzend mo-
derner Bildhauer herrüh-
ren können, und ihr eigent-
licher Vorzug war wohl der,
daß sie als eigenes Er-
lebnis das gestaltet hatte,
was ebensowohl Nachah-
mung hätte sein können.
Iu diesem eigenen Erleb-
nis gehörte dann auch wohl,
daß außer dem archaisch
aufgesetzten Kopf kein Teil
der Figur jene Abhängig-
keit der Empfindung und
Durchbildung von bekann-
ten Vorbildern verriet, die