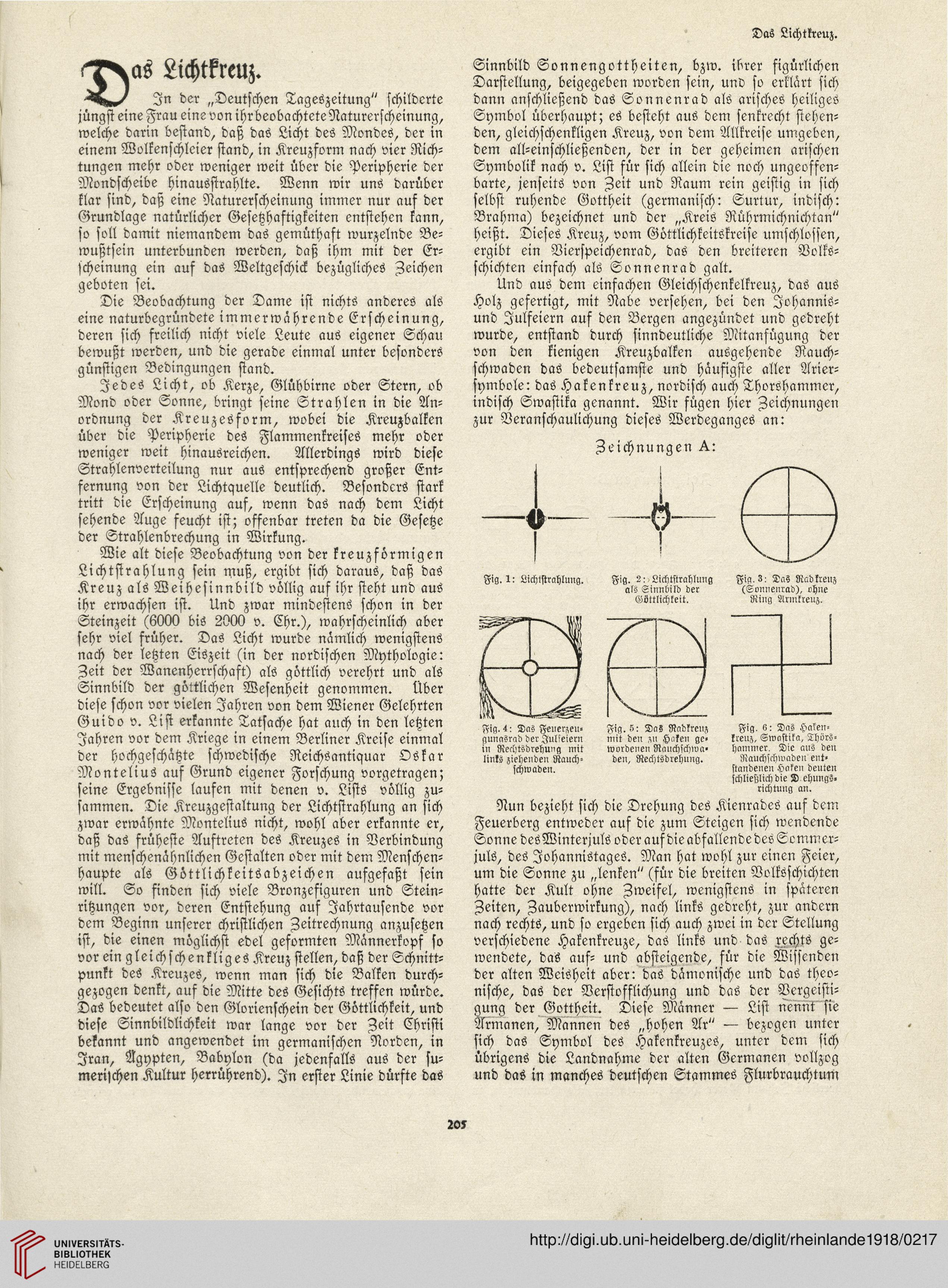Das Lichtkreuz.
D
as Lichtkreuz.
Jn dcr „Deutschen Tageszeitung" schilderte
jüngst eine Frau eins von ihrbeobachtete Naturerscheinung,
welche darin bestand, daß daS Licht des Mondes, der in
einem Wolkenschleier stand, in Kreuzform nach vier Rich-
tungen mehr oder weniger weit über die Peripherie der
Mondscheibe hinausstrahlte. Wenn wir uns darüber
klar sind, daß eine Naturerscheinung immer nur auf der
Grundlage natürlicher Gesetzhaftigkeiten entstehen kann,
so soll damit niemandem das gemüthaft wurzelnde Be-
wußtsein unterbunden werden, daß ihm mit der Er-
scheinung ein auf das Weltgeschick bezügliches Aeichen
geboten sei.
Die Beobachtung der Dame ist nichts anderes als
eine naturbegründete immerwährende Erscheinung,
deren sich freilich nicht viele Leute aus eigener Schau
bewußt werden, und die gerade einmal unter besonders
günstigen Bedingungen stand.
Jedes Licht, ob Kerze, Glühbirne oder Stern, ob
Mond oder Sonne, bringt seine Strahlen in die An-
ordnung der Kreuzesform, wobei die Kreuzbalken
über die Peripherie des Flammenkreises mehr oder
weniger weit hinausreichen. Allerdings wird diese
Strahlenverteilung nur aus entsprechend großer Ent-
fernung von der Lichtquelle deutlich. Besondcrs stark
tritt die Erscheinung auf, wenn das nach dem Licht
sehende Auge feucht ist; offenbar treten da die Gesetze
der Strahlenbrechung in Wirkung.
Wie alt diese Beobachtung von der kreuzförmigen
Lichtstrahlung sein muß, ergibt sich daraus, daß das
Kreuz als Weihesinnbild völlig auf ihr steht und aus
ihr erwachsen ist. Und zwar mindestens schon in der
Steinzeit (6000 bis 2000 v. Chr.), wahrscheinlich aber
sehr viel früher. Das Licht wurde nämlich wenigstens
nach der letzten Eiszeit (in der nordischen Mythologie:
Zeit der Wanenherrschaft) als göttlich verehrt und als
Sinnbild der göttlichen Wesenheit genommen. Über
diese schon vor vielen Jahren von dem Wiener Gelehrten
Guido v. List erkannte Tatsache hat auch in den letzten
Jahren vor dem Kriege in einem Berliner Kreise einmal
der hochgeschätzte schwedische Reichsantiquar Oskar
Montelius auf Grund eigener Forschung vorgetragen;
seine Ergebnisse laufen mit denen v. Lists völlig zu-
sammen. Die Kreuzgestaltung der Lichtstrahlung an sich
zwar erwähnte MonteliuS nicht, wohl aber erkannte er,
daß das früheste Auftreten des Kreuzes in Verbindung
mit menschenähnlichen Gestalten oder mit dem Menschen-
haupte als Göttlichkeitsabzeichen aufgefaßt sein
will. So finden sich viele Bronzefiguren und Stein-
ritzungen vor, deren Entstehung auf Jahrtausende vor
dem Beginn unserer christlichen Aeitrechnung anzusetzen
ist, die einen möglichst edel geformten Männerkopf so
vor ein gleichschenkliges Kreuz stellen, daß der Schnitt-
punkt des Kreuzes, wenn man sich die Balken durch-
gezogen denkt, auf die Mitte des Gesichts treffen würde.
Das bedeutet also den Glorienschein der Göttlichkeit, und
diese Sinnbildlichkeit war lange vor der Aeit Christi
bekannt und angewendet im germanischen Norden, in
Jran, Agypten, Babylon (da jedenfalls aus der su-
merilchen Kultur herrührend). Jn erster Linie dürfte das
Sinnbild Sonnengottheiten, bzw. ibrer figürlichen
Darstellung, beigegeben worden sein, und so crklart sich
dann anschließend das Sonnenrad alS arisches heiligeS
Symbol überhaupt; es besteht aus dem senkrecht siehen-
den, gleichschenkligen Kreuz, von dem Allkreise umgeben,
dem all-einschließenden, der in der geheimen arischen
Symbolik nach v. List für sich allein die noch ungeoffen-
barte, jenseits von Aeit und Raum rein geistig in sich
selbst ruhende Gottheit (germanisch: Surtur, indisch:
Brahma) bezeichnet und der „Kreis Rührmichnichtan"
heißt. Dieses Kreuz, vom Göttlichkeitskreise umschlossen,
ergibt ein Vierspeichenrad, das den breiteren Volks-
schichten einfach als Sonnenrad galt.
Und aus dem einfachen Gleichschenkelkreuz, das aus
Holz gefertigt, mit Nabe versehen, bei den Johannis-
und Julfeiern auf den Bergen angezündet und gedreht
wurde, entstand durch sinndeutliche Mitanfügung der
von den kienigen Kreuzbalken ausgehende Rauch-
schwaden das bedeutsamste und häufigste aller Arier-
symbole: das Hakenkreuz, nordisch auch Thorshammer,
indisch Swastika genannt. Wir fügen hier Aeichnungen
zur Veranschaulichung dieses Werdeganges an:
Aeichnungen K:
o
Fig. 1: Lichlstrahlung.
Fig. 4: Das Feuerzeu-
gunasrad der Julseiern
iu Rechtsdrehung mit
links ziehenden Rauch-
schwaden.
Fig. 2: Lichtstrahlung
als Sinnbild der
Göttlichkeit.
Fig. 6: Das Radkreuz
mit den zu Hoken ge»
wordeuen Nauchschwa-
den, Rechtsdrehung.
Fifl.3: Das Radkreuz
(Sonnenrad), ohne
Ning Arinkreuz.
Fig. 6: Das Haken-
kreuz, Swastika, Thörs-
hammer. Die aus den
Nauchschwaden eut-
standeuen Hakeu deuten
schließlich die D ehungs-
richtung an.
Nun bezieht sich die Drehung des Kienrades auf dem
Feuerberg entweder auf die zum Steigen sich wendende
Sonne desWinterjuls oder aufdie abfallende des Sommer-
juls, des Johannistages. Man hat wohl zur einen Feier,
um die Sonne zu „lenken" (für die breiten Volksschichten
hatte der Kult ohne Zweifel, wenigstens in späteren
Zeiten, Aauberwirkung), nach links gedreht, zur andern
nach rechts, und so ergeben sich auch zwei in der Stellung
verschiedene Hakenkreuze, daö links und das rechts ge-
wendete, das auf- und absteigende, für die Wissenden
der alten Weisheit aber: daü dämonische und das theo-
nische, das der Verstofflichung und das der Vergeisti-
aung der Gottheit. Diese Männer — List nennt sie
Ärmanen, Mannen des „hohen Ar" — bezogen unter
sich das Symbol des Hakenkreuzes, unter dem sich
übrigens die Landnahme der alten Germanen vollzog
und das in manches deutschen Stammes Flurbrauchtum
ror
D
as Lichtkreuz.
Jn dcr „Deutschen Tageszeitung" schilderte
jüngst eine Frau eins von ihrbeobachtete Naturerscheinung,
welche darin bestand, daß daS Licht des Mondes, der in
einem Wolkenschleier stand, in Kreuzform nach vier Rich-
tungen mehr oder weniger weit über die Peripherie der
Mondscheibe hinausstrahlte. Wenn wir uns darüber
klar sind, daß eine Naturerscheinung immer nur auf der
Grundlage natürlicher Gesetzhaftigkeiten entstehen kann,
so soll damit niemandem das gemüthaft wurzelnde Be-
wußtsein unterbunden werden, daß ihm mit der Er-
scheinung ein auf das Weltgeschick bezügliches Aeichen
geboten sei.
Die Beobachtung der Dame ist nichts anderes als
eine naturbegründete immerwährende Erscheinung,
deren sich freilich nicht viele Leute aus eigener Schau
bewußt werden, und die gerade einmal unter besonders
günstigen Bedingungen stand.
Jedes Licht, ob Kerze, Glühbirne oder Stern, ob
Mond oder Sonne, bringt seine Strahlen in die An-
ordnung der Kreuzesform, wobei die Kreuzbalken
über die Peripherie des Flammenkreises mehr oder
weniger weit hinausreichen. Allerdings wird diese
Strahlenverteilung nur aus entsprechend großer Ent-
fernung von der Lichtquelle deutlich. Besondcrs stark
tritt die Erscheinung auf, wenn das nach dem Licht
sehende Auge feucht ist; offenbar treten da die Gesetze
der Strahlenbrechung in Wirkung.
Wie alt diese Beobachtung von der kreuzförmigen
Lichtstrahlung sein muß, ergibt sich daraus, daß das
Kreuz als Weihesinnbild völlig auf ihr steht und aus
ihr erwachsen ist. Und zwar mindestens schon in der
Steinzeit (6000 bis 2000 v. Chr.), wahrscheinlich aber
sehr viel früher. Das Licht wurde nämlich wenigstens
nach der letzten Eiszeit (in der nordischen Mythologie:
Zeit der Wanenherrschaft) als göttlich verehrt und als
Sinnbild der göttlichen Wesenheit genommen. Über
diese schon vor vielen Jahren von dem Wiener Gelehrten
Guido v. List erkannte Tatsache hat auch in den letzten
Jahren vor dem Kriege in einem Berliner Kreise einmal
der hochgeschätzte schwedische Reichsantiquar Oskar
Montelius auf Grund eigener Forschung vorgetragen;
seine Ergebnisse laufen mit denen v. Lists völlig zu-
sammen. Die Kreuzgestaltung der Lichtstrahlung an sich
zwar erwähnte MonteliuS nicht, wohl aber erkannte er,
daß das früheste Auftreten des Kreuzes in Verbindung
mit menschenähnlichen Gestalten oder mit dem Menschen-
haupte als Göttlichkeitsabzeichen aufgefaßt sein
will. So finden sich viele Bronzefiguren und Stein-
ritzungen vor, deren Entstehung auf Jahrtausende vor
dem Beginn unserer christlichen Aeitrechnung anzusetzen
ist, die einen möglichst edel geformten Männerkopf so
vor ein gleichschenkliges Kreuz stellen, daß der Schnitt-
punkt des Kreuzes, wenn man sich die Balken durch-
gezogen denkt, auf die Mitte des Gesichts treffen würde.
Das bedeutet also den Glorienschein der Göttlichkeit, und
diese Sinnbildlichkeit war lange vor der Aeit Christi
bekannt und angewendet im germanischen Norden, in
Jran, Agypten, Babylon (da jedenfalls aus der su-
merilchen Kultur herrührend). Jn erster Linie dürfte das
Sinnbild Sonnengottheiten, bzw. ibrer figürlichen
Darstellung, beigegeben worden sein, und so crklart sich
dann anschließend das Sonnenrad alS arisches heiligeS
Symbol überhaupt; es besteht aus dem senkrecht siehen-
den, gleichschenkligen Kreuz, von dem Allkreise umgeben,
dem all-einschließenden, der in der geheimen arischen
Symbolik nach v. List für sich allein die noch ungeoffen-
barte, jenseits von Aeit und Raum rein geistig in sich
selbst ruhende Gottheit (germanisch: Surtur, indisch:
Brahma) bezeichnet und der „Kreis Rührmichnichtan"
heißt. Dieses Kreuz, vom Göttlichkeitskreise umschlossen,
ergibt ein Vierspeichenrad, das den breiteren Volks-
schichten einfach als Sonnenrad galt.
Und aus dem einfachen Gleichschenkelkreuz, das aus
Holz gefertigt, mit Nabe versehen, bei den Johannis-
und Julfeiern auf den Bergen angezündet und gedreht
wurde, entstand durch sinndeutliche Mitanfügung der
von den kienigen Kreuzbalken ausgehende Rauch-
schwaden das bedeutsamste und häufigste aller Arier-
symbole: das Hakenkreuz, nordisch auch Thorshammer,
indisch Swastika genannt. Wir fügen hier Aeichnungen
zur Veranschaulichung dieses Werdeganges an:
Aeichnungen K:
o
Fig. 1: Lichlstrahlung.
Fig. 4: Das Feuerzeu-
gunasrad der Julseiern
iu Rechtsdrehung mit
links ziehenden Rauch-
schwaden.
Fig. 2: Lichtstrahlung
als Sinnbild der
Göttlichkeit.
Fig. 6: Das Radkreuz
mit den zu Hoken ge»
wordeuen Nauchschwa-
den, Rechtsdrehung.
Fifl.3: Das Radkreuz
(Sonnenrad), ohne
Ning Arinkreuz.
Fig. 6: Das Haken-
kreuz, Swastika, Thörs-
hammer. Die aus den
Nauchschwaden eut-
standeuen Hakeu deuten
schließlich die D ehungs-
richtung an.
Nun bezieht sich die Drehung des Kienrades auf dem
Feuerberg entweder auf die zum Steigen sich wendende
Sonne desWinterjuls oder aufdie abfallende des Sommer-
juls, des Johannistages. Man hat wohl zur einen Feier,
um die Sonne zu „lenken" (für die breiten Volksschichten
hatte der Kult ohne Zweifel, wenigstens in späteren
Zeiten, Aauberwirkung), nach links gedreht, zur andern
nach rechts, und so ergeben sich auch zwei in der Stellung
verschiedene Hakenkreuze, daö links und das rechts ge-
wendete, das auf- und absteigende, für die Wissenden
der alten Weisheit aber: daü dämonische und das theo-
nische, das der Verstofflichung und das der Vergeisti-
aung der Gottheit. Diese Männer — List nennt sie
Ärmanen, Mannen des „hohen Ar" — bezogen unter
sich das Symbol des Hakenkreuzes, unter dem sich
übrigens die Landnahme der alten Germanen vollzog
und das in manches deutschen Stammes Flurbrauchtum
ror