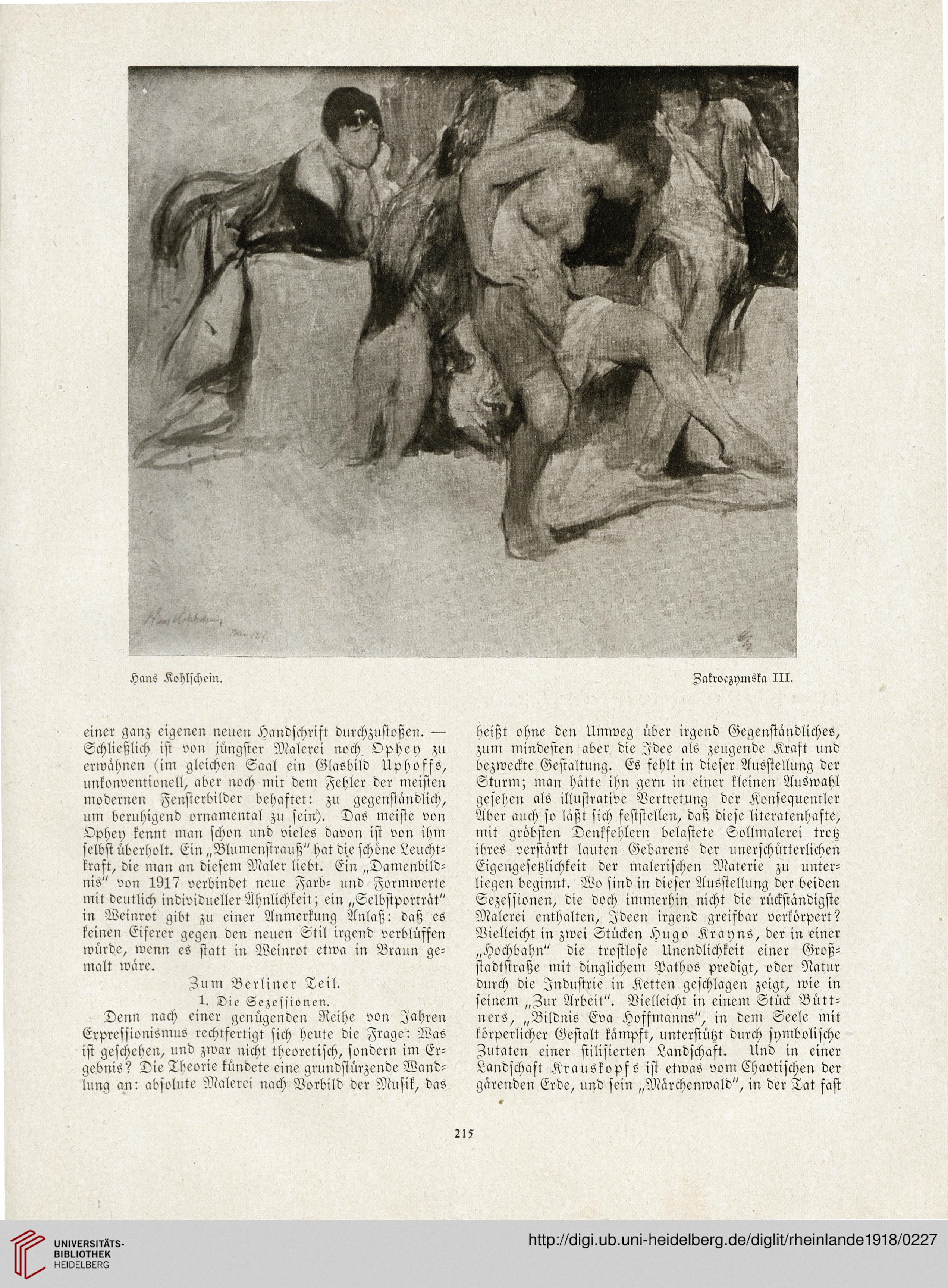einer ganz eigenen neuen Handschrift durchzustoßen. —
Schließlich ist von jüngster Malerei noch Ophey zu
erwähnen (im glcichen Saal ein Glasbild Uphoffch
unkonventionell, aber noch mit dem Fehler der meisten
modernen Fensterbilder behaftet: zu gegenstandlich,
um beruhigend ornamental zu sein). Das meiste von
Ophey kennt man schon und vieles davon ist von ihm
selbst überholt. Ein „Blumenstrauß" hat die schöne Leucht-
krafu die man an diesem Maler liebt. Ein „Damenbild-
nis" von 1917 verbindet neue Farb- und Formwerte
mit deutlich individueller Ähnlichkeit; ein „Selbstportrat"
in Weinrot gibt zu einer Anmerkung Anlaß: daß es
keinen Eiferer gegen den neuen Stil irgend verblüffcn
würde, wenn es statt in Weinrot etwa in Braun ge-
malt ware.
Ium Berliner Teil.
1. Die Sezessionen.
Denn nach einer genügenden Reihe von Jahren
Erpressionismus rechtfertigt sich heute die Frage: Was
ist geschehen, und zwar nicht theoretisch, sondern im Er-
gebnis? Die Theorie kündete eine grundstürzende Wand-
lung an: absolute Malerei nach Vorbild der Musik, das
heißt ohne den Umweg über irgend Gegenständliches,
zum mindestcn aber die Jdee als zeugende Kraft und
bezweckte Gestaltung. Es fehlt in diescr Auöstellung der
Sturm; man hätte ihn gern in einer kleincn Auswahl
gesehen als illustrative Vertrctung der Konsequentler
Aber auch so läßt sich feststellen, daß diese literatenhafte,
mit gröbsten Denkfehlern belastete Sollmalerei trotz
ihres verstärkt larlten Gebarens der unerschütterlichen
Eigcngesetzlichkeit der malerischen Matcrie zu unter-
liegen beginnt. Wo sind in dieser Ausstellung der beiden
Sezessionen, die doch immerhin nicht die rückständigste
Malerei enthalten, Jdeen irgcnd greifbar verkörpert?
Vielleicht in zwei Stücken Hugo Krayns, der in einer
„Hochbahn" die trostlose Unendlichkeit einer Groß-
stadtstraße mit dinglichem Pathos predigt, oder Natur
durch die Jndustrie in Ketten geschlagen zcigt, wie in
seinem „Aur Arbeit". Vielleicht in einem Stück Bütt-
ncrs, „Bildnis Eva Hoffmanns", in dem Seele mit
körperlichcr Gestalt kämpft, unterstützt durch symbolische
Autaten einer stilisierten Landschaft. Und in einer
Landschaft Krauskopfs ist etwas vom Chaotischen der
gärenden Erde, und sein „Märchenwald", in der Tat fast
Hans Kohlschein.
Aakroczymska III.
.
Schließlich ist von jüngster Malerei noch Ophey zu
erwähnen (im glcichen Saal ein Glasbild Uphoffch
unkonventionell, aber noch mit dem Fehler der meisten
modernen Fensterbilder behaftet: zu gegenstandlich,
um beruhigend ornamental zu sein). Das meiste von
Ophey kennt man schon und vieles davon ist von ihm
selbst überholt. Ein „Blumenstrauß" hat die schöne Leucht-
krafu die man an diesem Maler liebt. Ein „Damenbild-
nis" von 1917 verbindet neue Farb- und Formwerte
mit deutlich individueller Ähnlichkeit; ein „Selbstportrat"
in Weinrot gibt zu einer Anmerkung Anlaß: daß es
keinen Eiferer gegen den neuen Stil irgend verblüffcn
würde, wenn es statt in Weinrot etwa in Braun ge-
malt ware.
Ium Berliner Teil.
1. Die Sezessionen.
Denn nach einer genügenden Reihe von Jahren
Erpressionismus rechtfertigt sich heute die Frage: Was
ist geschehen, und zwar nicht theoretisch, sondern im Er-
gebnis? Die Theorie kündete eine grundstürzende Wand-
lung an: absolute Malerei nach Vorbild der Musik, das
heißt ohne den Umweg über irgend Gegenständliches,
zum mindestcn aber die Jdee als zeugende Kraft und
bezweckte Gestaltung. Es fehlt in diescr Auöstellung der
Sturm; man hätte ihn gern in einer kleincn Auswahl
gesehen als illustrative Vertrctung der Konsequentler
Aber auch so läßt sich feststellen, daß diese literatenhafte,
mit gröbsten Denkfehlern belastete Sollmalerei trotz
ihres verstärkt larlten Gebarens der unerschütterlichen
Eigcngesetzlichkeit der malerischen Matcrie zu unter-
liegen beginnt. Wo sind in dieser Ausstellung der beiden
Sezessionen, die doch immerhin nicht die rückständigste
Malerei enthalten, Jdeen irgcnd greifbar verkörpert?
Vielleicht in zwei Stücken Hugo Krayns, der in einer
„Hochbahn" die trostlose Unendlichkeit einer Groß-
stadtstraße mit dinglichem Pathos predigt, oder Natur
durch die Jndustrie in Ketten geschlagen zcigt, wie in
seinem „Aur Arbeit". Vielleicht in einem Stück Bütt-
ncrs, „Bildnis Eva Hoffmanns", in dem Seele mit
körperlichcr Gestalt kämpft, unterstützt durch symbolische
Autaten einer stilisierten Landschaft. Und in einer
Landschaft Krauskopfs ist etwas vom Chaotischen der
gärenden Erde, und sein „Märchenwald", in der Tat fast
Hans Kohlschein.
Aakroczymska III.
.