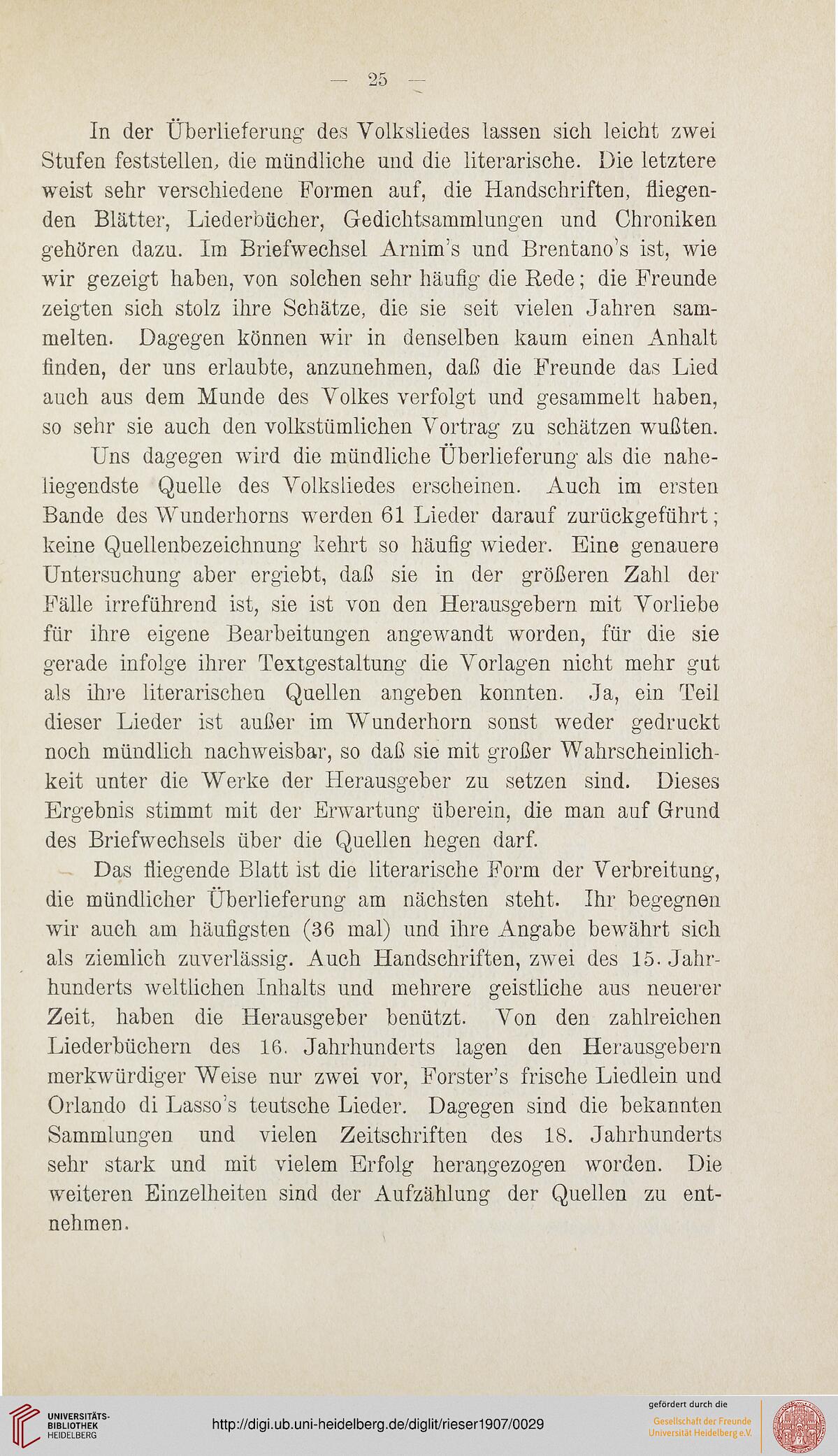— 25 —
In der Überlieferung des Volksliedes lassen sich leicht zwei
Stufen feststellen, die mündliche und die literarische. Die letztere
weist sehr verschiedene Formen auf, die Handschriften, fliegen-
den Blätter, Liederbücher, Gedichtsammlungen und Chroniken
gehören dazu. Im Briefwechsel Arnim’s und Brentano’s ist, wie
wir gezeigt haben, von solchen sehr häufig die Bede; die Freunde
zeigten sich stolz ihre Schätze, die sie seit vielen Jahren sam-
melten. Dagegen können wir in denselben kaum einen Anhalt
finden, der uns erlaubte, anzunehmen, daß die Freunde das Lied
auch aus dem Munde des Volkes verfolgt und gesammelt haben,
so sehr sie auch den volkstümlichen Vortrag zu schätzen wußten.
Uns dagegen wird die mündliche Überlieferung als die nahe-
liegendste Quelle des Volksliedes erscheinen. Auch im ersten
Bande des Wunderhorns werden 61 Lieder darauf zurückgeführt;
keine Quellenbezeichnung kehrt so häufig wieder. Eine genauere
Untersuchung aber ergiebt, daß sie in der größeren Zahl der
Fälle irreführend ist, sie ist von den Herausgebern mit Vorliebe
für ihre eigene Bearbeitungen angewandt worden, für die sie
gerade infolge ihrer Textgestaltung die Vorlagen nicht mehr gut
als ihre literarischen Quellen angeben konnten. Ja, ein Teil
dieser Lieder ist außer im Wunderhorn sonst weder gedruckt
noch mündlich nachweisbar, so daß sie mit großer Wahrscheinlich-
keit unter die Werke der Herausgeber zu setzen sind. Dieses
Ergebnis stimmt mit der Erwartung überein, die man auf Grund
des Briefwechsels über die Quellen hegen darf.
Das fliegende Blatt ist die literarische Form der Verbreitung,
die mündlicher Überlieferung am nächsten steht. Ihr begegnen
wir auch am häufigsten (36 mal) und ihre Angabe bewährt sich
als ziemlich zuverlässig. Auch Handschriften, zwei des 15. Jahr-
hunderts weltlichen Inhalts und mehrere geistliche aus neuerer
Zeit, haben die Herausgeber benützt. Von den zahlreichen
Liederbüchern des 16. Jahrhunderts lagen den Herausgebern
merkwürdiger Weise nur zwei vor, Forster’s frische Liedlein und
Orlando di Lasso’s teutsche Lieder. Dagegen sind die bekannten
Sammlungen und vielen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts
sehr stark und mit vielem Erfolg herangezogen worden. Die
weiteren Einzelheiten sind der Aufzählung der Quellen zu ent-
nehmen.
In der Überlieferung des Volksliedes lassen sich leicht zwei
Stufen feststellen, die mündliche und die literarische. Die letztere
weist sehr verschiedene Formen auf, die Handschriften, fliegen-
den Blätter, Liederbücher, Gedichtsammlungen und Chroniken
gehören dazu. Im Briefwechsel Arnim’s und Brentano’s ist, wie
wir gezeigt haben, von solchen sehr häufig die Bede; die Freunde
zeigten sich stolz ihre Schätze, die sie seit vielen Jahren sam-
melten. Dagegen können wir in denselben kaum einen Anhalt
finden, der uns erlaubte, anzunehmen, daß die Freunde das Lied
auch aus dem Munde des Volkes verfolgt und gesammelt haben,
so sehr sie auch den volkstümlichen Vortrag zu schätzen wußten.
Uns dagegen wird die mündliche Überlieferung als die nahe-
liegendste Quelle des Volksliedes erscheinen. Auch im ersten
Bande des Wunderhorns werden 61 Lieder darauf zurückgeführt;
keine Quellenbezeichnung kehrt so häufig wieder. Eine genauere
Untersuchung aber ergiebt, daß sie in der größeren Zahl der
Fälle irreführend ist, sie ist von den Herausgebern mit Vorliebe
für ihre eigene Bearbeitungen angewandt worden, für die sie
gerade infolge ihrer Textgestaltung die Vorlagen nicht mehr gut
als ihre literarischen Quellen angeben konnten. Ja, ein Teil
dieser Lieder ist außer im Wunderhorn sonst weder gedruckt
noch mündlich nachweisbar, so daß sie mit großer Wahrscheinlich-
keit unter die Werke der Herausgeber zu setzen sind. Dieses
Ergebnis stimmt mit der Erwartung überein, die man auf Grund
des Briefwechsels über die Quellen hegen darf.
Das fliegende Blatt ist die literarische Form der Verbreitung,
die mündlicher Überlieferung am nächsten steht. Ihr begegnen
wir auch am häufigsten (36 mal) und ihre Angabe bewährt sich
als ziemlich zuverlässig. Auch Handschriften, zwei des 15. Jahr-
hunderts weltlichen Inhalts und mehrere geistliche aus neuerer
Zeit, haben die Herausgeber benützt. Von den zahlreichen
Liederbüchern des 16. Jahrhunderts lagen den Herausgebern
merkwürdiger Weise nur zwei vor, Forster’s frische Liedlein und
Orlando di Lasso’s teutsche Lieder. Dagegen sind die bekannten
Sammlungen und vielen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts
sehr stark und mit vielem Erfolg herangezogen worden. Die
weiteren Einzelheiten sind der Aufzählung der Quellen zu ent-
nehmen.