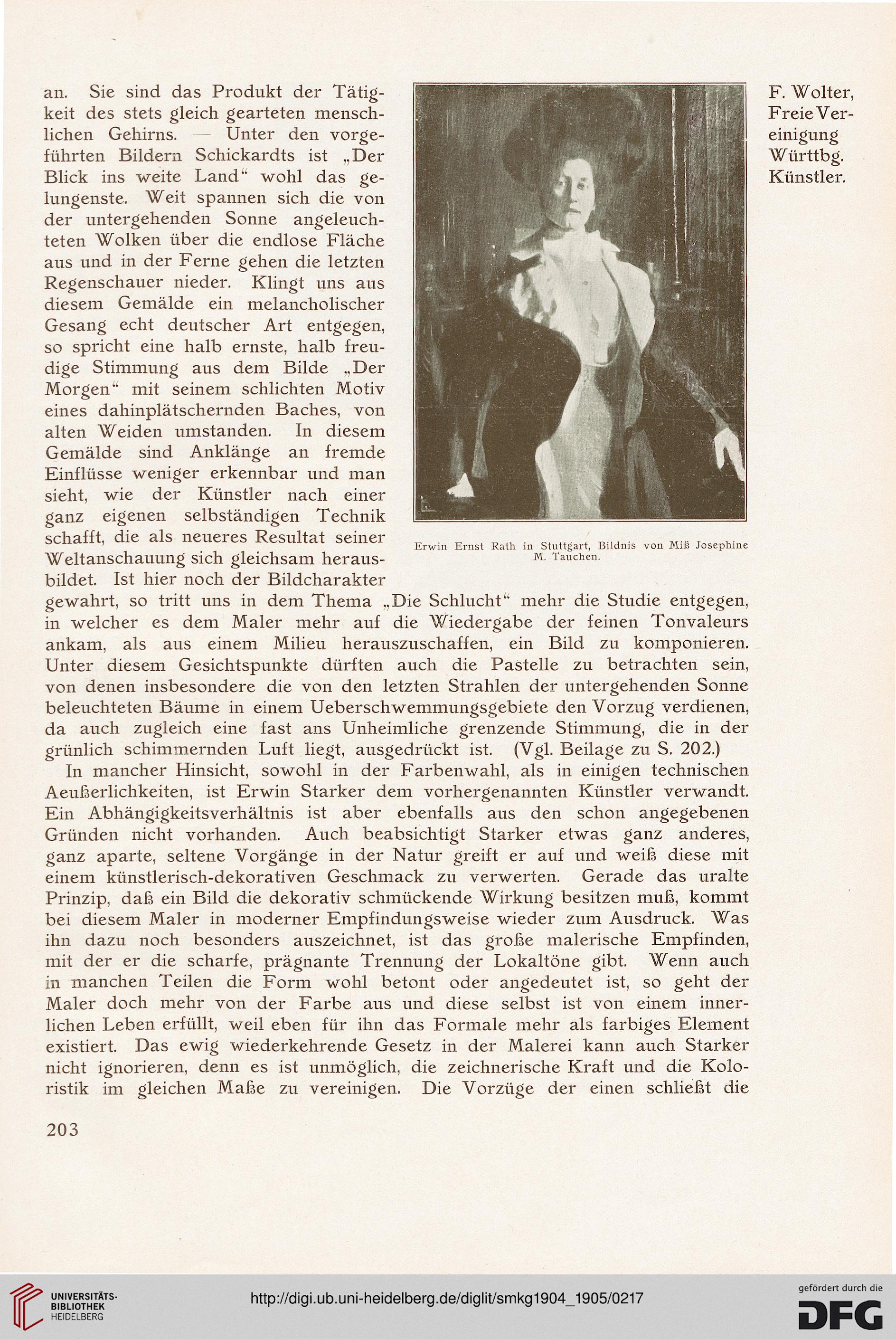Erwin Ernst Rath in Stuttgart, Bildnis von Miß Josephine
M. Tauchen.
an. Sie sind das Produkt der Tätig-
keit des stets gleich gearteten mensch-
lichen Gehirns. Unter den vorge-
führten Bildern Schickardts ist „Der
Blick ins weite Land" wohl das ge-
lungenste. Weit spannen sich die von
der untergehenden Sonne angeleuch-
teten Wolken über die endlose Fläche
aus und in der Ferne gehen die letzten
Regenschauer nieder. Klingt uns aus
diesem Gemälde ein melancholischer
Gesang echt deutscher Art entgegen,
so spricht eine halb ernste, halb freu-
dige Stimmung aus dem Bilde ..Der
Morgen" mit seinem schlichten Motiv
eines dahinplätschernden Baches, von
alten Weiden umstanden. In diesem
Gemälde sind Anklänge an fremde
Einflüsse weniger erkennbar und man
sieht, wie der Künstler nach einer
ganz eigenen selbständigen Technik
schafft, die als neueres Resultat seiner
Weltanschauung sich gleichsam heraus-
bildet. Ist hier noch der Bildcharakter
gewahrt, so tritt uns in dem Thema ..Die Schlucht" mehr die Studie entgegen,
in welcher es dem Maler mehr auf die Wiedergabe der feinen Tonvaleurs
ankam, als aus einem Milieu herauszuschaffen, ein Bild zu komponieren.
Unter diesem Gesichtspunkte dürften auch die Pastelle zu betrachten sein,
von denen insbesondere die von den letzten Strahlen der untergehenden Sonne
beleuchteten Bäume in einem Ueberschwemmungsgebiete den Vorzug verdienen,
da auch zugleich eine fast ans Unheimliche grenzende Stimmung, die in der
grünlich schimmernden Luft liegt, ausgedrückt ist. (Vgl. Beilage zu S. 202.)
In mancher Hinsicht, sowohl in der Farbenwahl, als in einigen technischen
Aeußerlichkeiten, ist Erwin Starker dem vorhergenannten Künstler verwandt.
Ein Abhängigkeitsverhältnis ist aber ebenfalls aus den schon angegebenen
Gründen nicht vorhanden. Auch beabsichtigt Starker etwas ganz anderes,
ganz aparte, seltene Vorgänge in der Natur greift er auf und weiß diese mit
einem künstlerisch-dekorativen Geschmack zu verwerten. Gerade das uralte
Prinzip, daß ein Bild die dekorativ schmückende Wirkung besitzen muß, kommt
bei diesem Maler in moderner Empfindungsweise wieder zum Ausdruck. Was
ihn dazu noch besonders auszeichnet, ist das große malerische Empfinden,
mit der er die scharfe, prägnante Trennung der Lokaltöne gibt. Wenn auch
in manchen Teilen die Form wohl betont oder angedeutet ist, so geht der
Maler doch mehr von der Farbe aus und diese selbst ist von einem inner-
lichen Leben erfüllt, weil eben für ihn das Formale mehr als farbiges Element
existiert. Das ewig wiederkehrende Gesetz in der Malerei kann auch Starker
nicht ignorieren, denn es ist unmöglich, die zeichnerische Kraft und die Kolo-
ristik im gleichen Maße zu vereinigen. Die Vorzüge der einen schließt die
F. Wolter,
Freie Ver-
einigung
Württbg.
Künstler.
203
M. Tauchen.
an. Sie sind das Produkt der Tätig-
keit des stets gleich gearteten mensch-
lichen Gehirns. Unter den vorge-
führten Bildern Schickardts ist „Der
Blick ins weite Land" wohl das ge-
lungenste. Weit spannen sich die von
der untergehenden Sonne angeleuch-
teten Wolken über die endlose Fläche
aus und in der Ferne gehen die letzten
Regenschauer nieder. Klingt uns aus
diesem Gemälde ein melancholischer
Gesang echt deutscher Art entgegen,
so spricht eine halb ernste, halb freu-
dige Stimmung aus dem Bilde ..Der
Morgen" mit seinem schlichten Motiv
eines dahinplätschernden Baches, von
alten Weiden umstanden. In diesem
Gemälde sind Anklänge an fremde
Einflüsse weniger erkennbar und man
sieht, wie der Künstler nach einer
ganz eigenen selbständigen Technik
schafft, die als neueres Resultat seiner
Weltanschauung sich gleichsam heraus-
bildet. Ist hier noch der Bildcharakter
gewahrt, so tritt uns in dem Thema ..Die Schlucht" mehr die Studie entgegen,
in welcher es dem Maler mehr auf die Wiedergabe der feinen Tonvaleurs
ankam, als aus einem Milieu herauszuschaffen, ein Bild zu komponieren.
Unter diesem Gesichtspunkte dürften auch die Pastelle zu betrachten sein,
von denen insbesondere die von den letzten Strahlen der untergehenden Sonne
beleuchteten Bäume in einem Ueberschwemmungsgebiete den Vorzug verdienen,
da auch zugleich eine fast ans Unheimliche grenzende Stimmung, die in der
grünlich schimmernden Luft liegt, ausgedrückt ist. (Vgl. Beilage zu S. 202.)
In mancher Hinsicht, sowohl in der Farbenwahl, als in einigen technischen
Aeußerlichkeiten, ist Erwin Starker dem vorhergenannten Künstler verwandt.
Ein Abhängigkeitsverhältnis ist aber ebenfalls aus den schon angegebenen
Gründen nicht vorhanden. Auch beabsichtigt Starker etwas ganz anderes,
ganz aparte, seltene Vorgänge in der Natur greift er auf und weiß diese mit
einem künstlerisch-dekorativen Geschmack zu verwerten. Gerade das uralte
Prinzip, daß ein Bild die dekorativ schmückende Wirkung besitzen muß, kommt
bei diesem Maler in moderner Empfindungsweise wieder zum Ausdruck. Was
ihn dazu noch besonders auszeichnet, ist das große malerische Empfinden,
mit der er die scharfe, prägnante Trennung der Lokaltöne gibt. Wenn auch
in manchen Teilen die Form wohl betont oder angedeutet ist, so geht der
Maler doch mehr von der Farbe aus und diese selbst ist von einem inner-
lichen Leben erfüllt, weil eben für ihn das Formale mehr als farbiges Element
existiert. Das ewig wiederkehrende Gesetz in der Malerei kann auch Starker
nicht ignorieren, denn es ist unmöglich, die zeichnerische Kraft und die Kolo-
ristik im gleichen Maße zu vereinigen. Die Vorzüge der einen schließt die
F. Wolter,
Freie Ver-
einigung
Württbg.
Künstler.
203