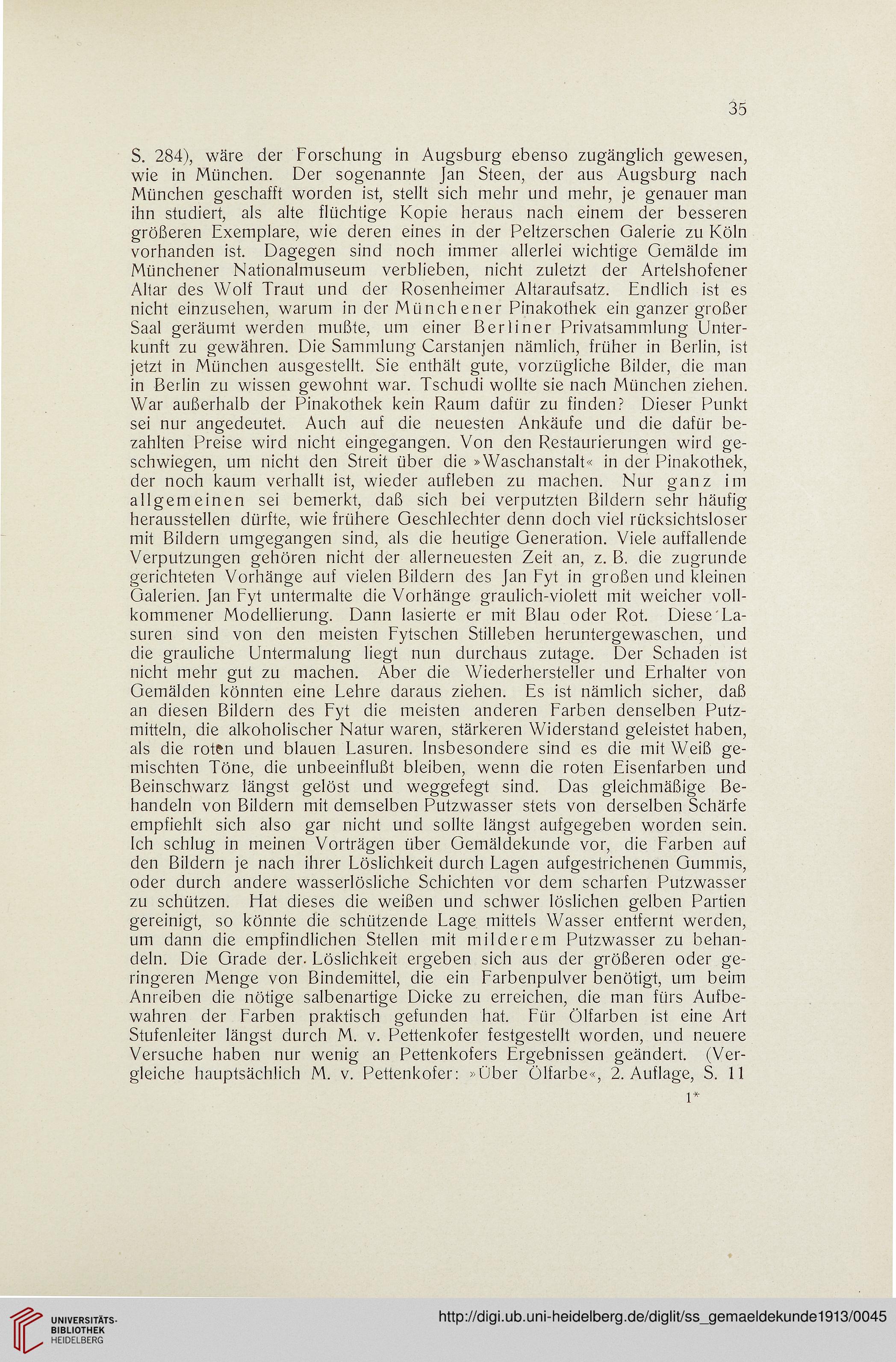35
S. 284), wäre der Forschung in Augsburg ebenso zugänglich gewesen,
wie in München. Der sogenannte Jan Steen, der aus Augsburg nach
München geschafft worden ist, steht sich mehr und mehr, je genauer man
ihn studiert, a!s aite flüchtige Kopie heraus nach einem der besseren
größeren Exempiare, wie deren eines in der Peitzerschen Galerie zu Köln
vorhanden ist. Dagegen sind noch immer allerlei wichtige Gemälde im
Münchener Nationalmuseum verblieben, nicht zuletzt der Artelshofener
Altar des Wolf Traut und der Rosenheimer Altaraufsatz. Endlich ist es
nicht einzusehen, warum in der Münchener Pinakothek ein ganzer großer
Saal geräumt werden mußte, um einer Berliner Privatsammlung Unter-
kunft zu gewähren. Die Sammlung Carstanjen nämlich, früher in Berlin, ist
jetzt in München ausgestellt. Sie enthält gute, vorzügliche Bilder, die man
in Berlin zu wissen gewohnt war. Tschudi wollte sie nach München ziehen.
War außerhalb der Pinakothek kein Raum dafür zu finden? Dieser Punkt
sei nur angedeutet. Auch auf die neuesten Ankäufe und die dafür be-
zahlten Preise wird nicht eingegangen. Von den Restaurierungen wird ge-
schwiegen, um nicht den Streit über die »Waschanstalt« in der Pinakothek,
der noch kaum verhallt ist, wieder aufleben zu machen. Nur ganz im
allgemeinen sei bemerkt, daß sich bei verputzten Bildern sehr häufig
herausstellen dürfte, wie frühere Geschlechter denn doch viel rücksichtsloser
mit Bildern umgegangen sind, als die heutige Generation. Viele auffallende
Verputzungen gehören nicht der allerneuesten Zeit an, z. B. die zugrunde
gerichteten Vorhänge auf vielen Bildern des Jan Eyt in großen und kleinen
Galerien. Jan Fyt untermalte die Vorhänge graulich-violett mit weicher voll-
kommener Modellierung. Dann lasierte er mit Blau oder Rot. Diese La-
suren sind von den meisten Fytschen Stilleben heruntergewaschen, und
die grauliche Untermalung liegt nun durchaus zutage. Der Schaden ist
nicht mehr gut zu machen. Aber die Wiederhersteller und Erhalter von
Gemälden könnten eine Lehre daraus ziehen. Es ist nämlich sicher, daß
an diesen Bildern des Fyt die meisten anderen Farben denselben Putz-
mitteln, die alkoholischer Natur waren, stärkeren Widerstand geleistet haben,
als die roten und blauen Lasuren. Insbesondere sind es die mit Weiß ge-
mischten Töne, die unbeeinflußt bleiben, wenn die roten Eisenfarben und
Beinschwarz längst gelöst und weggefegt sind. Das gleichmäßige Be-
handeln von Bildern mit demselben Putzwasser stets von derselben Schärfe
empfiehlt sich also gar nicht und sollte längst aufgegeben worden sein.
Ich schlug in meinen Vorträgen über Gemäldekunde vor, die Farben auf
den Bildern je nach ihrer Löslichkeit durch Lagen aufgestrichenen Gummis,
oder durch andere wasserlösliche Schichten vor dem scharfen Putzwasser
zu schützen. Hat dieses die weißen und schwer löslichen gelben Partien
gereinigt, so könnte die schützende Lage mittels Wasser entfernt werden,
um dann die empfindlichen Stellen mit milderem Putzwasser zu behan-
deln. Die Grade der. Löslichkeit ergeben sich aus der größeren oder ge-
ringeren Menge von Bindemittel, die ein Farbenpulver benötigt, um beim
Anreiben die nötige salbenartige Dicke zu erreichen, die man fürs Aufbe-
wahren der Farben praktisch gefunden hat. Für Ölfarben ist eine Art
Stufenleiter längst durch M. v. Pettenkofer festgestellt worden, und neuere
Versuche haben nur wenig an Pettenkofers Ergebnissen geändert. (Ver-
gleiche hauptsächlich M. v. Pettenkofer: »Über Ölfarbe«, 2. Auflage, S. 11
l*
S. 284), wäre der Forschung in Augsburg ebenso zugänglich gewesen,
wie in München. Der sogenannte Jan Steen, der aus Augsburg nach
München geschafft worden ist, steht sich mehr und mehr, je genauer man
ihn studiert, a!s aite flüchtige Kopie heraus nach einem der besseren
größeren Exempiare, wie deren eines in der Peitzerschen Galerie zu Köln
vorhanden ist. Dagegen sind noch immer allerlei wichtige Gemälde im
Münchener Nationalmuseum verblieben, nicht zuletzt der Artelshofener
Altar des Wolf Traut und der Rosenheimer Altaraufsatz. Endlich ist es
nicht einzusehen, warum in der Münchener Pinakothek ein ganzer großer
Saal geräumt werden mußte, um einer Berliner Privatsammlung Unter-
kunft zu gewähren. Die Sammlung Carstanjen nämlich, früher in Berlin, ist
jetzt in München ausgestellt. Sie enthält gute, vorzügliche Bilder, die man
in Berlin zu wissen gewohnt war. Tschudi wollte sie nach München ziehen.
War außerhalb der Pinakothek kein Raum dafür zu finden? Dieser Punkt
sei nur angedeutet. Auch auf die neuesten Ankäufe und die dafür be-
zahlten Preise wird nicht eingegangen. Von den Restaurierungen wird ge-
schwiegen, um nicht den Streit über die »Waschanstalt« in der Pinakothek,
der noch kaum verhallt ist, wieder aufleben zu machen. Nur ganz im
allgemeinen sei bemerkt, daß sich bei verputzten Bildern sehr häufig
herausstellen dürfte, wie frühere Geschlechter denn doch viel rücksichtsloser
mit Bildern umgegangen sind, als die heutige Generation. Viele auffallende
Verputzungen gehören nicht der allerneuesten Zeit an, z. B. die zugrunde
gerichteten Vorhänge auf vielen Bildern des Jan Eyt in großen und kleinen
Galerien. Jan Fyt untermalte die Vorhänge graulich-violett mit weicher voll-
kommener Modellierung. Dann lasierte er mit Blau oder Rot. Diese La-
suren sind von den meisten Fytschen Stilleben heruntergewaschen, und
die grauliche Untermalung liegt nun durchaus zutage. Der Schaden ist
nicht mehr gut zu machen. Aber die Wiederhersteller und Erhalter von
Gemälden könnten eine Lehre daraus ziehen. Es ist nämlich sicher, daß
an diesen Bildern des Fyt die meisten anderen Farben denselben Putz-
mitteln, die alkoholischer Natur waren, stärkeren Widerstand geleistet haben,
als die roten und blauen Lasuren. Insbesondere sind es die mit Weiß ge-
mischten Töne, die unbeeinflußt bleiben, wenn die roten Eisenfarben und
Beinschwarz längst gelöst und weggefegt sind. Das gleichmäßige Be-
handeln von Bildern mit demselben Putzwasser stets von derselben Schärfe
empfiehlt sich also gar nicht und sollte längst aufgegeben worden sein.
Ich schlug in meinen Vorträgen über Gemäldekunde vor, die Farben auf
den Bildern je nach ihrer Löslichkeit durch Lagen aufgestrichenen Gummis,
oder durch andere wasserlösliche Schichten vor dem scharfen Putzwasser
zu schützen. Hat dieses die weißen und schwer löslichen gelben Partien
gereinigt, so könnte die schützende Lage mittels Wasser entfernt werden,
um dann die empfindlichen Stellen mit milderem Putzwasser zu behan-
deln. Die Grade der. Löslichkeit ergeben sich aus der größeren oder ge-
ringeren Menge von Bindemittel, die ein Farbenpulver benötigt, um beim
Anreiben die nötige salbenartige Dicke zu erreichen, die man fürs Aufbe-
wahren der Farben praktisch gefunden hat. Für Ölfarben ist eine Art
Stufenleiter längst durch M. v. Pettenkofer festgestellt worden, und neuere
Versuche haben nur wenig an Pettenkofers Ergebnissen geändert. (Ver-
gleiche hauptsächlich M. v. Pettenkofer: »Über Ölfarbe«, 2. Auflage, S. 11
l*