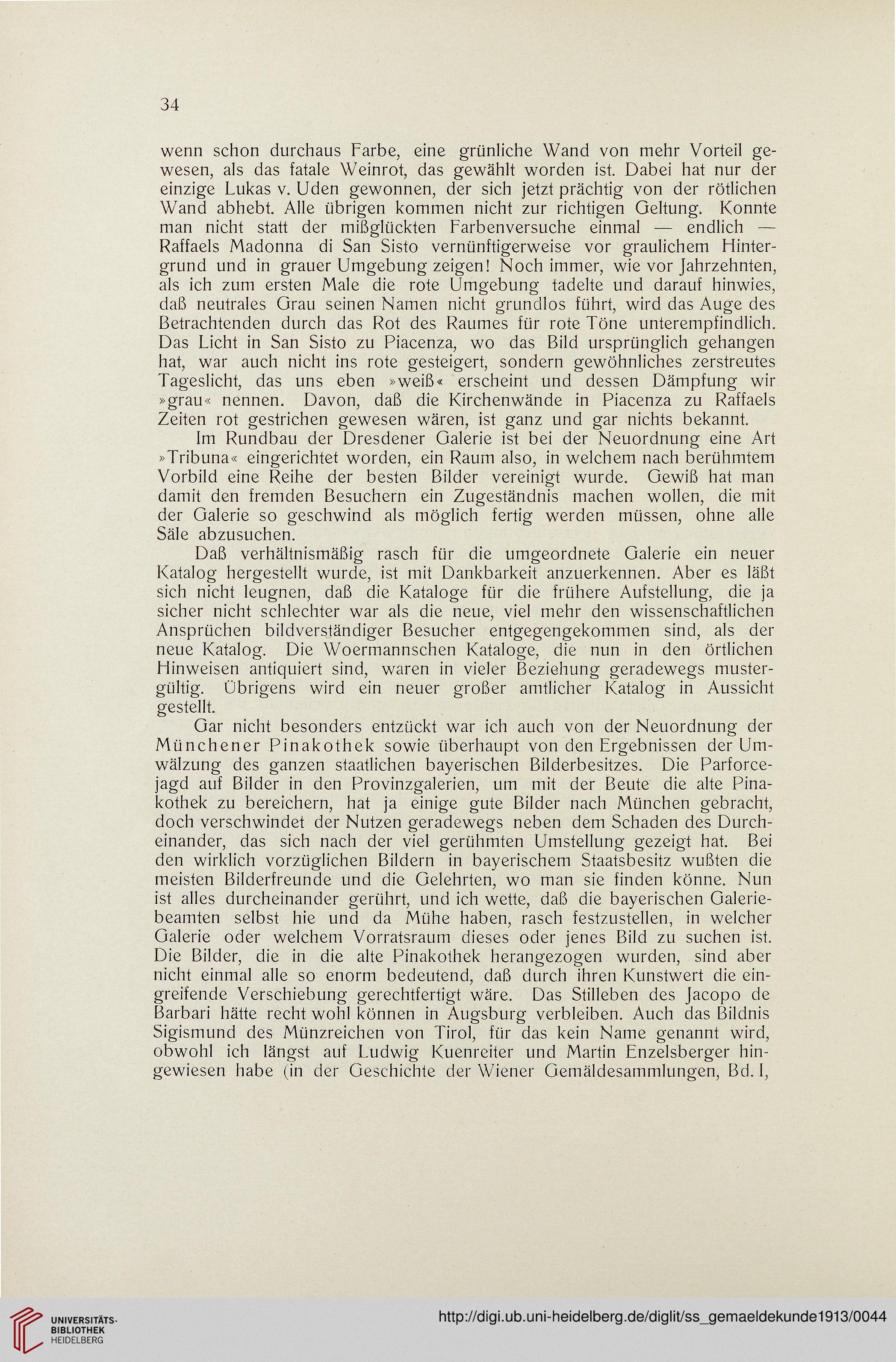34
wenn schon durchaus Farbe, eine grünliche Wand von mehr Vorteil ge-
wesen, als das fatale Weinrot, das gewählt worden ist. Dabei hat nur der
einzige Lukas v. Uden gewonnen, der sich jetzt prächtig von der rötlichen
Wand abhebt. Alle übrigen kommen nicht zur richtigen Geltung. Konnte
man nicht statt der mißglückten Farbenversuche einmal — endlich —
Raffaels Madonna di San Sisto vernünftigerweise vor graulichem Hinter-
grund und in grauer Umgebung zeigen! Noch immer, wie vor Jahrzehnten,
als ich zum ersten Male die rote Umgebung tadelte und darauf hinwies,
daß neutrales Grau seinen Namen nicht grundlos führt, wird das Auge des
Betrachtenden durch das Rot des Raumes für rote Töne unterempfindlich.
Das Licht in San Sisto zu Piacenza, wo das Bild ursprünglich gehangen
hat, war auch nicht ins rote gesteigert, sondern gewöhnliches zerstreutes
Tageslicht, das uns eben »weiß« erscheint und dessen Dämpfung wir
»grau« nennen. Davon, daß die Kirchenwände in Piacenza zu Raffaels
Zeiten rot gestrichen gewesen wären, ist ganz und gar nichts bekannt.
Im Rundbau der Dresdener Galerie ist bei der Neuordnung eine Art
»Tribuna« eingerichtet worden, ein Raum also, in welchem nach berühmtem
Vorbild eine Reihe der besten Bilder vereinigt wurde. Gewiß hat man
damit den fremden Besuchern ein Zugeständnis machen wollen, die mit
der Galerie so geschwind als möglich fertig werden müssen, ohne alle
Säle abzusuchen.
Daß verhältnismäßig rasch für die umgeordnete Galerie ein neuer
Katalog hergestellt wurde, ist mit Dankbarkeit anzuerkennen. Aber es läßt
sich nicht leugnen, daß die Kataloge für die frühere Aufstellung, die ja
sicher nicht schlechter war als die neue, viel mehr den wissenschaftlichen
Ansprüchen bildverständiger Besucher entgegengekommen sind, als der
neue Katalog. Die Woermannschen Kataloge, die nun in den örtlichen
Hinweisen antiquiert sind, waren in vieler Beziehung geradewegs muster-
gültig. Übrigens wird ein neuer großer amtlicher Katalog in Aussicht
gestellt.
Gar nicht besonders entzückt war ich auch von der Neuordnung der
Münchener Pinakothek sowie überhaupt von den Ergebnissen der Um-
wälzung des ganzen staatlichen bayerischen Bilderbesitzes. Die Parforce-
jagd auf Bilder in den Provinzgalerien, um mit der Beute die alte Pina-
kothek zu bereichern, hat ja einige gute Bilder nach München gebracht,
doch verschwindet der Nutzen geradewegs neben dem Schaden des Durch-
einander, das sich nach der viel gerühmten Umstellung gezeigt hat. Bei
den wirklich vorzüglichen Bildern in bayerischem Staatsbesitz wußten die
meisten Bilderfreunde und die Gelehrten, wo man sie finden könne. Nun
ist alles durcheinander gerührt, und ich wette, daß die bayerischen Galerie-
beamten selbst hie und da Mühe haben, rasch festzustellen, in welcher
Galerie oder welchem Vorratsraum dieses oder jenes Bild zu suchen ist.
Die Bilder, die in die alte Pinakothek herangezogen wurden, sind aber
nicht einmal alle so enorm bedeutend, daß durch ihren Kunstwert die ein-
greifende Verschiebung gerechtfertigt wäre. Das Stilleben des Jacopo de
Barbari hätte recht wohl können in Augsburg verbleiben. Auch das Bildnis
Sigismund des Münzreichen von Tirol, für das kein Name genannt wird,
obwohl ich längst auf Ludwig Kuenrciter und Martin Enzelsberger hin-
gewiesen habe (in der Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen, Bd. 1,
wenn schon durchaus Farbe, eine grünliche Wand von mehr Vorteil ge-
wesen, als das fatale Weinrot, das gewählt worden ist. Dabei hat nur der
einzige Lukas v. Uden gewonnen, der sich jetzt prächtig von der rötlichen
Wand abhebt. Alle übrigen kommen nicht zur richtigen Geltung. Konnte
man nicht statt der mißglückten Farbenversuche einmal — endlich —
Raffaels Madonna di San Sisto vernünftigerweise vor graulichem Hinter-
grund und in grauer Umgebung zeigen! Noch immer, wie vor Jahrzehnten,
als ich zum ersten Male die rote Umgebung tadelte und darauf hinwies,
daß neutrales Grau seinen Namen nicht grundlos führt, wird das Auge des
Betrachtenden durch das Rot des Raumes für rote Töne unterempfindlich.
Das Licht in San Sisto zu Piacenza, wo das Bild ursprünglich gehangen
hat, war auch nicht ins rote gesteigert, sondern gewöhnliches zerstreutes
Tageslicht, das uns eben »weiß« erscheint und dessen Dämpfung wir
»grau« nennen. Davon, daß die Kirchenwände in Piacenza zu Raffaels
Zeiten rot gestrichen gewesen wären, ist ganz und gar nichts bekannt.
Im Rundbau der Dresdener Galerie ist bei der Neuordnung eine Art
»Tribuna« eingerichtet worden, ein Raum also, in welchem nach berühmtem
Vorbild eine Reihe der besten Bilder vereinigt wurde. Gewiß hat man
damit den fremden Besuchern ein Zugeständnis machen wollen, die mit
der Galerie so geschwind als möglich fertig werden müssen, ohne alle
Säle abzusuchen.
Daß verhältnismäßig rasch für die umgeordnete Galerie ein neuer
Katalog hergestellt wurde, ist mit Dankbarkeit anzuerkennen. Aber es läßt
sich nicht leugnen, daß die Kataloge für die frühere Aufstellung, die ja
sicher nicht schlechter war als die neue, viel mehr den wissenschaftlichen
Ansprüchen bildverständiger Besucher entgegengekommen sind, als der
neue Katalog. Die Woermannschen Kataloge, die nun in den örtlichen
Hinweisen antiquiert sind, waren in vieler Beziehung geradewegs muster-
gültig. Übrigens wird ein neuer großer amtlicher Katalog in Aussicht
gestellt.
Gar nicht besonders entzückt war ich auch von der Neuordnung der
Münchener Pinakothek sowie überhaupt von den Ergebnissen der Um-
wälzung des ganzen staatlichen bayerischen Bilderbesitzes. Die Parforce-
jagd auf Bilder in den Provinzgalerien, um mit der Beute die alte Pina-
kothek zu bereichern, hat ja einige gute Bilder nach München gebracht,
doch verschwindet der Nutzen geradewegs neben dem Schaden des Durch-
einander, das sich nach der viel gerühmten Umstellung gezeigt hat. Bei
den wirklich vorzüglichen Bildern in bayerischem Staatsbesitz wußten die
meisten Bilderfreunde und die Gelehrten, wo man sie finden könne. Nun
ist alles durcheinander gerührt, und ich wette, daß die bayerischen Galerie-
beamten selbst hie und da Mühe haben, rasch festzustellen, in welcher
Galerie oder welchem Vorratsraum dieses oder jenes Bild zu suchen ist.
Die Bilder, die in die alte Pinakothek herangezogen wurden, sind aber
nicht einmal alle so enorm bedeutend, daß durch ihren Kunstwert die ein-
greifende Verschiebung gerechtfertigt wäre. Das Stilleben des Jacopo de
Barbari hätte recht wohl können in Augsburg verbleiben. Auch das Bildnis
Sigismund des Münzreichen von Tirol, für das kein Name genannt wird,
obwohl ich längst auf Ludwig Kuenrciter und Martin Enzelsberger hin-
gewiesen habe (in der Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen, Bd. 1,