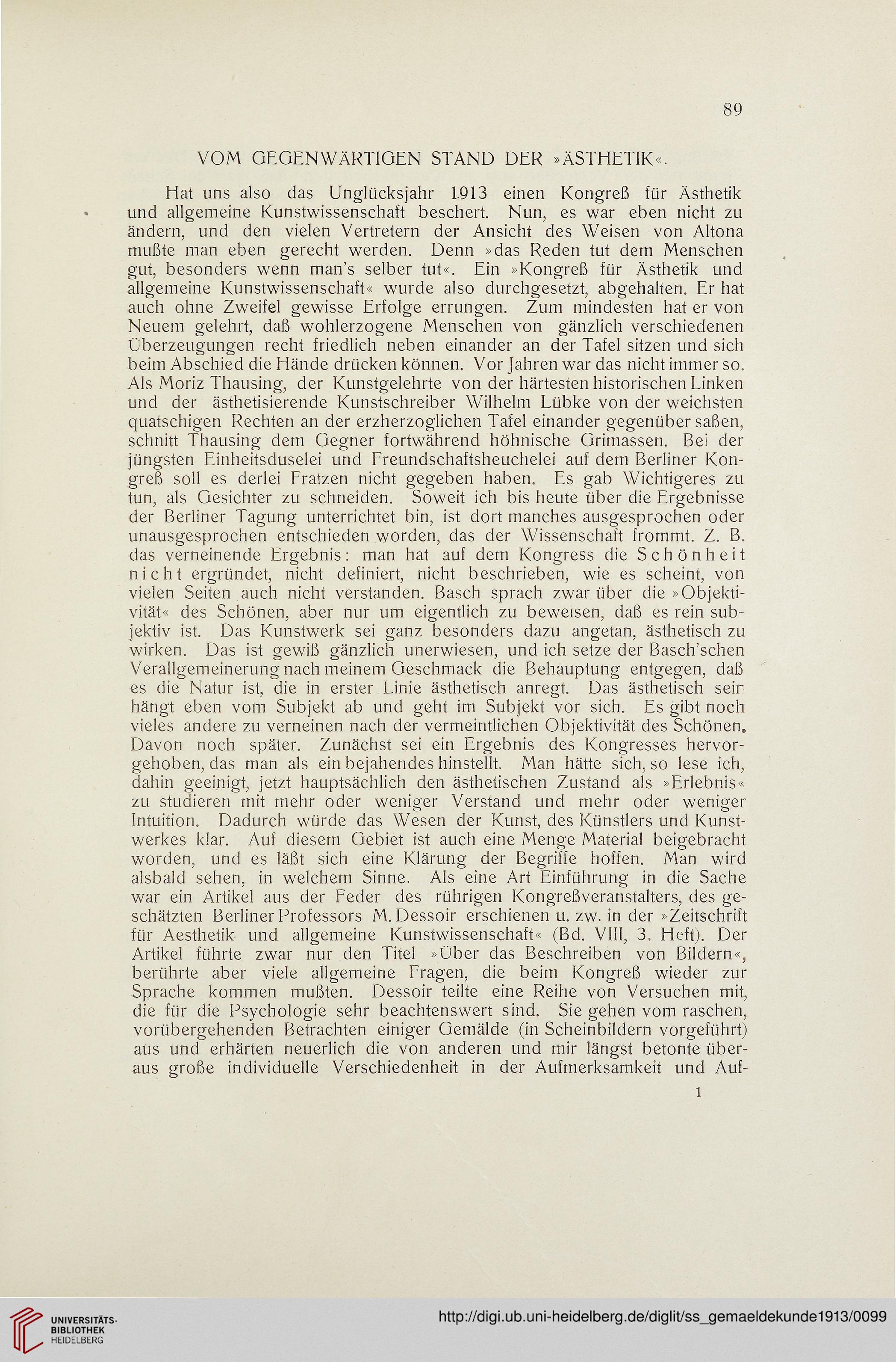89
VOM GEGENWÄRTIGEN STAND DER »ÄSTHETIK«.
Hat uns a!so das Unglücksjahr 1913 einen Kongreß für Ästhetik
und allgemeine Kunstwissenschaft beschert. Nun, es war eben nicht zu
ändern, und den vielen Vertretern der Ansicht des Weisen von Altona
mußte man eben gerecht werden. Denn »das Reden tut dem Menschen
gut, besonders wenn man's selber tut«. Ein »Kongreß für Ästhetik und
allgemeine Kunstwissenschaft« wurde also durchgesetzt, abgehalten. Er hat
auch ohne Zweifel gewisse Erfolge errungen. Zum mindesten hat er von
Neuem gelehrt, daß wohlerzogene Menschen von gänzlich verschiedenen
Überzeugungen recht friedlich neben einander an der Tafel sitzen und sich
beim Abschied die Hände drücken können. Vor Jahren war das nicht immer so.
AlsMorizThausing, der Kunstgelehrte von der härtesten historischen Linken
und der ästhetisierende Kunstschreiber Wilhelm Lübke von der weichsten
quatschigen Rechten an der erzherzoglichen Tafel einander gegenübersaßen,
schnitt Thausing dem Gegner fortwährend höhnische Grimassen. Bei der
jüngsten Einheitsduselei und Ereundschaftsheuchelei auf dem Berliner Kon-
greß soll es derlei Fratzen nicht gegeben haben. Es gab Wichtigeres zu
tun, als Gesichter zu schneiden. Soweit ich bis heute über die Ergebnisse
der Berliner Tagung unterrichtet bin, ist dort manches ausgesprochen oder
unausgesprochen entschieden worden, das der Wissenschaft frommt. Z. B.
das verneinende Ergebnis: man hat auf dem Kongress die Schönheit
nicht ergründet, nicht definiert, nicht beschrieben, wie es scheint, von
vielen Seiten auch nicht verstanden. Basch sprach zwar über die »Objekti-
vität« des Schönen, aber nur um eigentlich zu beweisen, daß es rein sub-
jektiv ist. Das Kunstwerk sei ganz besonders dazu angetan, ästhetisch zu
wirken. Das ist gewiß gänzlich unerwiesen, und ich setze der Basch'schen
Verallgemeinerung nach meinem Geschmack die Behauptung entgegen, daß
es die Natur ist, die in erster Linie ästhetisch anregt. Das ästhetisch seir
hängt eben vom Subjekt ab und geht im Subjekt vor sich. Es gibt noch
vieles andere zu verneinen nach der vermeintlichen Objektivität des Schönen.
Davon noch später. Zunächst sei ein Ergebnis des Kongresses hervor-
gehoben, das man als ein bejahendes hinstellt. Man hätte sich, so lese ich,
dahin geeinigt, jetzt hauptsächlich den ästhetischen Zustand als »Erlebnis«
zu studieren mit mehr oder weniger Verstand und mehr oder weniger
Intuition. Dadurch würde das Wesen der Kunst, des Künstlers und Kunst-
werkes klar. Auf diesem Gebiet ist auch eine Menge Material beigebracht
worden, und es läßt sich eine Klärung der Begriffe hoffen. Man wird
alsbald sehen, in welchem Sinne. Als eine Art Einführung in die Sache
war ein Artikel aus der Leder des rührigen Kongreßveranstalters, des ge-
schätzten Berliner Professors M. Dessoir erschienen u. zw. in der »Zeitschrift
für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft« (Bd. Vlll, 3. Heft). Der
Artikel führte zwar nur den Titel »Über das Beschreiben von Bildern«,
berührte aber viele allgemeine Fragen, die beim Kongreß wieder zur
Sprache kommen mußten. Dessoir teilte eine Reihe von Versuchen mit,
die für die Psychologie sehr beachtenswert sind. Sie gehen vom raschen,
vorübergehenden Betrachten einiger Gemälde (in Scheinbildern vorgeführt)
aus und erhärten neuerlich die von anderen und mir längst betonte über-
aus große individuelle Verschiedenheit in der Aufmerksamkeit und Auf-
l
VOM GEGENWÄRTIGEN STAND DER »ÄSTHETIK«.
Hat uns a!so das Unglücksjahr 1913 einen Kongreß für Ästhetik
und allgemeine Kunstwissenschaft beschert. Nun, es war eben nicht zu
ändern, und den vielen Vertretern der Ansicht des Weisen von Altona
mußte man eben gerecht werden. Denn »das Reden tut dem Menschen
gut, besonders wenn man's selber tut«. Ein »Kongreß für Ästhetik und
allgemeine Kunstwissenschaft« wurde also durchgesetzt, abgehalten. Er hat
auch ohne Zweifel gewisse Erfolge errungen. Zum mindesten hat er von
Neuem gelehrt, daß wohlerzogene Menschen von gänzlich verschiedenen
Überzeugungen recht friedlich neben einander an der Tafel sitzen und sich
beim Abschied die Hände drücken können. Vor Jahren war das nicht immer so.
AlsMorizThausing, der Kunstgelehrte von der härtesten historischen Linken
und der ästhetisierende Kunstschreiber Wilhelm Lübke von der weichsten
quatschigen Rechten an der erzherzoglichen Tafel einander gegenübersaßen,
schnitt Thausing dem Gegner fortwährend höhnische Grimassen. Bei der
jüngsten Einheitsduselei und Ereundschaftsheuchelei auf dem Berliner Kon-
greß soll es derlei Fratzen nicht gegeben haben. Es gab Wichtigeres zu
tun, als Gesichter zu schneiden. Soweit ich bis heute über die Ergebnisse
der Berliner Tagung unterrichtet bin, ist dort manches ausgesprochen oder
unausgesprochen entschieden worden, das der Wissenschaft frommt. Z. B.
das verneinende Ergebnis: man hat auf dem Kongress die Schönheit
nicht ergründet, nicht definiert, nicht beschrieben, wie es scheint, von
vielen Seiten auch nicht verstanden. Basch sprach zwar über die »Objekti-
vität« des Schönen, aber nur um eigentlich zu beweisen, daß es rein sub-
jektiv ist. Das Kunstwerk sei ganz besonders dazu angetan, ästhetisch zu
wirken. Das ist gewiß gänzlich unerwiesen, und ich setze der Basch'schen
Verallgemeinerung nach meinem Geschmack die Behauptung entgegen, daß
es die Natur ist, die in erster Linie ästhetisch anregt. Das ästhetisch seir
hängt eben vom Subjekt ab und geht im Subjekt vor sich. Es gibt noch
vieles andere zu verneinen nach der vermeintlichen Objektivität des Schönen.
Davon noch später. Zunächst sei ein Ergebnis des Kongresses hervor-
gehoben, das man als ein bejahendes hinstellt. Man hätte sich, so lese ich,
dahin geeinigt, jetzt hauptsächlich den ästhetischen Zustand als »Erlebnis«
zu studieren mit mehr oder weniger Verstand und mehr oder weniger
Intuition. Dadurch würde das Wesen der Kunst, des Künstlers und Kunst-
werkes klar. Auf diesem Gebiet ist auch eine Menge Material beigebracht
worden, und es läßt sich eine Klärung der Begriffe hoffen. Man wird
alsbald sehen, in welchem Sinne. Als eine Art Einführung in die Sache
war ein Artikel aus der Leder des rührigen Kongreßveranstalters, des ge-
schätzten Berliner Professors M. Dessoir erschienen u. zw. in der »Zeitschrift
für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft« (Bd. Vlll, 3. Heft). Der
Artikel führte zwar nur den Titel »Über das Beschreiben von Bildern«,
berührte aber viele allgemeine Fragen, die beim Kongreß wieder zur
Sprache kommen mußten. Dessoir teilte eine Reihe von Versuchen mit,
die für die Psychologie sehr beachtenswert sind. Sie gehen vom raschen,
vorübergehenden Betrachten einiger Gemälde (in Scheinbildern vorgeführt)
aus und erhärten neuerlich die von anderen und mir längst betonte über-
aus große individuelle Verschiedenheit in der Aufmerksamkeit und Auf-
l