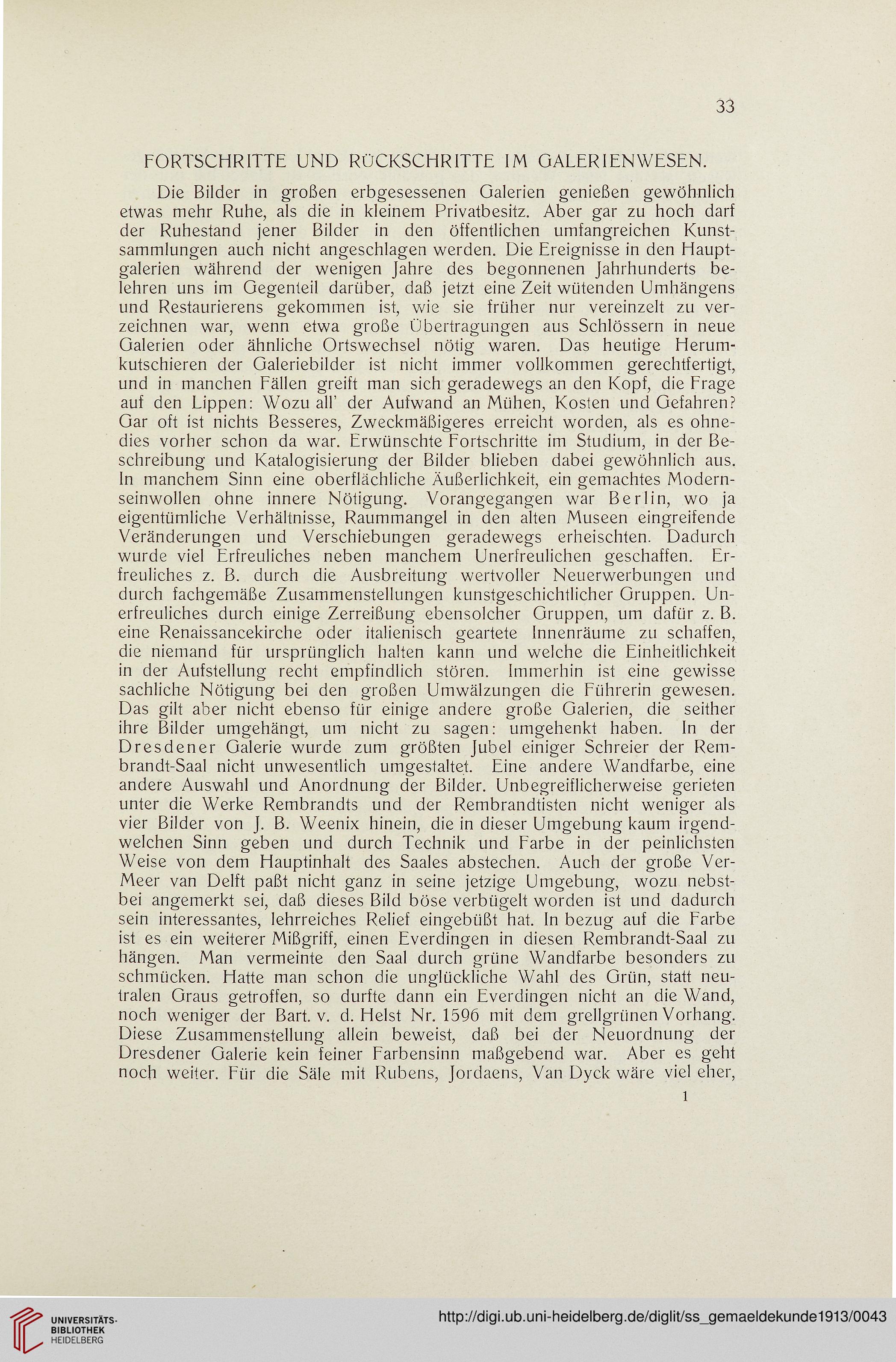33
FORTSCHRITTE UND RÜCKSCHRITTE IM GALERIENWESEN.
Die Biider in großen erbgesessenen Gaierien genießen gewöhniich
etwas mehr Ruhe, ais die in kieinem Privatbesitz. Aber gar zu hoch darf
der Ruhestand jener Biider in den öffentlichen umfangreichen Kunst-
sammlungen auch nicht angeschlagen werden. Die Ereignisse in den Haupt-
galerien während der wenigen Jahre des begonnenen Jahrhunderts be-
lehren uns im Gegenteil darüber, daß jetzt eine Zeit wütenden Umhängens
und Restaurierens gekommen ist, wie sie früher nur vereinzelt zu ver-
zeichnen war, wenn etwa große Übertragungen aus Schlössern in neue
Galerien oder ähnliche Ortswechsel nötig waren. Das heutige Herum-
kutschieren der Galeriebilder ist nicht immer vollkommen gerechtfertigt,
und in manchen Fällen greift man sich geradewegs an den Kopf, die Frage
auf den Lippen: Wozu all' der Aufwand an Mühen, Kosten und Gefahren?
Gar oft ist nichts Besseres, Zweckmäßigeres erreicht worden, als es ohne-
dies vorher schon da war. Erwünschte Fortschritte im Studium, in der Be-
schreibung und Katalogisierung der Bilder blieben dabei gewöhnlich aus.
ln manchem Sinn eine oberflächliche Äußerlichkeit, ein gemachtes Modern-
seinwollen ohne innere Nötigung. Vorangegangen war Berlin, wo ja
eigentümliche Verhältnisse, Raummangel in den alten Museen eingreifende
Veränderungen und Verschiebungen geradewegs erheischten. Dadurch
wurde viel Erfreuliches neben manchem Unerfreulichen geschaffen. Er-
freuliches z. B. durch die Ausbreitung wertvoller Neuerwerbungen und
durch fachgemäße Zusammenstellungen kunstgeschichtlicher Gruppen. Un-
erfreuliches durch einige Zerreißung ebensolcher Gruppen, um dafür z. B.
eine Renaissancekirche oder italienisch geartete Innenräume zu schaffen,
die niemand für ursprünglich halten kann und welche die Einheitlichkeit
in der Aufstellung recht empfindlich stören. Immerhin ist eine gewisse
sachliche Nötigung bei den großen Umwälzungen die Führerin gewesen.
Das gilt aber nicht ebenso für einige andere große Galerien, die seither
ihre Bilder umgehängt, um nicht zu sagen: umgehenkt haben, ln der
Dresdener Galerie wurde zum größten Jubel einiger Schreier der Rem-
brandt-Saal nicht unwesentlich umgestaltet. Eine andere Wandfarbe, eine
andere Auswahl und Anordnung der Bilder. Unbegreiflicherweise gerieten
unter die Werke Rembrandts und der Rembrandtisten nicht weniger als
vier Bilder von J. B. Weenix hinein, die in dieser Umgebung kaum irgend-
welchen Sinn geben und durch Technik und Farbe in der peinlichsten
Weise von dem Hauptinhalt des Saales abstechen. Auch der große Ver-
Meer van Delft paßt nicht ganz in seine jetzige Umgebung, wozu nebst-
bei angemerkt sei, daß dieses Bild böse verbügelt worden ist und dadurch
sein interessantes, lehrreiches Relief eingebüßt hat. ln bezug auf die Farbe
ist es ein weiterer Mißgriff, einen Everdingen in diesen Rembrandt-Saal zu
hängen. Man vermeinte den Saal durch grüne Wandfarbe besonders zu
schmücken. Hatte man schon die unglückliche Wahl des Grün, statt neu-
tralen Graus getroffen, so durfte dann ein Everdingen nicht an die Wand,
noch weniger der Bart. v. d. Heist Nr. 1596 mit dem grellgrünen Vorhang.
Diese Zusammenstellung allein beweist, daß bei der Neuordnung der
Dresdener Galerie kein feiner Farbensinn maßgebend war. Aber es geht
noch weiter. Für die Säle mit Rubens, Jordaens, Van Dyck wäre viel eher,
l
FORTSCHRITTE UND RÜCKSCHRITTE IM GALERIENWESEN.
Die Biider in großen erbgesessenen Gaierien genießen gewöhniich
etwas mehr Ruhe, ais die in kieinem Privatbesitz. Aber gar zu hoch darf
der Ruhestand jener Biider in den öffentlichen umfangreichen Kunst-
sammlungen auch nicht angeschlagen werden. Die Ereignisse in den Haupt-
galerien während der wenigen Jahre des begonnenen Jahrhunderts be-
lehren uns im Gegenteil darüber, daß jetzt eine Zeit wütenden Umhängens
und Restaurierens gekommen ist, wie sie früher nur vereinzelt zu ver-
zeichnen war, wenn etwa große Übertragungen aus Schlössern in neue
Galerien oder ähnliche Ortswechsel nötig waren. Das heutige Herum-
kutschieren der Galeriebilder ist nicht immer vollkommen gerechtfertigt,
und in manchen Fällen greift man sich geradewegs an den Kopf, die Frage
auf den Lippen: Wozu all' der Aufwand an Mühen, Kosten und Gefahren?
Gar oft ist nichts Besseres, Zweckmäßigeres erreicht worden, als es ohne-
dies vorher schon da war. Erwünschte Fortschritte im Studium, in der Be-
schreibung und Katalogisierung der Bilder blieben dabei gewöhnlich aus.
ln manchem Sinn eine oberflächliche Äußerlichkeit, ein gemachtes Modern-
seinwollen ohne innere Nötigung. Vorangegangen war Berlin, wo ja
eigentümliche Verhältnisse, Raummangel in den alten Museen eingreifende
Veränderungen und Verschiebungen geradewegs erheischten. Dadurch
wurde viel Erfreuliches neben manchem Unerfreulichen geschaffen. Er-
freuliches z. B. durch die Ausbreitung wertvoller Neuerwerbungen und
durch fachgemäße Zusammenstellungen kunstgeschichtlicher Gruppen. Un-
erfreuliches durch einige Zerreißung ebensolcher Gruppen, um dafür z. B.
eine Renaissancekirche oder italienisch geartete Innenräume zu schaffen,
die niemand für ursprünglich halten kann und welche die Einheitlichkeit
in der Aufstellung recht empfindlich stören. Immerhin ist eine gewisse
sachliche Nötigung bei den großen Umwälzungen die Führerin gewesen.
Das gilt aber nicht ebenso für einige andere große Galerien, die seither
ihre Bilder umgehängt, um nicht zu sagen: umgehenkt haben, ln der
Dresdener Galerie wurde zum größten Jubel einiger Schreier der Rem-
brandt-Saal nicht unwesentlich umgestaltet. Eine andere Wandfarbe, eine
andere Auswahl und Anordnung der Bilder. Unbegreiflicherweise gerieten
unter die Werke Rembrandts und der Rembrandtisten nicht weniger als
vier Bilder von J. B. Weenix hinein, die in dieser Umgebung kaum irgend-
welchen Sinn geben und durch Technik und Farbe in der peinlichsten
Weise von dem Hauptinhalt des Saales abstechen. Auch der große Ver-
Meer van Delft paßt nicht ganz in seine jetzige Umgebung, wozu nebst-
bei angemerkt sei, daß dieses Bild böse verbügelt worden ist und dadurch
sein interessantes, lehrreiches Relief eingebüßt hat. ln bezug auf die Farbe
ist es ein weiterer Mißgriff, einen Everdingen in diesen Rembrandt-Saal zu
hängen. Man vermeinte den Saal durch grüne Wandfarbe besonders zu
schmücken. Hatte man schon die unglückliche Wahl des Grün, statt neu-
tralen Graus getroffen, so durfte dann ein Everdingen nicht an die Wand,
noch weniger der Bart. v. d. Heist Nr. 1596 mit dem grellgrünen Vorhang.
Diese Zusammenstellung allein beweist, daß bei der Neuordnung der
Dresdener Galerie kein feiner Farbensinn maßgebend war. Aber es geht
noch weiter. Für die Säle mit Rubens, Jordaens, Van Dyck wäre viel eher,
l