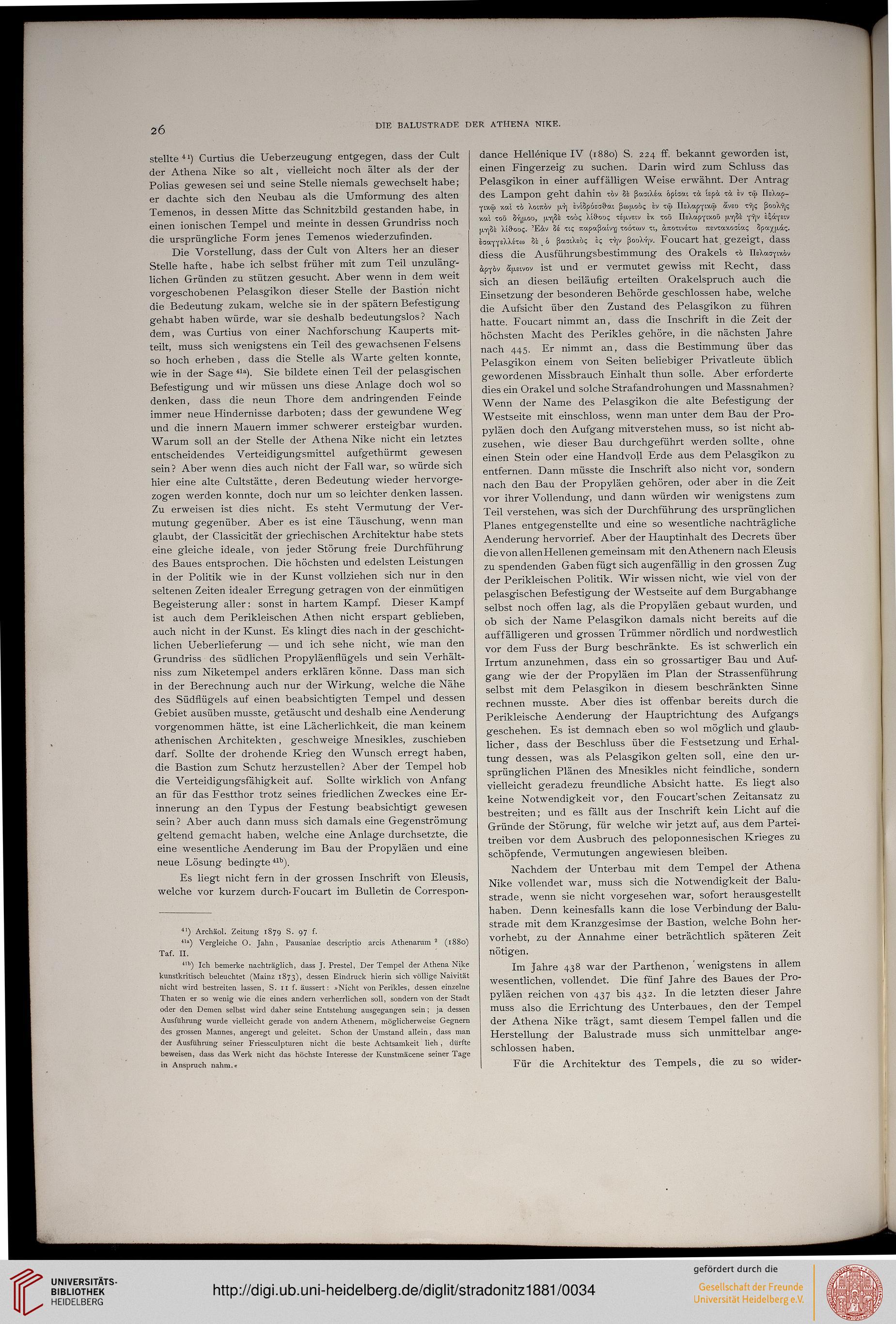26
DIE BALUSTRADE DER ATHENA NIKE.
stellte4,1) Curtius die Ueberzeugung entgegen, dass der Cult
der Athena Nike so alt, vielleicht noch älter als der der
Polias gewesen sei und seine Stelle niemals gewechselt habe;
er dachte sich den Neubau als die Umformung des alten
Temenos, in dessen Mitte das Schnitzbild gestanden habe, in
einen ionischen Tempel und meinte in dessen Grundriss noch
die ursprüngliche Form jenes Temenos wiederzufinden.
Die "Vorstellung, dass der Cult von Alters her an dieser
Stelle hafte, habe ich selbst früher mit zum Teil unzuläng-
lichen Gründen zu stützen gesucht. Aber wenn in dem weit
vorgeschobenen Pelasgikon dieser Stelle der Bastion nicht
die Bedeutung zukam, welche sie in der spätem Befestigung
gehabt haben würde, war sie deshalb bedeutungslos? Nach
dem, was Curtius von einer Nachforschung Kauperts mit-
teilt, muss sich wenigstens ein Teil des gewachsenen Felsens
so hoch erheben , dass die Stelle als Warte gelten konnte,
wie in der Sage iU). Sie bildete einen Teil der pelasgischen
Befestigung und wir müssen uns diese Anlage doch wol so
denken, dass die neun Thore dem andringenden Feinde
immer neue Hindernisse darboten; dass der gewundene Weg
und die innern Mauern immer schwerer ersteigbar wurden.
Warum soll an der Stelle der Athena Nike nicht ein letztes
entscheidendes Verteidigungsmittel aufgethürmt gewesen
sein? Aber wenn dies auch nicht der Fall war, so würde sich
hier eine alte Cultstätte, deren Bedeutung wieder hervorge-
zogen werden konnte, doch nur um so leichter denken lassen.
Zu erweisen ist dies nicht. Es steht Vermutung der Ver-
mutung gegenüber. Aber es ist eine Täuschung, wenn man
glaubt, der Classicität der griechischen Architektur habe stets
eine gleiche ideale, von jeder Störung freie Durchführung
des Baues entsprochen. Die höchsten und edelsten Leistungen
in der Politik wie in der Kunst vollziehen sich nur in den
seltenen Zeiten idealer Erregung getragen von der einmütigen
Begeisterung aller: sonst in hartem Kampf. Dieser Kampf
ist auch dem Perikleischen Athen nicht erspart geblieben,
auch nicht in der Kunst. Es klingt dies nach in der geschicht-
lichen Ueberlieferung — und ich sehe nicht, wie man den
Grundriss des südlichen Propyläenflügels und sein Verhält-
niss zum Niketempel anders erklären könne. Dass man sich
in der Berechnung auch nur der Wirkung, welche die Nähe
des Südflügels auf einen beabsichtigten Tempel und dessen
Gebiet ausüben musste, getäuscht und deshalb eine Aenderung
vorgenommen hätte, ist eine Lächerlichkeit, die man keinem
athenischen Architekten, geschweige Mnesikles, zuschieben
darf. Sollte der drohende Krieg den Wunsch erregt haben,
die Bastion zum Schutz herzustellen? Aber der Tempel hob
die Verteidigungsfähigkeit auf. Sollte wirklich von Anfang
an für das Festthor trotz seines friedlichen Zweckes eine Er-
innerung an den Typus der Festung beabsichtigt gewesen
sein? Aber auch dann muss sich damals eine Gegenströmung
geltend gemacht haben, welche eine Anlage durchsetzte, die
eine wesentliche Aenderung im Bau der Propyläen und eine
neue Lösung bedingte416).
Es liegt nicht fern in der grossen Inschrift von Eleusis,
welche vor kurzem durch-Foucart im Bulletin de Correspon-
41) Archäol. Zeltung 1879 S. 97 f.
41a) Vergleiche 0. Jahn, Pausaniae descriptio arcis Athenamm 2 (1880)
Taf. II.
4lb) Ich bemerke nachträglich, dass J. Prestel, Der Tempel der Athena Nike
kunstkritisch beleuchtet (Mainz 1873), dessen Eindruck hierin sich völlige Naivität
nicht wird bestreiten lassen, S. n f. äussert: »Nicht von Perikles, dessen einzelne
Thaten er so wenig wie die eines andern verherrlichen soll, sondern von der Stadt
oder den Demen selbst wird daher seine Entstehung ausgegangen sein; ja dessen
Ausfuhrung wurde vielleicht gerade von andern Athenern, möglicherweise Gegnern
des grossen Mannes, angeregt und geleitet. Schon der Umstand allein, dass man
der Ausführung seiner Friessculpturen nicht die beste Achtsamkeit lieh, dürfte
beweisen, dass das Werk nicht das höchste Interesse der Kunstmäcene seiner Tage
in Anspruch nahm.«
dance Hellenique IV (1880) S. 224 ff. bekannt geworden ist,
einen Fingerzeig zu suchen. Darin wird zum Schluss das
Pelasgikon in einer auffälligen Weise erwähnt. Der Antrag
des Lampon geht dahin töv hi ßastXea öpiacu rä kpb. zli. iv T<j> IleXap-
yreü) v.al tö Xowjöv (J.-f) evlSpüsa&ou ßu>jj.ot>s e.v xq> IIsXapYra<{) avsu xy)? ßoo\Y|<;
y.al zoo §yju.oü, jxtjSs zobq Xiirouc; t£u.v£tv Iv. toö ITeXapYtv.oö ]Xf\hb *f^v H&fstv
u,Y|Ö£ Xitroo?. 5Eav Se ti? Tiapaßaiv-fl tootwv f., äiroxtvexui rceycaxoaia? Spa^u-ac,.
JoaffeXXsTa) Zk._b ßaaiXeu? eg xty ßooX-fyv. Foucart hat gezeigt, dass
diess die Ausführungsbestimmung des Orakels tö IleXaofixov
äpföv au-scvov ist und er vermutet gewiss mit Recht, dass
sich an diesen beiläufig erteilten Orakelspruch auch die
Einsetzung der besonderen Behörde geschlossen habe, welche
die Aufsicht über den Zustand des Pelasgikon zu führen
hatte. Foucart nimmt an, dass die Inschrift in die Zeit der
höchsten Macht des Perikles gehöre, in die nächsten Jahre
nach 445. Er nimmt an, dass die Bestimmung über das
Pelasgikon einem von Seiten beliebiger Privatleute üblich
gewordenen Missbrauch Einhalt thun solle. Aber erforderte
dies ein Orakel und solche Strafandrohungen und Massnahmen?
Wenn der Name des Pelasgikon die alte Befestigung der
Westseite mit einschloss, wenn man unter dem Bau der Pro-
pyläen doch den Aufgang mitverstehen muss, so ist nicht ab-
zusehen, wie dieser Bau durchgeführt werden sollte, ohne
einen Stein oder eine Handvoll Erde aus dem Pelasgikon zu
entfernen. Dann müsste die Inschrift also nicht vor, sondern
nach den Bau der Propyläen gehören, oder aber in die Zeit
vor ihrer Vollendung, und dann würden wir wenigstens zum
Teil verstehen, was sich der Durchführung des ursprünglichen
Planes entgegenstellte und eine so wesentliche nachträgliche
Aenderung hervorrief. Aber der Hauptinhalt des Decrets über
die von allen Hellenen gemeinsam mit den Athenern nach Eleusis
zu spendenden Gaben fügt sich augenfällig in den grossen Zug
der Perikleischen Politik. Wir wissen nicht, wie viel von der
pelasgischen Befestigung der Westseite auf dem Burgabhange
selbst noch offen lag, als die Propyläen gebaut wurden, und
ob sich der Name Pelasgikon damals nicht bereits auf die
auffälligeren und grossen Trümmer nördlich und nordwestlich
vor dem Fuss der Burg beschränkte. Es ist schwerlich ein
Irrtum anzunehmen, dass ein so grossartiger Bau und Auf-
gang wie der der Propyläen im Plan der Strassenführung
selbst mit dem Pelasgikon in diesem beschränkten Sinne
rechnen musste. Aber dies ist offenbar bereits durch die
Perikleische Aenderung der Hauptrichtung des Aufgangs
geschehen. Es ist demnach eben so wol möglich und glaub-
licher, dass der Beschluss über die Festsetzung und Erhal-
tung dessen, was als Pelasgikon gelten soll, eine den ur-
sprünglichen Plänen des Mnesikles nicht feindliche, sondern
vielleicht geradezu freundliche Absicht hatte. Es liegt also
keine Notwendigkeit vor, den Foucart'schen Zeitansatz zu
bestreiten; und es fällt aus der Inschrift kein Licht auf die
Gründe der Störung, für welche wir jetzt auf, aus dem Partei-
treiben vor dem Ausbruch des peloponnesischen Krieges zu
schöpfende, Vermutungen angewiesen bleiben.
Nachdem der Unterbau mit dem Tempel der Athena
Nike vollendet war, muss sich die Notwendigkeit der Balu-
strade, wenn sie nicht vorgesehen war, sofort herausgestellt
haben. Denn keinesfalls kann die lose Verbindung der Balu-
strade mit dem Kranzgesimse der Bastion, welche Bohn her-
vorhebt, zu der Annahme einer beträchtlich späteren Zeit
nötigen.
Im Jahre 438 war der Parthenon, 'wenigstens in allem
wesentlichen, vollendet. Die fünf Jahre des Baues der Pro-
pyläen reichen von 437 bis 432. In die letzten dieser Jahre
muss also die Errichtung des Unterbaues, den der Tempel
der Athena Nike trägt, samt diesem Tempel fallen und die
Herstellung der Balustrade muss sich unmittelbar ange-
schlossen haben.
Für die Architektur des Tempels, die zu so wider-
DIE BALUSTRADE DER ATHENA NIKE.
stellte4,1) Curtius die Ueberzeugung entgegen, dass der Cult
der Athena Nike so alt, vielleicht noch älter als der der
Polias gewesen sei und seine Stelle niemals gewechselt habe;
er dachte sich den Neubau als die Umformung des alten
Temenos, in dessen Mitte das Schnitzbild gestanden habe, in
einen ionischen Tempel und meinte in dessen Grundriss noch
die ursprüngliche Form jenes Temenos wiederzufinden.
Die "Vorstellung, dass der Cult von Alters her an dieser
Stelle hafte, habe ich selbst früher mit zum Teil unzuläng-
lichen Gründen zu stützen gesucht. Aber wenn in dem weit
vorgeschobenen Pelasgikon dieser Stelle der Bastion nicht
die Bedeutung zukam, welche sie in der spätem Befestigung
gehabt haben würde, war sie deshalb bedeutungslos? Nach
dem, was Curtius von einer Nachforschung Kauperts mit-
teilt, muss sich wenigstens ein Teil des gewachsenen Felsens
so hoch erheben , dass die Stelle als Warte gelten konnte,
wie in der Sage iU). Sie bildete einen Teil der pelasgischen
Befestigung und wir müssen uns diese Anlage doch wol so
denken, dass die neun Thore dem andringenden Feinde
immer neue Hindernisse darboten; dass der gewundene Weg
und die innern Mauern immer schwerer ersteigbar wurden.
Warum soll an der Stelle der Athena Nike nicht ein letztes
entscheidendes Verteidigungsmittel aufgethürmt gewesen
sein? Aber wenn dies auch nicht der Fall war, so würde sich
hier eine alte Cultstätte, deren Bedeutung wieder hervorge-
zogen werden konnte, doch nur um so leichter denken lassen.
Zu erweisen ist dies nicht. Es steht Vermutung der Ver-
mutung gegenüber. Aber es ist eine Täuschung, wenn man
glaubt, der Classicität der griechischen Architektur habe stets
eine gleiche ideale, von jeder Störung freie Durchführung
des Baues entsprochen. Die höchsten und edelsten Leistungen
in der Politik wie in der Kunst vollziehen sich nur in den
seltenen Zeiten idealer Erregung getragen von der einmütigen
Begeisterung aller: sonst in hartem Kampf. Dieser Kampf
ist auch dem Perikleischen Athen nicht erspart geblieben,
auch nicht in der Kunst. Es klingt dies nach in der geschicht-
lichen Ueberlieferung — und ich sehe nicht, wie man den
Grundriss des südlichen Propyläenflügels und sein Verhält-
niss zum Niketempel anders erklären könne. Dass man sich
in der Berechnung auch nur der Wirkung, welche die Nähe
des Südflügels auf einen beabsichtigten Tempel und dessen
Gebiet ausüben musste, getäuscht und deshalb eine Aenderung
vorgenommen hätte, ist eine Lächerlichkeit, die man keinem
athenischen Architekten, geschweige Mnesikles, zuschieben
darf. Sollte der drohende Krieg den Wunsch erregt haben,
die Bastion zum Schutz herzustellen? Aber der Tempel hob
die Verteidigungsfähigkeit auf. Sollte wirklich von Anfang
an für das Festthor trotz seines friedlichen Zweckes eine Er-
innerung an den Typus der Festung beabsichtigt gewesen
sein? Aber auch dann muss sich damals eine Gegenströmung
geltend gemacht haben, welche eine Anlage durchsetzte, die
eine wesentliche Aenderung im Bau der Propyläen und eine
neue Lösung bedingte416).
Es liegt nicht fern in der grossen Inschrift von Eleusis,
welche vor kurzem durch-Foucart im Bulletin de Correspon-
41) Archäol. Zeltung 1879 S. 97 f.
41a) Vergleiche 0. Jahn, Pausaniae descriptio arcis Athenamm 2 (1880)
Taf. II.
4lb) Ich bemerke nachträglich, dass J. Prestel, Der Tempel der Athena Nike
kunstkritisch beleuchtet (Mainz 1873), dessen Eindruck hierin sich völlige Naivität
nicht wird bestreiten lassen, S. n f. äussert: »Nicht von Perikles, dessen einzelne
Thaten er so wenig wie die eines andern verherrlichen soll, sondern von der Stadt
oder den Demen selbst wird daher seine Entstehung ausgegangen sein; ja dessen
Ausfuhrung wurde vielleicht gerade von andern Athenern, möglicherweise Gegnern
des grossen Mannes, angeregt und geleitet. Schon der Umstand allein, dass man
der Ausführung seiner Friessculpturen nicht die beste Achtsamkeit lieh, dürfte
beweisen, dass das Werk nicht das höchste Interesse der Kunstmäcene seiner Tage
in Anspruch nahm.«
dance Hellenique IV (1880) S. 224 ff. bekannt geworden ist,
einen Fingerzeig zu suchen. Darin wird zum Schluss das
Pelasgikon in einer auffälligen Weise erwähnt. Der Antrag
des Lampon geht dahin töv hi ßastXea öpiacu rä kpb. zli. iv T<j> IleXap-
yreü) v.al tö Xowjöv (J.-f) evlSpüsa&ou ßu>jj.ot>s e.v xq> IIsXapYra<{) avsu xy)? ßoo\Y|<;
y.al zoo §yju.oü, jxtjSs zobq Xiirouc; t£u.v£tv Iv. toö ITeXapYtv.oö ]Xf\hb *f^v H&fstv
u,Y|Ö£ Xitroo?. 5Eav Se ti? Tiapaßaiv-fl tootwv f., äiroxtvexui rceycaxoaia? Spa^u-ac,.
JoaffeXXsTa) Zk._b ßaaiXeu? eg xty ßooX-fyv. Foucart hat gezeigt, dass
diess die Ausführungsbestimmung des Orakels tö IleXaofixov
äpföv au-scvov ist und er vermutet gewiss mit Recht, dass
sich an diesen beiläufig erteilten Orakelspruch auch die
Einsetzung der besonderen Behörde geschlossen habe, welche
die Aufsicht über den Zustand des Pelasgikon zu führen
hatte. Foucart nimmt an, dass die Inschrift in die Zeit der
höchsten Macht des Perikles gehöre, in die nächsten Jahre
nach 445. Er nimmt an, dass die Bestimmung über das
Pelasgikon einem von Seiten beliebiger Privatleute üblich
gewordenen Missbrauch Einhalt thun solle. Aber erforderte
dies ein Orakel und solche Strafandrohungen und Massnahmen?
Wenn der Name des Pelasgikon die alte Befestigung der
Westseite mit einschloss, wenn man unter dem Bau der Pro-
pyläen doch den Aufgang mitverstehen muss, so ist nicht ab-
zusehen, wie dieser Bau durchgeführt werden sollte, ohne
einen Stein oder eine Handvoll Erde aus dem Pelasgikon zu
entfernen. Dann müsste die Inschrift also nicht vor, sondern
nach den Bau der Propyläen gehören, oder aber in die Zeit
vor ihrer Vollendung, und dann würden wir wenigstens zum
Teil verstehen, was sich der Durchführung des ursprünglichen
Planes entgegenstellte und eine so wesentliche nachträgliche
Aenderung hervorrief. Aber der Hauptinhalt des Decrets über
die von allen Hellenen gemeinsam mit den Athenern nach Eleusis
zu spendenden Gaben fügt sich augenfällig in den grossen Zug
der Perikleischen Politik. Wir wissen nicht, wie viel von der
pelasgischen Befestigung der Westseite auf dem Burgabhange
selbst noch offen lag, als die Propyläen gebaut wurden, und
ob sich der Name Pelasgikon damals nicht bereits auf die
auffälligeren und grossen Trümmer nördlich und nordwestlich
vor dem Fuss der Burg beschränkte. Es ist schwerlich ein
Irrtum anzunehmen, dass ein so grossartiger Bau und Auf-
gang wie der der Propyläen im Plan der Strassenführung
selbst mit dem Pelasgikon in diesem beschränkten Sinne
rechnen musste. Aber dies ist offenbar bereits durch die
Perikleische Aenderung der Hauptrichtung des Aufgangs
geschehen. Es ist demnach eben so wol möglich und glaub-
licher, dass der Beschluss über die Festsetzung und Erhal-
tung dessen, was als Pelasgikon gelten soll, eine den ur-
sprünglichen Plänen des Mnesikles nicht feindliche, sondern
vielleicht geradezu freundliche Absicht hatte. Es liegt also
keine Notwendigkeit vor, den Foucart'schen Zeitansatz zu
bestreiten; und es fällt aus der Inschrift kein Licht auf die
Gründe der Störung, für welche wir jetzt auf, aus dem Partei-
treiben vor dem Ausbruch des peloponnesischen Krieges zu
schöpfende, Vermutungen angewiesen bleiben.
Nachdem der Unterbau mit dem Tempel der Athena
Nike vollendet war, muss sich die Notwendigkeit der Balu-
strade, wenn sie nicht vorgesehen war, sofort herausgestellt
haben. Denn keinesfalls kann die lose Verbindung der Balu-
strade mit dem Kranzgesimse der Bastion, welche Bohn her-
vorhebt, zu der Annahme einer beträchtlich späteren Zeit
nötigen.
Im Jahre 438 war der Parthenon, 'wenigstens in allem
wesentlichen, vollendet. Die fünf Jahre des Baues der Pro-
pyläen reichen von 437 bis 432. In die letzten dieser Jahre
muss also die Errichtung des Unterbaues, den der Tempel
der Athena Nike trägt, samt diesem Tempel fallen und die
Herstellung der Balustrade muss sich unmittelbar ange-
schlossen haben.
Für die Architektur des Tempels, die zu so wider-