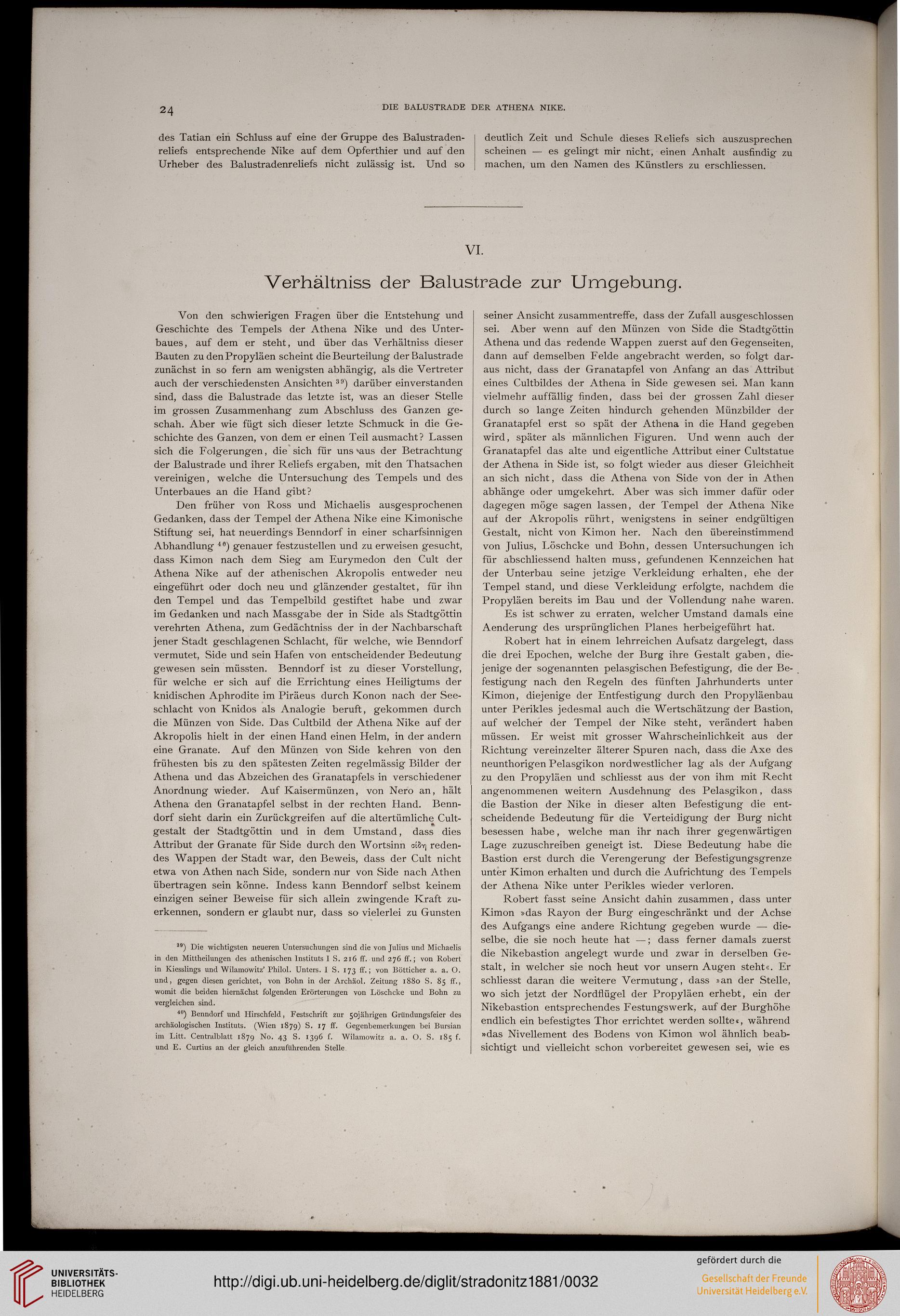24
DIE BALUSTRADE DER ATHENA NIKE.
des Tatian ein Schluss auf eine der Gruppe des Balustraden-
reliefs entsprechende Nike auf dem Opferthier und auf den
Urheber des Balustradenreliefs nicht zulässig ist. Und so
deutlich Zeit und Schule dieses Reliefs sich auszusprechen
scheinen — es gelingt mir nicht, einen Anhalt ausfindig zu
machen, um den Namen des Künstlers zu erschliessen.
VI.
Verhältniss der Balustrade zur Umgebung.
Von den schwierigen Fragen über die Entstehung und
Geschichte des Tempels der Athena Nike und des Unter-
baues, auf dem er steht, und über das Verhältniss dieser
Bauten zu den Propyläen scheint die Beurteilung der Balustrade
zunächst in so fern am wenigsten abhängig, als die Vertreter
auch der verschiedensten Ansichten 33) darüber einverstanden
sind, dass die Balustrade das letzte ist, was an dieser Stelle
im grossen Zusammenhang zum Abschluss des Ganzen ge-
schah. Aber wie fügt sich dieser letzte Schmuck in die Ge-
schichte des Ganzen, von dem er einen Teil ausmacht? Lassen
sich die Folgerungen, die sich für uns *aus der Betrachtung
der Balustrade und ihrer Reliefs ergaben, mit den Thatsachen
vereinigen, welche die Untersuchung des Tempels und des
Unterbaues an die Hand gibt?
Den früher von Ross und Michaelis ausgesprochenen
Gedanken, dass der Tempel der Athena Nike eine Kimonische
Stiftung sei, hat neuerdings Benndorf in einer scharfsinnigen
Abhandlung 4 °) genauer festzustellen und zu erweisen gesucht,
dass Kimon nach dem Sieg am Eurymedon den Cult der
Athena Nike auf der athenischen Akropolis entweder neu
eingeführt oder doch neu und glänzender gestaltet, für ihn
den Tempel und das Tempelbild gestiftet habe und zwar
im Gedanken und nach Massgabe der in Side als Stadtgöttin
verehrten Athena, zum Gedächtniss der in der Nachbarschaft
jener Stadt geschlagenen Schlacht, für welche, wie Benndorf
vermutet, Side und sein Hafen von entscheidender Bedeutung
gewesen sein müssten. Benndorf ist zu dieser Vorstellung,
für welche er sich auf die Errichtung eines Heiligtums der
knidischen Aphrodite im Piräeus durch Konon nach der See-
schlacht von Knidos als Analogie beruft, gekommen durch
die Münzen von Side. Das Cultbild der Athena Nike auf der
Akropolis hielt in der einen Hand einen Helm, in der andern
eine Granate. Auf den Münzen von Side kehren von den
frühesten bis zu den spätesten Zeiten regelmässig Bilder der
Athena und das Abzeichen des Granatapfels in verschiedener
Anordnung wieder. Auf Kaisermünzen, von Nero an, hält
Athena den Granatapfel selbst in der rechten Hand. Benn-
dorf sieht darin ein Zurückgreifen auf die altertümliche Cult-
gestalt der Stadtgöttin und in dem Umstand, dass dies
Attribut der Granate für Side durch den Wortsinn alh-q reden-
des Wappen der Stadt war, den Beweis, dass der Cult nicht
etwa von Athen nach Side, sondern nur von Side nach Athen
übertragen sein könne. Indess kann Benndorf selbst keinem
einzigen seiner Beweise für sich allein zwingende Kraft zu-
erkennen, sondern er glaubt nur, dass so vielerlei zu Gunsten
39) Die wichtigsten neueren Untersuchungen sind die von Julius und Michaelis
in den Mittheilungen des athenischen Instituts 1 S. 216 ff. und 276 ff.; von Robert
in Kiesslings und Wilamöwitz' Philol. Unters. I S. 173 ff.; von Bötticher a. a. O.
und, gegen diesen gerichtet, von Bohn in der Archäol. Zeitung 1880 S. 85 ff.,
womit die beiden hiernächst folgenden Erörterungen von Löschcke und Bohn zu
vergleichen sind.
40) Benndorf und Hirschfeld, Festschrift zur 50jährigen Gründungsfeier des
archäologischen Instituts. (Wien 1879) S. 17 ff. Gegenbemerkungen bei Bursian
im Litt. Centralblatt 1879 No. 43 S. 1396 f. Wilamowitz a. a. O. S. 185 f.
und E. Curtius an der gleich anzuführenden Stelle
seiner Ansicht zusammentreffe, dass der Zufall ausgeschlossen
sei. Aber wenn auf den Münzen von Side die Stadtgöttin
Athena und das redende Wappen zuerst auf den Gegenseiten,
dann auf demselben Felde angebracht werden, so folgt dar-
aus nicht, dass der Granatapfel von Anfang an das Attribut
eines Cultbildes der Athena in Side gewesen sei. Man kann
vielmehr auffällig finden, dass bei der grossen Zahl dieser
durch so lange Zeiten hindurch gehenden Münzbilder der
Granatapfel erst so spät der Athena in die Hand gegeben
wird, später als männlichen Figuren. Und wenn auch der
Granatapfel das alte und eigentliche Attribut einer Cultstatue
der Athena in Side ist, so folgt wieder aus dieser Gleichheit
an sich nicht, dass die Athena von Side von der in Athen
abhänge oder umgekehrt. Aber was sich immer dafür oder
dagegen möge sagen lassen, der Tempel der Athena Nike
auf der Akropolis rührt, wenigstens in seiner endgültigen
Gestalt, nicht von Kimon her. Nach den übereinstimmend
von Julius, Löschcke und Bohn, dessen Untersuchungen ich
für abschliessend halten muss, gefundenen Kennzeichen hat
der Unterbau seine jetzige Verkleidung erhalten, ehe der
Tempel stand, und diese Verkleidung erfolgte, nachdem die
Propyläen bereits im Bau und der Vollendung nahe waren.
Es ist schwer zu erraten, welcher Umstand damals eine
Aenderung des ursprünglichen Planes herbeigeführt hat.
Robert hat in einem lehrreichen Aufsatz dargelegt, dass
die drei Epochen, welche der Burg ihre Gestalt gaben, die-
jenige der sogenannten pelasgischen Befestigung, die der Be-
festigung nach den Regeln des fünften Jahrhunderts unter
Kimon, diejenige der Entfestigung durch den Propyläenbau
unter Perikles jedesmal auch die Wertschätzung der Bastion,
auf welcher der Tempel der Nike steht, verändert haben
müssen. Er weist mit grosser Wahrscheinlichkeit aus der
Richtung vereinzelter älterer Spuren nach, dass die Axe des
neunthorigen Pelasgikon nordwestlicher lag als der Aufgang
zu den Propyläen und schliesst aus der von ihm mit Recht
angenommenen weitern Ausdehnung des Pelasgikon, dass
die Bastion der Nike in dieser alten Befestigung die ent-
scheidende Bedeutung für die Verteidigung der Burg nicht
besessen habe, welche man ihr nach ihrer gegenwärtigen
Lage zuzuschreiben geneigt ist. Diese Bedeutung habe die
Bastion erst durch die Verengerung der Befestigungsgrenze
unter Kimon erhalten und durch die Aufrichtung des Tempels
der Athena Nike unter Perikles wieder verloren.
Robert fasst seine Ansicht dahin zusammen, dass unter
Kimon »das Rayon der Burg eingeschränkt und der Achse
des Aufgangs eine andere Richtung gegeben wurde — die-
selbe, die sie noch heute hat —; dass ferner damals zuerst
die Nikebastion angelegt wurde und zwar in derselben Ge-
stalt, in welcher sie noch heut vor unsern Augen steht«. Er
schliesst daran die weitere Vermutung, dass »an der Stelle,
wo sich jetzt der Nordflügel der Propyläen erhebt, ein der
Nikebastion entsprechendes Festungswerk, auf der Burghöhe
endlich ein befestigtes Thor errichtet werden sollte«, während
»das Nivellement des Bodens von Kimon wol ähnlich beab-
sichtigt und vielleicht schon vorbereitet gewesen sei, wie es
DIE BALUSTRADE DER ATHENA NIKE.
des Tatian ein Schluss auf eine der Gruppe des Balustraden-
reliefs entsprechende Nike auf dem Opferthier und auf den
Urheber des Balustradenreliefs nicht zulässig ist. Und so
deutlich Zeit und Schule dieses Reliefs sich auszusprechen
scheinen — es gelingt mir nicht, einen Anhalt ausfindig zu
machen, um den Namen des Künstlers zu erschliessen.
VI.
Verhältniss der Balustrade zur Umgebung.
Von den schwierigen Fragen über die Entstehung und
Geschichte des Tempels der Athena Nike und des Unter-
baues, auf dem er steht, und über das Verhältniss dieser
Bauten zu den Propyläen scheint die Beurteilung der Balustrade
zunächst in so fern am wenigsten abhängig, als die Vertreter
auch der verschiedensten Ansichten 33) darüber einverstanden
sind, dass die Balustrade das letzte ist, was an dieser Stelle
im grossen Zusammenhang zum Abschluss des Ganzen ge-
schah. Aber wie fügt sich dieser letzte Schmuck in die Ge-
schichte des Ganzen, von dem er einen Teil ausmacht? Lassen
sich die Folgerungen, die sich für uns *aus der Betrachtung
der Balustrade und ihrer Reliefs ergaben, mit den Thatsachen
vereinigen, welche die Untersuchung des Tempels und des
Unterbaues an die Hand gibt?
Den früher von Ross und Michaelis ausgesprochenen
Gedanken, dass der Tempel der Athena Nike eine Kimonische
Stiftung sei, hat neuerdings Benndorf in einer scharfsinnigen
Abhandlung 4 °) genauer festzustellen und zu erweisen gesucht,
dass Kimon nach dem Sieg am Eurymedon den Cult der
Athena Nike auf der athenischen Akropolis entweder neu
eingeführt oder doch neu und glänzender gestaltet, für ihn
den Tempel und das Tempelbild gestiftet habe und zwar
im Gedanken und nach Massgabe der in Side als Stadtgöttin
verehrten Athena, zum Gedächtniss der in der Nachbarschaft
jener Stadt geschlagenen Schlacht, für welche, wie Benndorf
vermutet, Side und sein Hafen von entscheidender Bedeutung
gewesen sein müssten. Benndorf ist zu dieser Vorstellung,
für welche er sich auf die Errichtung eines Heiligtums der
knidischen Aphrodite im Piräeus durch Konon nach der See-
schlacht von Knidos als Analogie beruft, gekommen durch
die Münzen von Side. Das Cultbild der Athena Nike auf der
Akropolis hielt in der einen Hand einen Helm, in der andern
eine Granate. Auf den Münzen von Side kehren von den
frühesten bis zu den spätesten Zeiten regelmässig Bilder der
Athena und das Abzeichen des Granatapfels in verschiedener
Anordnung wieder. Auf Kaisermünzen, von Nero an, hält
Athena den Granatapfel selbst in der rechten Hand. Benn-
dorf sieht darin ein Zurückgreifen auf die altertümliche Cult-
gestalt der Stadtgöttin und in dem Umstand, dass dies
Attribut der Granate für Side durch den Wortsinn alh-q reden-
des Wappen der Stadt war, den Beweis, dass der Cult nicht
etwa von Athen nach Side, sondern nur von Side nach Athen
übertragen sein könne. Indess kann Benndorf selbst keinem
einzigen seiner Beweise für sich allein zwingende Kraft zu-
erkennen, sondern er glaubt nur, dass so vielerlei zu Gunsten
39) Die wichtigsten neueren Untersuchungen sind die von Julius und Michaelis
in den Mittheilungen des athenischen Instituts 1 S. 216 ff. und 276 ff.; von Robert
in Kiesslings und Wilamöwitz' Philol. Unters. I S. 173 ff.; von Bötticher a. a. O.
und, gegen diesen gerichtet, von Bohn in der Archäol. Zeitung 1880 S. 85 ff.,
womit die beiden hiernächst folgenden Erörterungen von Löschcke und Bohn zu
vergleichen sind.
40) Benndorf und Hirschfeld, Festschrift zur 50jährigen Gründungsfeier des
archäologischen Instituts. (Wien 1879) S. 17 ff. Gegenbemerkungen bei Bursian
im Litt. Centralblatt 1879 No. 43 S. 1396 f. Wilamowitz a. a. O. S. 185 f.
und E. Curtius an der gleich anzuführenden Stelle
seiner Ansicht zusammentreffe, dass der Zufall ausgeschlossen
sei. Aber wenn auf den Münzen von Side die Stadtgöttin
Athena und das redende Wappen zuerst auf den Gegenseiten,
dann auf demselben Felde angebracht werden, so folgt dar-
aus nicht, dass der Granatapfel von Anfang an das Attribut
eines Cultbildes der Athena in Side gewesen sei. Man kann
vielmehr auffällig finden, dass bei der grossen Zahl dieser
durch so lange Zeiten hindurch gehenden Münzbilder der
Granatapfel erst so spät der Athena in die Hand gegeben
wird, später als männlichen Figuren. Und wenn auch der
Granatapfel das alte und eigentliche Attribut einer Cultstatue
der Athena in Side ist, so folgt wieder aus dieser Gleichheit
an sich nicht, dass die Athena von Side von der in Athen
abhänge oder umgekehrt. Aber was sich immer dafür oder
dagegen möge sagen lassen, der Tempel der Athena Nike
auf der Akropolis rührt, wenigstens in seiner endgültigen
Gestalt, nicht von Kimon her. Nach den übereinstimmend
von Julius, Löschcke und Bohn, dessen Untersuchungen ich
für abschliessend halten muss, gefundenen Kennzeichen hat
der Unterbau seine jetzige Verkleidung erhalten, ehe der
Tempel stand, und diese Verkleidung erfolgte, nachdem die
Propyläen bereits im Bau und der Vollendung nahe waren.
Es ist schwer zu erraten, welcher Umstand damals eine
Aenderung des ursprünglichen Planes herbeigeführt hat.
Robert hat in einem lehrreichen Aufsatz dargelegt, dass
die drei Epochen, welche der Burg ihre Gestalt gaben, die-
jenige der sogenannten pelasgischen Befestigung, die der Be-
festigung nach den Regeln des fünften Jahrhunderts unter
Kimon, diejenige der Entfestigung durch den Propyläenbau
unter Perikles jedesmal auch die Wertschätzung der Bastion,
auf welcher der Tempel der Nike steht, verändert haben
müssen. Er weist mit grosser Wahrscheinlichkeit aus der
Richtung vereinzelter älterer Spuren nach, dass die Axe des
neunthorigen Pelasgikon nordwestlicher lag als der Aufgang
zu den Propyläen und schliesst aus der von ihm mit Recht
angenommenen weitern Ausdehnung des Pelasgikon, dass
die Bastion der Nike in dieser alten Befestigung die ent-
scheidende Bedeutung für die Verteidigung der Burg nicht
besessen habe, welche man ihr nach ihrer gegenwärtigen
Lage zuzuschreiben geneigt ist. Diese Bedeutung habe die
Bastion erst durch die Verengerung der Befestigungsgrenze
unter Kimon erhalten und durch die Aufrichtung des Tempels
der Athena Nike unter Perikles wieder verloren.
Robert fasst seine Ansicht dahin zusammen, dass unter
Kimon »das Rayon der Burg eingeschränkt und der Achse
des Aufgangs eine andere Richtung gegeben wurde — die-
selbe, die sie noch heute hat —; dass ferner damals zuerst
die Nikebastion angelegt wurde und zwar in derselben Ge-
stalt, in welcher sie noch heut vor unsern Augen steht«. Er
schliesst daran die weitere Vermutung, dass »an der Stelle,
wo sich jetzt der Nordflügel der Propyläen erhebt, ein der
Nikebastion entsprechendes Festungswerk, auf der Burghöhe
endlich ein befestigtes Thor errichtet werden sollte«, während
»das Nivellement des Bodens von Kimon wol ähnlich beab-
sichtigt und vielleicht schon vorbereitet gewesen sei, wie es