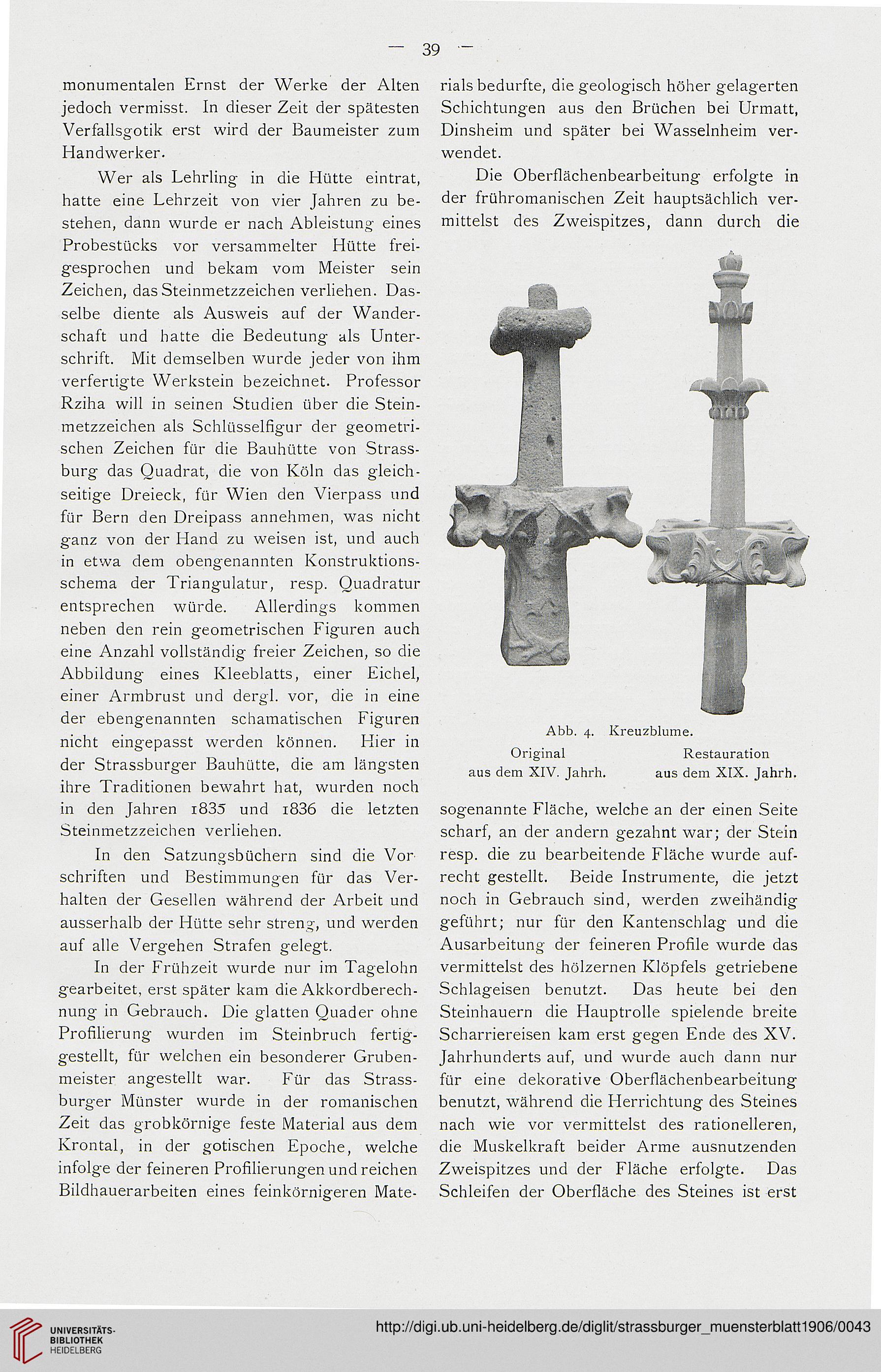39
monumentalen Ernst der Werke der Alten
jedoch vermisst. In dieser Zeit der spätesten
Verfallsgotik erst wird der Baumeister zum
Handwerker.
Wer als Lehrling in die Hütte eintrat,
hatte eine Lehrzeit von vier Jahren zu be-
stehen, dann wurde er nach Ableistung eines
Probestücks vor versammelter Hütte frei-
gesprochen und bekam vom Meister sein
Zeichen, das Steinmetzzeichen verliehen. Das-
selbe diente als Ausweis auf der Wander-
schaft und hatte die Bedeutung als Unter-
schrift. Mit demselben wurde jeder von ihm
verfertigte Werkstein bezeichnet. Professor
Rziha will in seinen Studien über die Stein-
metzzeichen als Schlüsselfigur der geometri-
schen Zeichen für die Bauhütte von Strass-
burg das Quadrat, die von Köln das gleich-
seitige Dreieck, für Wien den Vierpass und
für Bern den Dreipass annehmen, was nicht
ganz von der Hand zu weisen ist, und auch
in etwa dem obengenannten Konstruktions-
schema der Triangulatur, resp. Quadratur
entsprechen würde. Allerdings kommen
neben den rein geometrischen Figuren auch
eine Anzahl vollständig freier Zeichen, so die
Abbildung eines Kleeblatts, einer Eichel,
einer Armbrust und dergl. vor, die in eine
der ebengenannten schamatischen Figuren
nicht eingepasst werden können. Hier in
der Strassburger Bauhütte, die am längsten
ihre Traditionen bewahrt hat, wurden noch
in den Jahren i835 und i836 die letzten
Steinmetzzeichen verliehen.
In den Satzungsbüchern sind die Vor
Schriften und Bestimmungen für das Ver-
halten der Gesellen während der Arbeit und
ausserhalb der Hütte sehr streng, und werden
auf alle Vergehen Strafen gelegt.
In der Frühzeit wurde nur im Tagelohn
gearbeitet, erst später kam die Akkordberech-
nung in Gebrauch. Die glatten Quader ohne
Profilierung wurden im Steinbruch fertig-
gestellt, für welchen ein besonderer Gruben-
meister angestellt war. Für das Strass-
burger Münster wurde in der romanischen
Zeit das grobkörnige feste Material aus dem
Krontal, in der gotischen Epoche, welche
infolge der feineren Profilierungen und reichen
Bildhauerarbeiten eines feinkörnigeren Mate-
rials bedurfte, die geologisch höher gelagerten
Schichtungen aus den Brüchen bei Urmatt,
Dinsheim und später bei Wasselnheim ver-
wendet.
Die Oberflächenbearbeitung erfolgte in
der frühromanischen Zeit hauptsächlich ver-
mittelst des Zweispitzes, dann durch die
Abb. 4. Kreuzblume.
Original Restauration
aus dem XIV. Jahrh. aus dem XIX. Jahrh.
sogenannte Fläche, welche an der einen Seite
scharf, an der andern gezahnt war; der Stein
resp. die zu bearbeitende Fläche wurde auf-
recht gestellt. Beide Instrumente, die jetzt
noch in Gebrauch sind, werden zweihändig
geführt; nur für den Kantenschlag und die
Ausarbeitung der feineren Profile wurde das
vermittelst des hölzernen Klöpfels getriebene
Schlageisen benutzt. Das heute bei den
Steinhauern die Hauptrolle spielende breite
Scharriereisen kam erst gegen Ende des XV.
Jahrhunderts auf, und wurde auch dann nur
für eine dekorative Oberflächenbearbeitung
benutzt, während die Herrichtung des Steines
nach wie vor vermittelst des rationelleren,
die Muskelkraft beider Arme ausnutzenden
Zweispitzes und der Fläche erfolgte. Das
Schleifen der Oberfläche des Steines ist erst
monumentalen Ernst der Werke der Alten
jedoch vermisst. In dieser Zeit der spätesten
Verfallsgotik erst wird der Baumeister zum
Handwerker.
Wer als Lehrling in die Hütte eintrat,
hatte eine Lehrzeit von vier Jahren zu be-
stehen, dann wurde er nach Ableistung eines
Probestücks vor versammelter Hütte frei-
gesprochen und bekam vom Meister sein
Zeichen, das Steinmetzzeichen verliehen. Das-
selbe diente als Ausweis auf der Wander-
schaft und hatte die Bedeutung als Unter-
schrift. Mit demselben wurde jeder von ihm
verfertigte Werkstein bezeichnet. Professor
Rziha will in seinen Studien über die Stein-
metzzeichen als Schlüsselfigur der geometri-
schen Zeichen für die Bauhütte von Strass-
burg das Quadrat, die von Köln das gleich-
seitige Dreieck, für Wien den Vierpass und
für Bern den Dreipass annehmen, was nicht
ganz von der Hand zu weisen ist, und auch
in etwa dem obengenannten Konstruktions-
schema der Triangulatur, resp. Quadratur
entsprechen würde. Allerdings kommen
neben den rein geometrischen Figuren auch
eine Anzahl vollständig freier Zeichen, so die
Abbildung eines Kleeblatts, einer Eichel,
einer Armbrust und dergl. vor, die in eine
der ebengenannten schamatischen Figuren
nicht eingepasst werden können. Hier in
der Strassburger Bauhütte, die am längsten
ihre Traditionen bewahrt hat, wurden noch
in den Jahren i835 und i836 die letzten
Steinmetzzeichen verliehen.
In den Satzungsbüchern sind die Vor
Schriften und Bestimmungen für das Ver-
halten der Gesellen während der Arbeit und
ausserhalb der Hütte sehr streng, und werden
auf alle Vergehen Strafen gelegt.
In der Frühzeit wurde nur im Tagelohn
gearbeitet, erst später kam die Akkordberech-
nung in Gebrauch. Die glatten Quader ohne
Profilierung wurden im Steinbruch fertig-
gestellt, für welchen ein besonderer Gruben-
meister angestellt war. Für das Strass-
burger Münster wurde in der romanischen
Zeit das grobkörnige feste Material aus dem
Krontal, in der gotischen Epoche, welche
infolge der feineren Profilierungen und reichen
Bildhauerarbeiten eines feinkörnigeren Mate-
rials bedurfte, die geologisch höher gelagerten
Schichtungen aus den Brüchen bei Urmatt,
Dinsheim und später bei Wasselnheim ver-
wendet.
Die Oberflächenbearbeitung erfolgte in
der frühromanischen Zeit hauptsächlich ver-
mittelst des Zweispitzes, dann durch die
Abb. 4. Kreuzblume.
Original Restauration
aus dem XIV. Jahrh. aus dem XIX. Jahrh.
sogenannte Fläche, welche an der einen Seite
scharf, an der andern gezahnt war; der Stein
resp. die zu bearbeitende Fläche wurde auf-
recht gestellt. Beide Instrumente, die jetzt
noch in Gebrauch sind, werden zweihändig
geführt; nur für den Kantenschlag und die
Ausarbeitung der feineren Profile wurde das
vermittelst des hölzernen Klöpfels getriebene
Schlageisen benutzt. Das heute bei den
Steinhauern die Hauptrolle spielende breite
Scharriereisen kam erst gegen Ende des XV.
Jahrhunderts auf, und wurde auch dann nur
für eine dekorative Oberflächenbearbeitung
benutzt, während die Herrichtung des Steines
nach wie vor vermittelst des rationelleren,
die Muskelkraft beider Arme ausnutzenden
Zweispitzes und der Fläche erfolgte. Das
Schleifen der Oberfläche des Steines ist erst