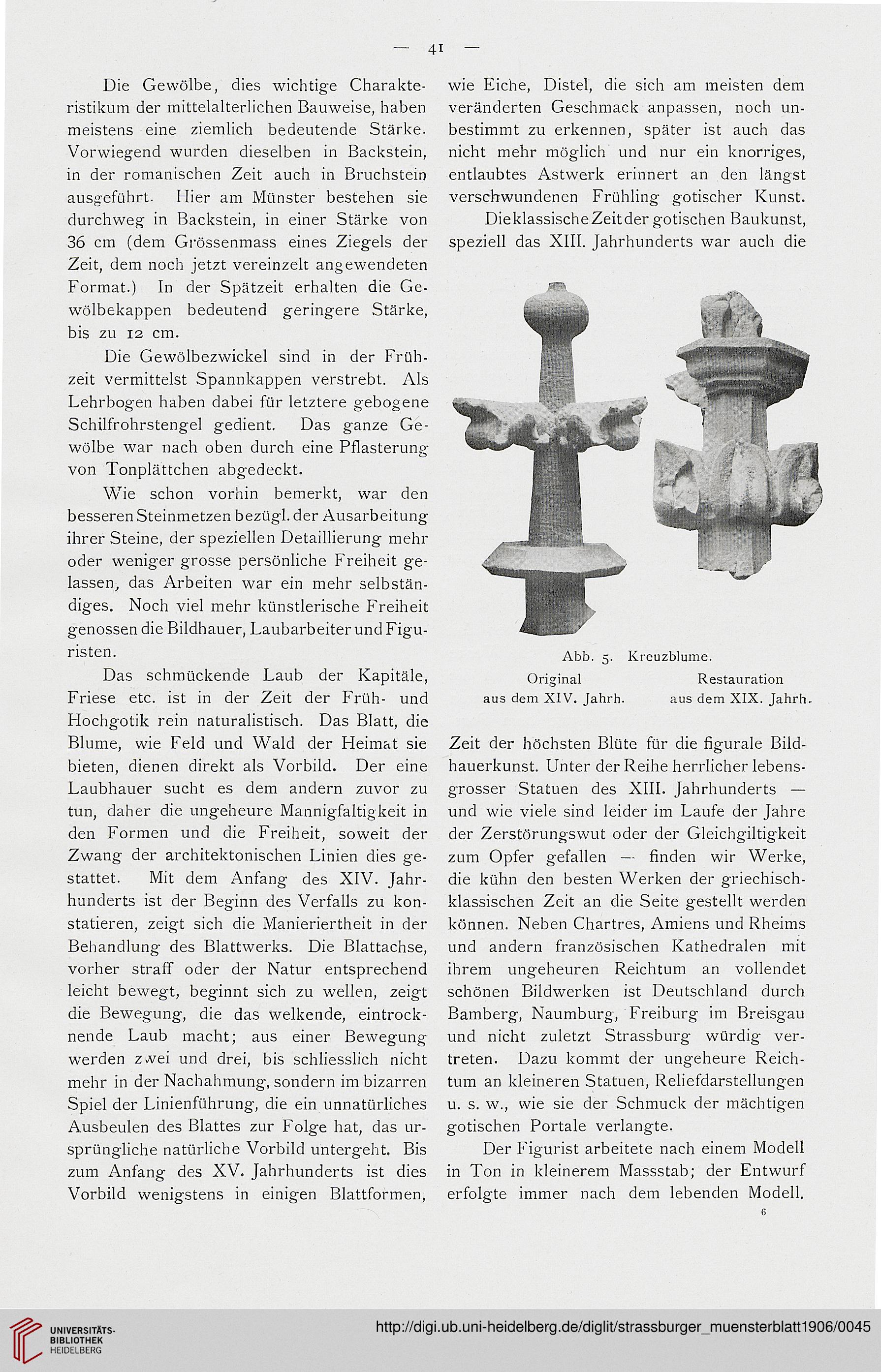4i
Die Gewölbe, dies wichtige Charakte-
ristikum der mittelalterlichen Bauweise, haben
meistens eine ziemlich bedeutende Stärke.
Vorwiegend wurden dieselben in Backstein,
in der romanischen Zeit auch in Bruchstein
ausgeführt. Hier am Münster bestehen sie
durchweg in Backstein, in einer Stärke von
36 cm (dem Grössenmass eines Ziegels der
Zeit, dem noch jetzt vereinzelt angewendeten
Format.) In der Spätzeit erhalten die Ge-
wölbekappen bedeutend geringere Stärke,
bis zu 12 cm.
Die Gewölbezwickel sind in der Früh-
zeit vermittelst Spannkappen verstrebt. Als
Lehrbogen haben dabei für letztere gebogene
Schilfrohrstengel gedient. Das ganze Ge-
wölbe war nach oben durch eine Pflasterung
von Tonplättchen abgedeckt.
Wie schon vorhin bemerkt, war den
besseren Steinmetzen bezügl. der Ausarbeitung
ihrer Steine, der speziellen Detaillierung mehr
oder weniger grosse persönliche Freiheit ge-
lassen , das Arbeiten war ein mehr selbstän-
diges. Noch viel mehr künstlerische Freiheit
genossen die Bildhauer, Laubarbeiter und Figu-
risten.
Das schmückende Laub der Kapitale,
Friese etc. ist in der Zeit der Früh- und
Hochgotik rein naturalistisch. Das Blatt, die
Blume, wie Feld und Wald der Heimat sie
bieten, dienen direkt als Vorbild. Der eine
Laubhauer sucht es dem andern zuvor zu
tun, daher die ungeheure Mannigfaltigkeit in
den Formen und die Freiheit, soweit der
Zwang der architektonischen Linien dies ge-
stattet. Mit dem Anfang des XIV. Jahr-
hunderts ist der Beginn des Verfalls zu kon-
statieren, zeigt sich die Manieriertheit in der
Behandlung des Blattwerks. Die Blattachse,
vorher straff oder der Natur entsprechend
leicht bewegt, beginnt sich zu wellen, zeigt
die Bewegung, die das welkende, eintrock-
nende Laub macht; aus einer Bewegung
werden zwei und drei, bis schliesslich nicht
mehr in der Nachahmung, sondern im bizarren
Spiel der Linienführung, die ein unnatürliches
Ausbeulen des Blattes zur Folge hat, das ur-
sprüngliche natürliche Vorbild untergeht. Bis
zum Anfang des XV. Jahrhunderts ist dies
Vorbild wenigstens in einigen Blattformen,
wie Eiche, Distel, die sich am meisten dem
veränderten Geschmack anpassen, noch un-
bestimmt zu erkennen, später ist auch das
nicht mehr möglich und nur ein knorriges,
entlaubtes Astwerk erinnert an den längst
verschwundenen Frühling gotischer Kunst.
DieklassischeZeitder gotischen Baukunst,
speziell das XIII. Jahrhunderts war auch die
%
Abb. 5. Kreuzblume.
Original Restauration
aus dem XIV. Jahrh. aus dem XIX. Jahrh.
Zeit der höchsten Blüte für die figurale Bild-
hauerkunst. Unter der Reihe herrlicher lebens-
grosser Statuen des XIII. Jahrhunderts —
und wie viele sind leider im Laufe der Jahre
der Zerstörungswut oder der Gleichgiltigkeit
zum Opfer gefallen — finden wir Werke,
die kühn den besten Werken der griechisch-
klassischen Zeit an die Seite gestellt werden
können. Neben Chartres, Amiens und Rheims
und andern französischen Kathedralen mit
ihrem ungeheuren Reichtum an vollendet
schönen Bildwerken ist Deutschland durch
Bamberg, Naumburg, Freiburg im Breisgau
und nicht zuletzt Strassburg würdig ver-
treten. Dazu kommt der ungeheure Reich-
tum an kleineren Statuen, Reliefdarstellungen
u. s. w., wie sie der Schmuck der mächtigen
gotischen Portale verlangte.
Der Figurist arbeitete nach einem Modell
in Ton in kleinerem Massstab; der Entwurf
erfolgte immer nach dem lebenden Modell.
6
Die Gewölbe, dies wichtige Charakte-
ristikum der mittelalterlichen Bauweise, haben
meistens eine ziemlich bedeutende Stärke.
Vorwiegend wurden dieselben in Backstein,
in der romanischen Zeit auch in Bruchstein
ausgeführt. Hier am Münster bestehen sie
durchweg in Backstein, in einer Stärke von
36 cm (dem Grössenmass eines Ziegels der
Zeit, dem noch jetzt vereinzelt angewendeten
Format.) In der Spätzeit erhalten die Ge-
wölbekappen bedeutend geringere Stärke,
bis zu 12 cm.
Die Gewölbezwickel sind in der Früh-
zeit vermittelst Spannkappen verstrebt. Als
Lehrbogen haben dabei für letztere gebogene
Schilfrohrstengel gedient. Das ganze Ge-
wölbe war nach oben durch eine Pflasterung
von Tonplättchen abgedeckt.
Wie schon vorhin bemerkt, war den
besseren Steinmetzen bezügl. der Ausarbeitung
ihrer Steine, der speziellen Detaillierung mehr
oder weniger grosse persönliche Freiheit ge-
lassen , das Arbeiten war ein mehr selbstän-
diges. Noch viel mehr künstlerische Freiheit
genossen die Bildhauer, Laubarbeiter und Figu-
risten.
Das schmückende Laub der Kapitale,
Friese etc. ist in der Zeit der Früh- und
Hochgotik rein naturalistisch. Das Blatt, die
Blume, wie Feld und Wald der Heimat sie
bieten, dienen direkt als Vorbild. Der eine
Laubhauer sucht es dem andern zuvor zu
tun, daher die ungeheure Mannigfaltigkeit in
den Formen und die Freiheit, soweit der
Zwang der architektonischen Linien dies ge-
stattet. Mit dem Anfang des XIV. Jahr-
hunderts ist der Beginn des Verfalls zu kon-
statieren, zeigt sich die Manieriertheit in der
Behandlung des Blattwerks. Die Blattachse,
vorher straff oder der Natur entsprechend
leicht bewegt, beginnt sich zu wellen, zeigt
die Bewegung, die das welkende, eintrock-
nende Laub macht; aus einer Bewegung
werden zwei und drei, bis schliesslich nicht
mehr in der Nachahmung, sondern im bizarren
Spiel der Linienführung, die ein unnatürliches
Ausbeulen des Blattes zur Folge hat, das ur-
sprüngliche natürliche Vorbild untergeht. Bis
zum Anfang des XV. Jahrhunderts ist dies
Vorbild wenigstens in einigen Blattformen,
wie Eiche, Distel, die sich am meisten dem
veränderten Geschmack anpassen, noch un-
bestimmt zu erkennen, später ist auch das
nicht mehr möglich und nur ein knorriges,
entlaubtes Astwerk erinnert an den längst
verschwundenen Frühling gotischer Kunst.
DieklassischeZeitder gotischen Baukunst,
speziell das XIII. Jahrhunderts war auch die
%
Abb. 5. Kreuzblume.
Original Restauration
aus dem XIV. Jahrh. aus dem XIX. Jahrh.
Zeit der höchsten Blüte für die figurale Bild-
hauerkunst. Unter der Reihe herrlicher lebens-
grosser Statuen des XIII. Jahrhunderts —
und wie viele sind leider im Laufe der Jahre
der Zerstörungswut oder der Gleichgiltigkeit
zum Opfer gefallen — finden wir Werke,
die kühn den besten Werken der griechisch-
klassischen Zeit an die Seite gestellt werden
können. Neben Chartres, Amiens und Rheims
und andern französischen Kathedralen mit
ihrem ungeheuren Reichtum an vollendet
schönen Bildwerken ist Deutschland durch
Bamberg, Naumburg, Freiburg im Breisgau
und nicht zuletzt Strassburg würdig ver-
treten. Dazu kommt der ungeheure Reich-
tum an kleineren Statuen, Reliefdarstellungen
u. s. w., wie sie der Schmuck der mächtigen
gotischen Portale verlangte.
Der Figurist arbeitete nach einem Modell
in Ton in kleinerem Massstab; der Entwurf
erfolgte immer nach dem lebenden Modell.
6