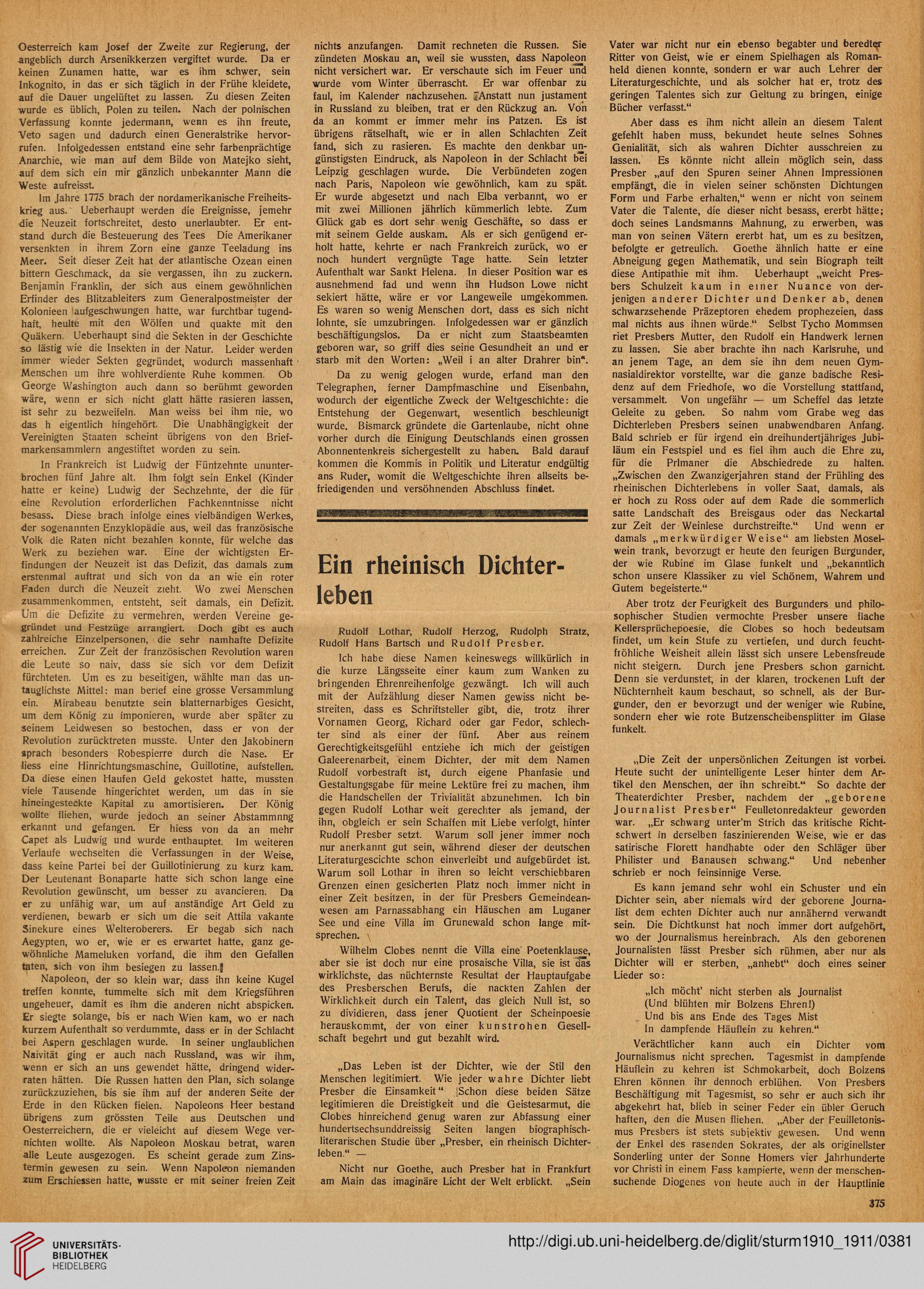Oesterreich kam Josef der Zweite zur Regierung, der
angeblich durch Arsenikkerzen vergiftet wurde. Da er
keinen Zunamen hatte, war es ihm schwer, sein
Inkognito, in das er sich täglich in der Frühe kleidete,
auf die Dauer ungelüftet zu lassen. Zu diesen Zeiten
-wurde es üblich, Polen zu teilen. Nach der polnischen
Verfassung konnte jedermann, wenn es ihn freute,
Veto sagen und dadurch einen Generalstrike hervor-
rufen. Infolgedessen entstand eine sehr farbenprächtige
Anarchie, wie man auf dem Bilde von Matejko sieht,
auf dem sich ein mir gänzlich unbekannter Mann die
Weste aufreisst.
Im Jahre 1775 brach der nordamerikanische Freiheits-
krieg aus. Ueberhaupt werden die Ereignisse, jemehr
die Neuzeit fortschreitet, desto unerlaubter. Er ent-
stand durch die Besteuerung des Tees Die Amerikaner
versenkten in ihrem Zorn eine ganze Teeladung ins
Meer. Seit dieser Zeit hat der atlantische Ozean einen
bittern Geschmack, da sie vergassen, ihn zu zuckern.
Benjamin Franklin, der sich aus einem gewöhnlichen
Erfinder des Blitzableiters zum Generalpostmeister der
Kolonieen 'aufgeschwungen hatte, war furchtbar tugend-
haft, heulte mit den Wölfen und quakte mit den
Quäkern. Ueberhaupt sind die Sekten in der Geschichte
so lästig wie die Insekten in der Natur. Leider werden
immer wieder Sekten gegründet, wodurch massenhaft
Menschen um ihre wohlverdiente Ruhe kommen. Ob
George Washington auch dann so berühmt geworden
wäre, wenn er sich nicht glatt hätte rasieren lassen,
ist sehr zu bezweifeln. Man weiss bei ihm nie, wo
das h eigentlich hingehört. Die Unabhängigkeit der
Vereinigten §taaten scheint übrigens von den Brief-
markensammlern angestiftet worden zu sein.
In Frankreich ist Ludwig der Füntzehnte ununter-
brochen fünf Jahre alt. Ihm folgt sein Enkel (Kinder
hatte er keine) Ludwig der Sechzehnte, der die für
eine Revolution erforderlichen Fachkenntnisse nicht
besass. Diese brach infolge eines vielbändigen Werkes,
der sogenannten Enzyklopädie aus, weil das französische
Volk die Raten nicht bezahlen konnte, für welche das
Werk zu beziehen war. Eine der wichtigsten Er-
findungen der Neuzeit ist das Defizit, das damals zum
erstenmal auftrat und sich von da an wie ein roter
Faden durch die Neuzeit zieht. Wo zwei Menschen
zusammenkommen, entsteht, seit damals, ein Defizit.
Um die Defizite zu vermehren, werden Vereine ge-
gründet und Festzüge arrangiert. Doch gibt es auch
zahlreiche Einzelpersonen, die sehr namhafte Defizite
erreichen. Zur Zeit der französischen Revolution waren
die Leute so naiv, dass sie sich vor dem Defizit
fürchteten. Um es zu beseitigen, wählte man das un-
tauglichste Mittel: man berief eine grosse Versammlung
ein. Mirabeau benutzte sein blatternarbiges Gesicht,
um dem König zu imponieren, wurde aber später zu
seinem Leidwesen so bestochen, dass er von der
Revolution zurücktreten musste. Unter den Jakobinern
sprach besonders Robespierre durch die Nase. Er
liess eine Hinrichtungsmaschine, Guillotine, aufstellen.
Da diese einen Haufen Geld gekostet hatte, mussten
viele Tausende hingerichtet werden, um das in sie
hineingesteckte Kapital zu amortisieren. Der König
wollte fliehen, wurde jedoch an seiner Abstammnng
erkannt und gefangen. Er hiess von da an mehr
Capet als Ludwig und wurde enthauptet. Im weiteren
Verlaufe wechselten die Verfassungen in der Weise,
dass keine Partei bei der Guillotinierung zu kurz kam.
Der Leutenant Bonaparte hatte sich schon lange eine
Revolution gewünscht, um besser zu avancieren. Da
er zu unfähig war, um auf anständige Art Geld zu
verdienen, bewarb er sich um die seit Attila vakante
Sinekure eines Welteroberers. Er begab sich nach
Aegypten, wo er, wie er es erwartet hatte, ganz ge-
wöhnliche Mameluken vorfand, die ihm den Gefallen
taten, sich von ihm besiegen zu lassen.f
Napoleon, der so klein war, dass ihn keine Kugel
treffen konnte, tummelte sich mit dem Kriegsführen
ungeheuer, damit es ihm die anderen nicht abspicken.
Er siegte solange, bis er nach Wien kam, wo er nach
kurzem Aufenthalt so verdummte, dass er in der Schlacht
bei Aspern geschiagen wurde. In seiner unglaublichen
Naivität ging er auch nach Russland, was wir ihm,
wenn er sich an uns gewendet hätte, dringend wider-
raten hätten. Die Russen hatten den Plan, sich solange
zurückzuziehen, bis sie ihm auf der anderen Seite der
Erde in den Rücken fielen. Napoleons Heer bestand
übrigens zum grössten Teile aus Deutschen und
Oesterreichern, die er vieleicht auf diesem Wege ver-
nichten wollte. AIs Napoleon Moskau betrat, waren
alle Leute ausgezogen. Es scheint gerade zum Zins-
termin gewesen zu sein. Wenn Napoleon niemanden
zum Erschiessen hatte, wusste er mit seiner freien Zeit
nichts anzufangen. Damit rechneten die Russen. Sie
zündeten Moskau an, weil sie wussten, dass Napoleon
nicht versichert war. Er verschaute sich im Feuer und
wurde vom Winter überrascht. Er war offenbar zu
faul, im Kalender nachzusehen. JAnstatt nun justament
in Russland zu bleiben, trat er den Rückzug an. Von
da an kommt er immer mehr ins Patzen. Es ist
übrigens rätselhaft, wie er in allen Schlachten Zeit
fand, sich zu rasieren. Es machte den denkbar un-
günstigsten Eindruck, als Napoleon in der Schlacht bei
Leipzig geschlagen wurde. Die Verbündeten zogen
nach Paris, Napoleon wie gewöhnlich, kam zu spät.
Er wurde abgesetzt und nach Elba verbannt, wo er
mit zwei Millionen jährlich kümmerlich lebte. Zum
Glück gab es dort sehr wenig Geschäfte, so dass er
mit seinem Gelde auskam. Als er sich genügend er-
holt hatte, kehrte er nach Frankreich zurück, wo er
noch hundert vergnügte Tage hatte. Sein letzter
Aufenthalt war Sankt Helena. In dieser Position war es
ausnehmend fad und wenn ihn Hudson Lowe nicht
sekiert hätte, wäre er vor Langeweile umgekommen.
Es waren so wenig Menschen dort, dass es sich nicht
lohnte, sie umzubringen. Infolgedessen war er gänzlich
beschäftigungslos. Da er nicht zum Staatsbeamten
geboren war, so griff dies seine Gesundheit an und er
starb mit den Worten: „Weil i an alter Drahrer bin“.
Da zu wenig gelogen wurde, erfand man den
Telegraphen, ferner Dampfmaschine und Eisenbahn,
wodurch der eigentliche Zweck der Weltgeschichte: die
Entstehung der Gegenwart, wesentlich beschleunigt
wurde. Bismarck gründete die Gartenlaube, nicht ohne
vorher durch die Einigung Deutschlands einen grossen
Abonnentenkreis sichergestellt zu haben. Bald darauf
kommen die Kommis in Politik und Literatur endgültig
ans Ruder, womit die Weltgeschichte ihren allseits be-
friedigenden und versöhnenden Abschluss findet.
Ein rheinisch Dichter-
leben
Rudolf Lothar, Rudolf Herzog, Rudolph Stratz,
Rudolf Hans Bartsch und Rudolf Presber.
Ich habe diese Namen keineswegs willkürlich in
die kurze Längsseite einer kaum zum Wanken zu
bringenden Ehrenreihenfolge gezwängt. Ich will auch
mit der Aufzählung dieser Namen gewiss nicht be-
streiten, dass es Schriftstelier gibt, die, trotz ihrer
Vornamen Georg, Richard oder gar Fedor, schlech-
ter sind als einer der fünf. Aber aus reinem
Gerechtigkeitsgefühl entziehe ich mich der geistigen
Galeerenarbeit, einem Dichter, der mit dem Namen
Rudolf vorbestraft ist, durch eigene Phanfasie und
Gestaltungsgabe für meine Lektüre frei zu machen, ihm
die Handschellen der Trivialität abzunehmen. Ich bin
gegen Rudolf Lothar weit gerechter als jemand, der
ihn, obgleich er sein Schaffen mit Liebe verfolgt, hinter
Rudolf Presber setzt. Warum soll jener immer noch
nur anerkannt gut sein, während dieser der deutschen
Literaturgescichte schon einverleibt und aufgebürdet ist.
Warum soll Lothar in ihren so leicht verschiebbaren
Grenzen einen gesicherten Platz noch immer nicht in
einer Zeit besitzen, in der für Presbers Gemeindean-
wesen am Parnassabhang ein Häuschen am Luganer
See und eine Villa im Grunewald schon lange mit-
sprechen.
Wilhelm Clobes nennt die Villa eine Poetenklause,
aber sie ist doch nur eine prosaische Villa, sie ist das
wirklichste, das nüchternste Resultat der Hauptaufgabe
des Presberschen Berufs, die nackten Zahlen der
Wirklichkeit durch ein Talent, das gleich Null ist, so
zu dividieren, dass jener Quotient der Scheinpoesie
herauskommt, der von einer kunstrohen Gesell-
schaft begehrt und gut bezahlt wird.
„Das Leben ist der Dichter, wie der Stil den
Menschen legitimiert. Wie jeder wahre Dichter liebt
Presber die Einsamkeit“ [Schon diese beiden Sätze
legitimieren die Dreistigkeit und die Geistesarmut, die
Clobes hinreichend genug waren zur Abfassung einer
hundertsechsunddreissig Seiten langen biographisch-
literarischen Studie über „Presber, ein rheinisch Dichter-
leben“ —
Nicht nur Goethe, auch Presber hat in Frankfurt
am Main das imaginäre Licht der Welt erblickt. „Sein
Vater war nicht nur ein ebenso begabter und beredtqr
Ritter von Geist, wie er einem Spielhagen als Roman-
held dienen konnte, sondern er war auch Lehrer der
Literaturgeschichte, und als solcher hat er, trotz des
geringen Talentes sich zur Geltung zu bringen, einige
Bücher verfasst.“
Aber dass es ihm nicht allein an diesem Talent
gefehlt haben muss, bekundet heute selnes Sohnes
Genialität, sich als wahren Dichter ausschreien zu
lassen. Es könnte nicht allein möglich sein, dass
Presber „auf den Spuren seiner Ahnen Impressionen
empfängt, die in vielen seiner schönsten Dichtungen
Form und Farbe erhalten,“ wenn er nicht von seinem
Vater die Talente, die dieser nicht besass, ererbt hätte;
doch seines Landsmanns Mahnung, zu erwerben, was
man von seinen Vätern ererbt hat, um es zu besitzen,
befolgte er getreulich. Goethe ähnlich hatte er eine
Abneigung gegen Mathematik, und sein Biograph teilt
diese Antipathie mit ihm. Ueberhaupt „weicht Pres-
bers Schulzeit kaum in einer Nuance von der-
jenigen anderer Dichter und Denker ab, denen
schwarzsehende Präzeptoren ehedem prophezeien, dass
mal nichts aus ihnen würde.“ Selbst Tycho Mommsen
riet Presbers Mutter, den Rudolf ein Handwerk lernen
zu lassen. Sie aber brachte ihn nach Karlsruhe, und
an jenem Tage, an dem sie ihn dem neuen Gym-
nasialdirektor vorstellte, war die ganze badische Resi-
denz auf dem Friedhofe, wo die Vorstellung stattfand,
versammelt. Von ungefähr — um Scheffel das letzte
Geleite zu geben. So nahm vom Grabe weg das
Dichterleben Presbers seinen unabwendbaren Anfang.
Bald schrieb er für irgend ein dreihundertjähriges Jubi-
läum ein Festspiel und es fiel ihm auch die Ehre zu,
für die Prlmaner die Abschiedrede zu halten.
„Zwischen den Zwanzigerjahren stand der Frühling des
rheinischen Dichterlebens in voller Saat, damals, als
er hoch zu Ross oder auf dem Rade die sommerlich
satte Landschaft des Breisgaus oder das Neckartal
zur Zeit der Weinlese durchstreifte.“ Und wenn er
damals „merkwürdiger Weise“ am liebsten Mosel-
wein trank, bevorzugt er heute den feurigen Burgunder,
der wie Rubine im Glase funkelt und „bekanntlich
schon unsere Klassiker zu viel Schönem, Wahrem und
Gutem begeisterte.“
Aber trotz der Feurigkeit des Burgunders und philo-
sophischer Studien vermochte Presber unsere flache
Kellersprüchepoesie, die Clobes so hoch bedeutsam
findet, um kein Stufe zu vertiefen, und durch feucht-
fröhliche Weisheit allein lässt sich unsere Lebensfreude
nicht steigern. Durch jene Presbers schon garnicht
Denn sie verdunstet, in der klaren, trockenen Luft der
Nüchternheit kaum beschaut, so schnell, als der Bur-
gunder, den er bevorzugt und der weniger wie Rubine,
sondern eher wie rote Butzenscheibensplitter im Glase
funkelt.
„Die Zeit der unpersönlichen Zeitungen ist vorbei.
Heute sucht der unintelligente Leser hinter dem Ar-
tikel den Menschen, der ihn schreibt.“ So dachte der
Theaterdichter Presber, nachdem der „geborene
Journalist Presber“ Feulletonredakteur geworden
war. „Er schwarg unter’m Strich das kritische Richt-
schwert in derselben faszinierenden Weise, wie er das
satirische Florett handhabte oder den Schläger über
Philister und Banausen schwang.“ Und nebenher
schrieb er noch feinsinnige Verse.
Es kann jemand sehr wohl ein Schuster und ein
Dichter sein, aber niemals wird der geborene Journa-
list dem echten Dichter auch nur annäherrd verwandt
sein. Die Dichtkunst hat noch immer dort aufgehört,
wo der Journalismus hereinbrach. Als den geborenen
Journalisten Iässt Presber sich rühmen, aber nur als
Dichter will er sterben, „anhebt“ doch eines seiner
Lieder so:
„Ich möcht’ nicht sterben als Journalist
(Und blühten mir Bolzens Ehrenl)
Und bis ans Ende des Tages Mist
In dampfende Häuflein zu kehren.“
Verächtlicher kann auch ein Dichter vom
Journalismus nicht sprechen. Tagesmist in dampfende
Häuflein zu kehren ist Schmokarbeit, doch Bolzens
Ehren können ihr dennoch erblühen. Von Presbers
Beschäftigung mit Tagesmist, so sehr er auch sich ihr
abgekehrt hat, blieb in seiner Feder ein übler Geruch
haften, den die Musen fliehen. „Aber der Feuilletonis-
mus Presbers ist stets subjektiv gewesen. Und wenn
der Enkel des rasenden Sokrates, der als originellster
Sonderling unter der Sonne Homers vier Jahrhunderte
vor Christi in einem Fass kampierte, wenn der menschen-
suchende Diogenes von heute auch in der Hauptlinie
375
angeblich durch Arsenikkerzen vergiftet wurde. Da er
keinen Zunamen hatte, war es ihm schwer, sein
Inkognito, in das er sich täglich in der Frühe kleidete,
auf die Dauer ungelüftet zu lassen. Zu diesen Zeiten
-wurde es üblich, Polen zu teilen. Nach der polnischen
Verfassung konnte jedermann, wenn es ihn freute,
Veto sagen und dadurch einen Generalstrike hervor-
rufen. Infolgedessen entstand eine sehr farbenprächtige
Anarchie, wie man auf dem Bilde von Matejko sieht,
auf dem sich ein mir gänzlich unbekannter Mann die
Weste aufreisst.
Im Jahre 1775 brach der nordamerikanische Freiheits-
krieg aus. Ueberhaupt werden die Ereignisse, jemehr
die Neuzeit fortschreitet, desto unerlaubter. Er ent-
stand durch die Besteuerung des Tees Die Amerikaner
versenkten in ihrem Zorn eine ganze Teeladung ins
Meer. Seit dieser Zeit hat der atlantische Ozean einen
bittern Geschmack, da sie vergassen, ihn zu zuckern.
Benjamin Franklin, der sich aus einem gewöhnlichen
Erfinder des Blitzableiters zum Generalpostmeister der
Kolonieen 'aufgeschwungen hatte, war furchtbar tugend-
haft, heulte mit den Wölfen und quakte mit den
Quäkern. Ueberhaupt sind die Sekten in der Geschichte
so lästig wie die Insekten in der Natur. Leider werden
immer wieder Sekten gegründet, wodurch massenhaft
Menschen um ihre wohlverdiente Ruhe kommen. Ob
George Washington auch dann so berühmt geworden
wäre, wenn er sich nicht glatt hätte rasieren lassen,
ist sehr zu bezweifeln. Man weiss bei ihm nie, wo
das h eigentlich hingehört. Die Unabhängigkeit der
Vereinigten §taaten scheint übrigens von den Brief-
markensammlern angestiftet worden zu sein.
In Frankreich ist Ludwig der Füntzehnte ununter-
brochen fünf Jahre alt. Ihm folgt sein Enkel (Kinder
hatte er keine) Ludwig der Sechzehnte, der die für
eine Revolution erforderlichen Fachkenntnisse nicht
besass. Diese brach infolge eines vielbändigen Werkes,
der sogenannten Enzyklopädie aus, weil das französische
Volk die Raten nicht bezahlen konnte, für welche das
Werk zu beziehen war. Eine der wichtigsten Er-
findungen der Neuzeit ist das Defizit, das damals zum
erstenmal auftrat und sich von da an wie ein roter
Faden durch die Neuzeit zieht. Wo zwei Menschen
zusammenkommen, entsteht, seit damals, ein Defizit.
Um die Defizite zu vermehren, werden Vereine ge-
gründet und Festzüge arrangiert. Doch gibt es auch
zahlreiche Einzelpersonen, die sehr namhafte Defizite
erreichen. Zur Zeit der französischen Revolution waren
die Leute so naiv, dass sie sich vor dem Defizit
fürchteten. Um es zu beseitigen, wählte man das un-
tauglichste Mittel: man berief eine grosse Versammlung
ein. Mirabeau benutzte sein blatternarbiges Gesicht,
um dem König zu imponieren, wurde aber später zu
seinem Leidwesen so bestochen, dass er von der
Revolution zurücktreten musste. Unter den Jakobinern
sprach besonders Robespierre durch die Nase. Er
liess eine Hinrichtungsmaschine, Guillotine, aufstellen.
Da diese einen Haufen Geld gekostet hatte, mussten
viele Tausende hingerichtet werden, um das in sie
hineingesteckte Kapital zu amortisieren. Der König
wollte fliehen, wurde jedoch an seiner Abstammnng
erkannt und gefangen. Er hiess von da an mehr
Capet als Ludwig und wurde enthauptet. Im weiteren
Verlaufe wechselten die Verfassungen in der Weise,
dass keine Partei bei der Guillotinierung zu kurz kam.
Der Leutenant Bonaparte hatte sich schon lange eine
Revolution gewünscht, um besser zu avancieren. Da
er zu unfähig war, um auf anständige Art Geld zu
verdienen, bewarb er sich um die seit Attila vakante
Sinekure eines Welteroberers. Er begab sich nach
Aegypten, wo er, wie er es erwartet hatte, ganz ge-
wöhnliche Mameluken vorfand, die ihm den Gefallen
taten, sich von ihm besiegen zu lassen.f
Napoleon, der so klein war, dass ihn keine Kugel
treffen konnte, tummelte sich mit dem Kriegsführen
ungeheuer, damit es ihm die anderen nicht abspicken.
Er siegte solange, bis er nach Wien kam, wo er nach
kurzem Aufenthalt so verdummte, dass er in der Schlacht
bei Aspern geschiagen wurde. In seiner unglaublichen
Naivität ging er auch nach Russland, was wir ihm,
wenn er sich an uns gewendet hätte, dringend wider-
raten hätten. Die Russen hatten den Plan, sich solange
zurückzuziehen, bis sie ihm auf der anderen Seite der
Erde in den Rücken fielen. Napoleons Heer bestand
übrigens zum grössten Teile aus Deutschen und
Oesterreichern, die er vieleicht auf diesem Wege ver-
nichten wollte. AIs Napoleon Moskau betrat, waren
alle Leute ausgezogen. Es scheint gerade zum Zins-
termin gewesen zu sein. Wenn Napoleon niemanden
zum Erschiessen hatte, wusste er mit seiner freien Zeit
nichts anzufangen. Damit rechneten die Russen. Sie
zündeten Moskau an, weil sie wussten, dass Napoleon
nicht versichert war. Er verschaute sich im Feuer und
wurde vom Winter überrascht. Er war offenbar zu
faul, im Kalender nachzusehen. JAnstatt nun justament
in Russland zu bleiben, trat er den Rückzug an. Von
da an kommt er immer mehr ins Patzen. Es ist
übrigens rätselhaft, wie er in allen Schlachten Zeit
fand, sich zu rasieren. Es machte den denkbar un-
günstigsten Eindruck, als Napoleon in der Schlacht bei
Leipzig geschlagen wurde. Die Verbündeten zogen
nach Paris, Napoleon wie gewöhnlich, kam zu spät.
Er wurde abgesetzt und nach Elba verbannt, wo er
mit zwei Millionen jährlich kümmerlich lebte. Zum
Glück gab es dort sehr wenig Geschäfte, so dass er
mit seinem Gelde auskam. Als er sich genügend er-
holt hatte, kehrte er nach Frankreich zurück, wo er
noch hundert vergnügte Tage hatte. Sein letzter
Aufenthalt war Sankt Helena. In dieser Position war es
ausnehmend fad und wenn ihn Hudson Lowe nicht
sekiert hätte, wäre er vor Langeweile umgekommen.
Es waren so wenig Menschen dort, dass es sich nicht
lohnte, sie umzubringen. Infolgedessen war er gänzlich
beschäftigungslos. Da er nicht zum Staatsbeamten
geboren war, so griff dies seine Gesundheit an und er
starb mit den Worten: „Weil i an alter Drahrer bin“.
Da zu wenig gelogen wurde, erfand man den
Telegraphen, ferner Dampfmaschine und Eisenbahn,
wodurch der eigentliche Zweck der Weltgeschichte: die
Entstehung der Gegenwart, wesentlich beschleunigt
wurde. Bismarck gründete die Gartenlaube, nicht ohne
vorher durch die Einigung Deutschlands einen grossen
Abonnentenkreis sichergestellt zu haben. Bald darauf
kommen die Kommis in Politik und Literatur endgültig
ans Ruder, womit die Weltgeschichte ihren allseits be-
friedigenden und versöhnenden Abschluss findet.
Ein rheinisch Dichter-
leben
Rudolf Lothar, Rudolf Herzog, Rudolph Stratz,
Rudolf Hans Bartsch und Rudolf Presber.
Ich habe diese Namen keineswegs willkürlich in
die kurze Längsseite einer kaum zum Wanken zu
bringenden Ehrenreihenfolge gezwängt. Ich will auch
mit der Aufzählung dieser Namen gewiss nicht be-
streiten, dass es Schriftstelier gibt, die, trotz ihrer
Vornamen Georg, Richard oder gar Fedor, schlech-
ter sind als einer der fünf. Aber aus reinem
Gerechtigkeitsgefühl entziehe ich mich der geistigen
Galeerenarbeit, einem Dichter, der mit dem Namen
Rudolf vorbestraft ist, durch eigene Phanfasie und
Gestaltungsgabe für meine Lektüre frei zu machen, ihm
die Handschellen der Trivialität abzunehmen. Ich bin
gegen Rudolf Lothar weit gerechter als jemand, der
ihn, obgleich er sein Schaffen mit Liebe verfolgt, hinter
Rudolf Presber setzt. Warum soll jener immer noch
nur anerkannt gut sein, während dieser der deutschen
Literaturgescichte schon einverleibt und aufgebürdet ist.
Warum soll Lothar in ihren so leicht verschiebbaren
Grenzen einen gesicherten Platz noch immer nicht in
einer Zeit besitzen, in der für Presbers Gemeindean-
wesen am Parnassabhang ein Häuschen am Luganer
See und eine Villa im Grunewald schon lange mit-
sprechen.
Wilhelm Clobes nennt die Villa eine Poetenklause,
aber sie ist doch nur eine prosaische Villa, sie ist das
wirklichste, das nüchternste Resultat der Hauptaufgabe
des Presberschen Berufs, die nackten Zahlen der
Wirklichkeit durch ein Talent, das gleich Null ist, so
zu dividieren, dass jener Quotient der Scheinpoesie
herauskommt, der von einer kunstrohen Gesell-
schaft begehrt und gut bezahlt wird.
„Das Leben ist der Dichter, wie der Stil den
Menschen legitimiert. Wie jeder wahre Dichter liebt
Presber die Einsamkeit“ [Schon diese beiden Sätze
legitimieren die Dreistigkeit und die Geistesarmut, die
Clobes hinreichend genug waren zur Abfassung einer
hundertsechsunddreissig Seiten langen biographisch-
literarischen Studie über „Presber, ein rheinisch Dichter-
leben“ —
Nicht nur Goethe, auch Presber hat in Frankfurt
am Main das imaginäre Licht der Welt erblickt. „Sein
Vater war nicht nur ein ebenso begabter und beredtqr
Ritter von Geist, wie er einem Spielhagen als Roman-
held dienen konnte, sondern er war auch Lehrer der
Literaturgeschichte, und als solcher hat er, trotz des
geringen Talentes sich zur Geltung zu bringen, einige
Bücher verfasst.“
Aber dass es ihm nicht allein an diesem Talent
gefehlt haben muss, bekundet heute selnes Sohnes
Genialität, sich als wahren Dichter ausschreien zu
lassen. Es könnte nicht allein möglich sein, dass
Presber „auf den Spuren seiner Ahnen Impressionen
empfängt, die in vielen seiner schönsten Dichtungen
Form und Farbe erhalten,“ wenn er nicht von seinem
Vater die Talente, die dieser nicht besass, ererbt hätte;
doch seines Landsmanns Mahnung, zu erwerben, was
man von seinen Vätern ererbt hat, um es zu besitzen,
befolgte er getreulich. Goethe ähnlich hatte er eine
Abneigung gegen Mathematik, und sein Biograph teilt
diese Antipathie mit ihm. Ueberhaupt „weicht Pres-
bers Schulzeit kaum in einer Nuance von der-
jenigen anderer Dichter und Denker ab, denen
schwarzsehende Präzeptoren ehedem prophezeien, dass
mal nichts aus ihnen würde.“ Selbst Tycho Mommsen
riet Presbers Mutter, den Rudolf ein Handwerk lernen
zu lassen. Sie aber brachte ihn nach Karlsruhe, und
an jenem Tage, an dem sie ihn dem neuen Gym-
nasialdirektor vorstellte, war die ganze badische Resi-
denz auf dem Friedhofe, wo die Vorstellung stattfand,
versammelt. Von ungefähr — um Scheffel das letzte
Geleite zu geben. So nahm vom Grabe weg das
Dichterleben Presbers seinen unabwendbaren Anfang.
Bald schrieb er für irgend ein dreihundertjähriges Jubi-
läum ein Festspiel und es fiel ihm auch die Ehre zu,
für die Prlmaner die Abschiedrede zu halten.
„Zwischen den Zwanzigerjahren stand der Frühling des
rheinischen Dichterlebens in voller Saat, damals, als
er hoch zu Ross oder auf dem Rade die sommerlich
satte Landschaft des Breisgaus oder das Neckartal
zur Zeit der Weinlese durchstreifte.“ Und wenn er
damals „merkwürdiger Weise“ am liebsten Mosel-
wein trank, bevorzugt er heute den feurigen Burgunder,
der wie Rubine im Glase funkelt und „bekanntlich
schon unsere Klassiker zu viel Schönem, Wahrem und
Gutem begeisterte.“
Aber trotz der Feurigkeit des Burgunders und philo-
sophischer Studien vermochte Presber unsere flache
Kellersprüchepoesie, die Clobes so hoch bedeutsam
findet, um kein Stufe zu vertiefen, und durch feucht-
fröhliche Weisheit allein lässt sich unsere Lebensfreude
nicht steigern. Durch jene Presbers schon garnicht
Denn sie verdunstet, in der klaren, trockenen Luft der
Nüchternheit kaum beschaut, so schnell, als der Bur-
gunder, den er bevorzugt und der weniger wie Rubine,
sondern eher wie rote Butzenscheibensplitter im Glase
funkelt.
„Die Zeit der unpersönlichen Zeitungen ist vorbei.
Heute sucht der unintelligente Leser hinter dem Ar-
tikel den Menschen, der ihn schreibt.“ So dachte der
Theaterdichter Presber, nachdem der „geborene
Journalist Presber“ Feulletonredakteur geworden
war. „Er schwarg unter’m Strich das kritische Richt-
schwert in derselben faszinierenden Weise, wie er das
satirische Florett handhabte oder den Schläger über
Philister und Banausen schwang.“ Und nebenher
schrieb er noch feinsinnige Verse.
Es kann jemand sehr wohl ein Schuster und ein
Dichter sein, aber niemals wird der geborene Journa-
list dem echten Dichter auch nur annäherrd verwandt
sein. Die Dichtkunst hat noch immer dort aufgehört,
wo der Journalismus hereinbrach. Als den geborenen
Journalisten Iässt Presber sich rühmen, aber nur als
Dichter will er sterben, „anhebt“ doch eines seiner
Lieder so:
„Ich möcht’ nicht sterben als Journalist
(Und blühten mir Bolzens Ehrenl)
Und bis ans Ende des Tages Mist
In dampfende Häuflein zu kehren.“
Verächtlicher kann auch ein Dichter vom
Journalismus nicht sprechen. Tagesmist in dampfende
Häuflein zu kehren ist Schmokarbeit, doch Bolzens
Ehren können ihr dennoch erblühen. Von Presbers
Beschäftigung mit Tagesmist, so sehr er auch sich ihr
abgekehrt hat, blieb in seiner Feder ein übler Geruch
haften, den die Musen fliehen. „Aber der Feuilletonis-
mus Presbers ist stets subjektiv gewesen. Und wenn
der Enkel des rasenden Sokrates, der als originellster
Sonderling unter der Sonne Homers vier Jahrhunderte
vor Christi in einem Fass kampierte, wenn der menschen-
suchende Diogenes von heute auch in der Hauptlinie
375