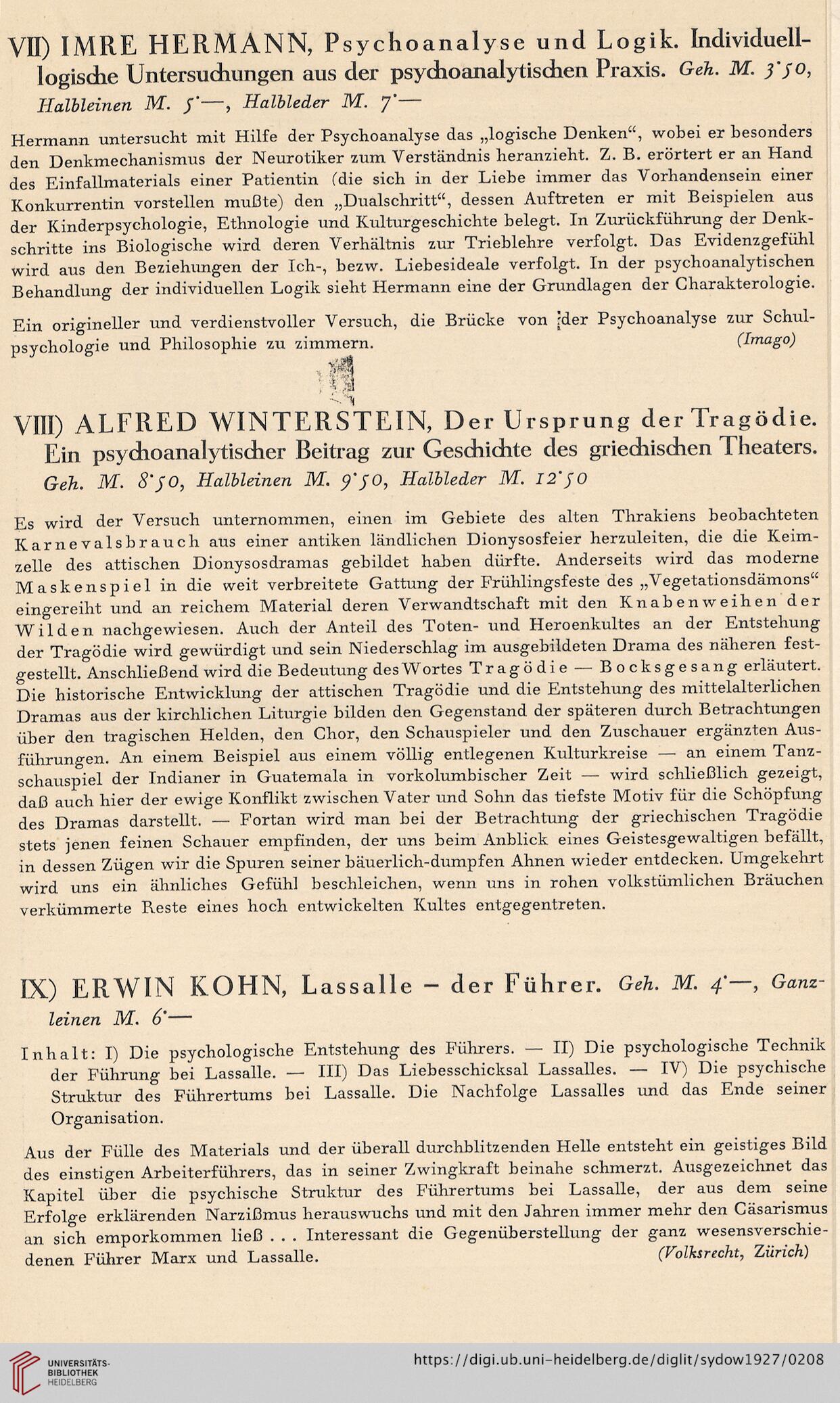VII) IMRE HERMANN, Psychoanalyse und Logik. Individuell-
logisdie Untersuchungen aus der psychoanalytischen Praxis. Geh. M. 3'30,
Halbleinen M. 3'—, Halbleder M. *]'—
Hermann untersucht mit Hilfe der Psychoanalyse das „logische Denken“, wobei er besonders
den Denkmechanismus der Neurotiker zum Verständnis heranzieht. Z. B. erörtert er an Hand
des Einfallmaterials einer Patientin (die sich in der Liebe immer das Vorhandensein einer
Konkurrentin vorstellen mußte) den „Dualschritt“, dessen Auftreten er mit Beispielen aus
der Kinderpsychologie, Ethnologie und Kulturgeschichte belegt. In Zuriickführung der Denk-
schritte ins Biologische wird deren Verhältnis zur Trieblehre verfolgt. Das Evidenzgefühl
wird aus den Beziehungen der Ich-, bezw. Liebesideale verfolgt. In der psychoanalytischen
Behandlung der individuellen Logik sieht Hermann eine der Grundlagen der Charakterologie.
Ein origineller und verdienstvoller Versuch, die Brücke von rder Psychoanalyse zur Schul-
psychologie und Philosophie zu zimmern. (Imago)
VIII) ALFRED WINTERSTEIN, Der Ursprung der Tragödie.
Ein psychoanalytischer Beitrag zur Geschichte des griechischen Theaters.
Geh. M. 8'30, Halbleinen M. 9'30, Halbleder M. 12'30
Es wird der Versuch unternommen, einen im Gebiete des alten Thrakiens beobachteten
Karnevalshrauch aus einer antiken ländlichen Dionysosfeier herzuleiten, die die Keim-
zelle des attischen Dionysosdramas gebildet haben dürfte. Anderseits wird das moderne
Maskenspiel in die weit verbreitete Gattung der Frühlingsfeste des „Vegetationsdämons“
eingereiht und an reichem Material deren Verwandtschaft mit den Knabenweihen der
Wilden nachgewiesen. Auch der Anteil des Toten- und Heroenkultes an der Entstehung
der Tragödie wird gewürdigt und sein Niederschlag im ausgebildeten Drama des näheren fest-
gestellt. Anschließend wird die Bedeutung des Wortes Tragödie — Bocksgesang erläutert.
Die historische Entwicklung der attischen Tragödie und die Entstehung des mittelalterlichen
Dramas aus der kirchlichen Liturgie bilden den Gegenstand der späteren durch Betrachtungen
über den tragischen Helden, den Chor, den Schauspieler und den Zuschauer ergänzten Aus-
führungen. An einem Beispiel aus einem völlig entlegenen Kulturkreise — an einem Tanz-
schauspiel der Indianer in Guatemala in vorkolumbischer Zeit — wird schließlich gezeigt,
daß auch hier der ewige Konflikt zwischen Vater und Sohn das tiefste Motiv für die Schöpfung
des Dramas darstellt. — Fortan wird man bei der Betrachtung der griechischen Tragödie
stets jenen feinen Schauer empfinden, der uns beim Anblick eines Geistesgewaltigen befällt,
in dessen Zügen wir die Spuren seiner bäuerlich-dumpfen Ahnen wieder entdecken. Umgekehrt
wird uns ein ähnliches Gefühl beschleichen, wenn uns in rohen volkstümlichen Bräuchen
verkümmerte Reste eines hoch entwickelten Kultes entgegentreten.
IX) ERWIN KOHN, Lassalle — der Führer. Geh. M. 4'—, Ganz-
leinen M. 6'—
Inhalt: I) Die psychologische Entstehung des Führers. — II) Die psychologische Technik
der Führung bei Lassalle. — III) Das Liebesschicksal Lassalles. — IV) Die psychische
Struktur des Führertums bei Lassalle. Die Nachfolge Lassalles und das Ende seiner
Organisation.
Aus der Fülle des Materials und der überall durchblitzenden Helle entsteht ein geistiges Bild
des einstigen Arbeiterführers, das in seiner Zwingkraft beinahe schmerzt. Ausgezeichnet das
Kapitel über die psychische Struktur des Führertums bei Lassalle, der aus dem seine
Erfolge erklärenden Narzißmus herauswuchs und mit den Jahren immer mehr den Cäsarismus
an sich emporkommen ließ . . . Interessant die Gegenüberstellung der ganz wesensverschie-
denen Führer Marx und Lassalle. (Kolksrecht, Zürich)
logisdie Untersuchungen aus der psychoanalytischen Praxis. Geh. M. 3'30,
Halbleinen M. 3'—, Halbleder M. *]'—
Hermann untersucht mit Hilfe der Psychoanalyse das „logische Denken“, wobei er besonders
den Denkmechanismus der Neurotiker zum Verständnis heranzieht. Z. B. erörtert er an Hand
des Einfallmaterials einer Patientin (die sich in der Liebe immer das Vorhandensein einer
Konkurrentin vorstellen mußte) den „Dualschritt“, dessen Auftreten er mit Beispielen aus
der Kinderpsychologie, Ethnologie und Kulturgeschichte belegt. In Zuriickführung der Denk-
schritte ins Biologische wird deren Verhältnis zur Trieblehre verfolgt. Das Evidenzgefühl
wird aus den Beziehungen der Ich-, bezw. Liebesideale verfolgt. In der psychoanalytischen
Behandlung der individuellen Logik sieht Hermann eine der Grundlagen der Charakterologie.
Ein origineller und verdienstvoller Versuch, die Brücke von rder Psychoanalyse zur Schul-
psychologie und Philosophie zu zimmern. (Imago)
VIII) ALFRED WINTERSTEIN, Der Ursprung der Tragödie.
Ein psychoanalytischer Beitrag zur Geschichte des griechischen Theaters.
Geh. M. 8'30, Halbleinen M. 9'30, Halbleder M. 12'30
Es wird der Versuch unternommen, einen im Gebiete des alten Thrakiens beobachteten
Karnevalshrauch aus einer antiken ländlichen Dionysosfeier herzuleiten, die die Keim-
zelle des attischen Dionysosdramas gebildet haben dürfte. Anderseits wird das moderne
Maskenspiel in die weit verbreitete Gattung der Frühlingsfeste des „Vegetationsdämons“
eingereiht und an reichem Material deren Verwandtschaft mit den Knabenweihen der
Wilden nachgewiesen. Auch der Anteil des Toten- und Heroenkultes an der Entstehung
der Tragödie wird gewürdigt und sein Niederschlag im ausgebildeten Drama des näheren fest-
gestellt. Anschließend wird die Bedeutung des Wortes Tragödie — Bocksgesang erläutert.
Die historische Entwicklung der attischen Tragödie und die Entstehung des mittelalterlichen
Dramas aus der kirchlichen Liturgie bilden den Gegenstand der späteren durch Betrachtungen
über den tragischen Helden, den Chor, den Schauspieler und den Zuschauer ergänzten Aus-
führungen. An einem Beispiel aus einem völlig entlegenen Kulturkreise — an einem Tanz-
schauspiel der Indianer in Guatemala in vorkolumbischer Zeit — wird schließlich gezeigt,
daß auch hier der ewige Konflikt zwischen Vater und Sohn das tiefste Motiv für die Schöpfung
des Dramas darstellt. — Fortan wird man bei der Betrachtung der griechischen Tragödie
stets jenen feinen Schauer empfinden, der uns beim Anblick eines Geistesgewaltigen befällt,
in dessen Zügen wir die Spuren seiner bäuerlich-dumpfen Ahnen wieder entdecken. Umgekehrt
wird uns ein ähnliches Gefühl beschleichen, wenn uns in rohen volkstümlichen Bräuchen
verkümmerte Reste eines hoch entwickelten Kultes entgegentreten.
IX) ERWIN KOHN, Lassalle — der Führer. Geh. M. 4'—, Ganz-
leinen M. 6'—
Inhalt: I) Die psychologische Entstehung des Führers. — II) Die psychologische Technik
der Führung bei Lassalle. — III) Das Liebesschicksal Lassalles. — IV) Die psychische
Struktur des Führertums bei Lassalle. Die Nachfolge Lassalles und das Ende seiner
Organisation.
Aus der Fülle des Materials und der überall durchblitzenden Helle entsteht ein geistiges Bild
des einstigen Arbeiterführers, das in seiner Zwingkraft beinahe schmerzt. Ausgezeichnet das
Kapitel über die psychische Struktur des Führertums bei Lassalle, der aus dem seine
Erfolge erklärenden Narzißmus herauswuchs und mit den Jahren immer mehr den Cäsarismus
an sich emporkommen ließ . . . Interessant die Gegenüberstellung der ganz wesensverschie-
denen Führer Marx und Lassalle. (Kolksrecht, Zürich)