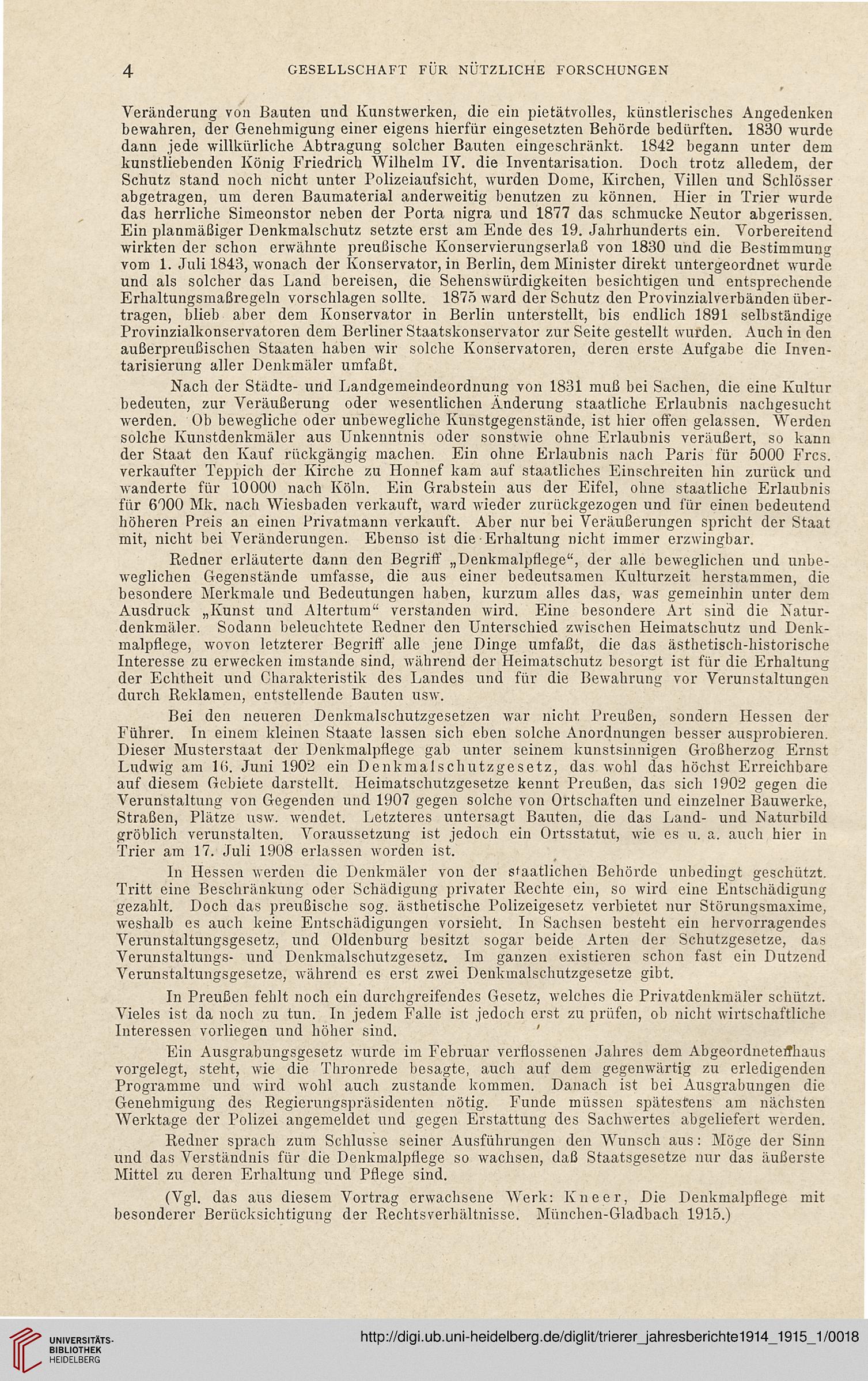4
GESELLSCHAFT FÜR NÜTZLICHE FORSCHUNGEN
Veränderung von Bauten und Kunstwerken, die ein pietätvolles, künstlerisches Angedenken
bewahren, der Genehmigung einer eigens hierfür eingesetzten Behörde bedürften. 1830 wurde
dann jede willkürliche Abtragung solcher Bauten eingeschränkt. 1842 begann unter dem
kunstliebenden König Friedrich Wilhelm IV. die Inventarisation. Doch trotz alledem, der
Schutz stand noch nicht unter Polizeiaufsicht, wurden Dome, Kirchen, Villen und Schlösser
abgetragen, um deren Baumaterial anderweitig benutzen zu können. Hier in Trier wurde
das herrliche Simeonstor neben der Porta nigra und 1877 das schmucke Neutor abgerissen.
Ein planmäßiger Denkmalschutz setzte erst am Ende des 19. Jahrhunderts ein. Vorbereitend
wirkten der schon erwähnte preußische Konservierungserlaß von 1830 und die Bestimmung
vom 1. Juli 1843, wonach der Konservator, in Berlin, dem Minister direkt untergeordnet wurde
und als solcher das Land bereisen, die Sehenswürdigkeiten besichtigen und entsprechende
Erhaltungsmaßregeln vorschlagen sollte. 1875 ward der Schutz den Provinzialverbänden über-
tragen, blieb aber dem Konservator in Berlin unterstellt, bis endlich 1891 selbständige
Provinzialkonservatoren dem Berliner Staatskonservator zur Seite gestellt wurden. Auch in den
außerpreußischen Staaten haben wir solche Konservatoren, deren erste Aufgabe die Inven-
tarisierung aller Denkmäler umfaßt.
Nach der Städte- und Landgemeindeordnung von 1831 muß bei Sachen, die eine Kultur
bedeuten, zur Veräußerung oder wesentlichen Änderung staatliche Erlaubnis nachgesucht
werden. Ob bewegliche oder unbewegliche Kunstgegenstände, ist hier offen gelassen. Werden
solche Kunstdenkmäler aus Unkenntnis oder sonstwie ohne Erlaubnis veräußert, so kann
der Staat den Kauf rückgängig machen. Ein ohne Erlaubnis nach Paris für 5000 Frcs.
verkaufter Teppich der Kirche zu Honnef kam auf staatliches Einschreiten hin zurück und
wanderte für 10000 nach Köln. Ein Grabstein aus der Eifel, ohne staatliche Erlaubnis
für 6900 Mk. nach Wiesbaden verkauft, ward wieder zurückgezogen und für einen bedeutend
höheren Preis an einen Privatmann verkauft. Aber nur bei Veräußerungen spricht der Staat
mit, nicht bei Veränderungen. Ebenso ist die ■ Erhaltung nicht immer erzwingbar.
Redner erläuterte dann den Begriff „Denkmalpflege“, der alle beweglichen und unbe-
weglichen Gegenstände umfasse, die aus einer bedeutsamen Kulturzeit herstammen, die
besondere Merkmale und Bedeutungen haben, kurzum alles das, was gemeinhin unter dem
Ausdruck „Kunst und Altertum“ verstanden wird. Eine besondere Art sind die Natur-
denkmäler. Sodann beleuchtete Redner den Unterschied zwischen Heimatschutz und Denk-
malpflege, wovon letzterer Begriff alle jene Dinge umfaßt, die das ästhetisch-historische
Interesse zu erwecken imstande sind, während der Heimatschutz besorgt ist für die Erhaltung
der Echtheit und Charakteristik des Landes und für die Bewahrung vor Verunstaltungen
durch Reklamen, entstellende Bauten usw.
Bei den neueren Denkmalschutzgesetzen war nicht. Preußen, sondern Hessen der
Führer. In einem kleinen Staate lassen sich eben solche Anordnungen besser ausprobieren.
Dieser Musterstaat der Denkmalpflege gab unter seinem kunstsinnigen Großherzog Ernst
Ludwig am 16. Juni 1902 ein Denkmalschutzgesetz, das wohl das höchst Erreichbare
auf diesem Gebiete darstellt. Heimatschutzgesetze kennt Preußen, das sich 1902 gegen die
Verunstaltung von Gegenden und 1907 gegen solche von Ortschaften und einzelner Bauwerke,
Straßen, Plätze usw. wendet. Letzteres untersagt Bauten, die das Land- und Naturbild
gröblich verunstalten. Voraussetzung ist jedoch ein Ortsstatut, wie es u. a. auch hier in
Trier am 17. Juli 1908 erlassen worden ist.
In Hessen werden die Denkmäler von der staatlichen Behörde unbedingt geschützt.
Tritt eine Beschränkung oder Schädigung privater Rechte ein, so wird eine Entschädigung
gezahlt. Doch das preußische sog. ästhetische Polizeigesetz verbietet nur Störungsmaxime,
weshalb es auch keine Entschädigungen vorsieht. In Sachsen besteht ein hervorragendes
Verunstaltungsgesetz, und Oldenburg besitzt sogar beide Arten der Schutzgesetze, das
Verunstaltungs- und Denkmalschutzgesetz. Ira ganzen existieren schon fast ein Dutzend
Verunstaltungsgesetze, während es erst zwei Denkmalschutzgesetze gibt.
In Preußen fehlt noch ein durchgreifendes Gesetz, welches die Privatdenkmäler schützt.
Vieles ist da noch zu tun. In jedem Falle ist jedoch erst zu prüfen, ob nicht wirtschaftliche
Interessen vorliegen und höher sind.
Ein Ausgrabungsgesetz wurde im Februar verflossenen Jahres dem Abgeordnetenhaus
vorgelegt, steht, wie die Thronrede besagte, auch auf dem gegenwärtig zu erledigenden
Programme und wird wohl auch zustande kommen. Danach ist bei Ausgrabungen die
Genehmigung des Regierungspräsidenten nötig. Funde müssen spätestens am nächsten
Werktage der Polizei angemeldet und gegen Erstattung des Sachwertes abgeliefert werden.
Redner sprach zum Schlüsse seiner Ausführungen den Wunsch aus: Möge der Sinn
und das Verständnis für die Denkmalpflege so wachsen, daß Staatsgesetze nur das äußerste
Mittel zu deren Erhaltung und Pflege sind.
(Vgl. das aus diesem Vortrag erwachsene Werk: Kneer, Die Denkmalpflege mit
besonderer Berücksichtigung der Rechtsverhältnisse. München-Gladbach 1915.)
GESELLSCHAFT FÜR NÜTZLICHE FORSCHUNGEN
Veränderung von Bauten und Kunstwerken, die ein pietätvolles, künstlerisches Angedenken
bewahren, der Genehmigung einer eigens hierfür eingesetzten Behörde bedürften. 1830 wurde
dann jede willkürliche Abtragung solcher Bauten eingeschränkt. 1842 begann unter dem
kunstliebenden König Friedrich Wilhelm IV. die Inventarisation. Doch trotz alledem, der
Schutz stand noch nicht unter Polizeiaufsicht, wurden Dome, Kirchen, Villen und Schlösser
abgetragen, um deren Baumaterial anderweitig benutzen zu können. Hier in Trier wurde
das herrliche Simeonstor neben der Porta nigra und 1877 das schmucke Neutor abgerissen.
Ein planmäßiger Denkmalschutz setzte erst am Ende des 19. Jahrhunderts ein. Vorbereitend
wirkten der schon erwähnte preußische Konservierungserlaß von 1830 und die Bestimmung
vom 1. Juli 1843, wonach der Konservator, in Berlin, dem Minister direkt untergeordnet wurde
und als solcher das Land bereisen, die Sehenswürdigkeiten besichtigen und entsprechende
Erhaltungsmaßregeln vorschlagen sollte. 1875 ward der Schutz den Provinzialverbänden über-
tragen, blieb aber dem Konservator in Berlin unterstellt, bis endlich 1891 selbständige
Provinzialkonservatoren dem Berliner Staatskonservator zur Seite gestellt wurden. Auch in den
außerpreußischen Staaten haben wir solche Konservatoren, deren erste Aufgabe die Inven-
tarisierung aller Denkmäler umfaßt.
Nach der Städte- und Landgemeindeordnung von 1831 muß bei Sachen, die eine Kultur
bedeuten, zur Veräußerung oder wesentlichen Änderung staatliche Erlaubnis nachgesucht
werden. Ob bewegliche oder unbewegliche Kunstgegenstände, ist hier offen gelassen. Werden
solche Kunstdenkmäler aus Unkenntnis oder sonstwie ohne Erlaubnis veräußert, so kann
der Staat den Kauf rückgängig machen. Ein ohne Erlaubnis nach Paris für 5000 Frcs.
verkaufter Teppich der Kirche zu Honnef kam auf staatliches Einschreiten hin zurück und
wanderte für 10000 nach Köln. Ein Grabstein aus der Eifel, ohne staatliche Erlaubnis
für 6900 Mk. nach Wiesbaden verkauft, ward wieder zurückgezogen und für einen bedeutend
höheren Preis an einen Privatmann verkauft. Aber nur bei Veräußerungen spricht der Staat
mit, nicht bei Veränderungen. Ebenso ist die ■ Erhaltung nicht immer erzwingbar.
Redner erläuterte dann den Begriff „Denkmalpflege“, der alle beweglichen und unbe-
weglichen Gegenstände umfasse, die aus einer bedeutsamen Kulturzeit herstammen, die
besondere Merkmale und Bedeutungen haben, kurzum alles das, was gemeinhin unter dem
Ausdruck „Kunst und Altertum“ verstanden wird. Eine besondere Art sind die Natur-
denkmäler. Sodann beleuchtete Redner den Unterschied zwischen Heimatschutz und Denk-
malpflege, wovon letzterer Begriff alle jene Dinge umfaßt, die das ästhetisch-historische
Interesse zu erwecken imstande sind, während der Heimatschutz besorgt ist für die Erhaltung
der Echtheit und Charakteristik des Landes und für die Bewahrung vor Verunstaltungen
durch Reklamen, entstellende Bauten usw.
Bei den neueren Denkmalschutzgesetzen war nicht. Preußen, sondern Hessen der
Führer. In einem kleinen Staate lassen sich eben solche Anordnungen besser ausprobieren.
Dieser Musterstaat der Denkmalpflege gab unter seinem kunstsinnigen Großherzog Ernst
Ludwig am 16. Juni 1902 ein Denkmalschutzgesetz, das wohl das höchst Erreichbare
auf diesem Gebiete darstellt. Heimatschutzgesetze kennt Preußen, das sich 1902 gegen die
Verunstaltung von Gegenden und 1907 gegen solche von Ortschaften und einzelner Bauwerke,
Straßen, Plätze usw. wendet. Letzteres untersagt Bauten, die das Land- und Naturbild
gröblich verunstalten. Voraussetzung ist jedoch ein Ortsstatut, wie es u. a. auch hier in
Trier am 17. Juli 1908 erlassen worden ist.
In Hessen werden die Denkmäler von der staatlichen Behörde unbedingt geschützt.
Tritt eine Beschränkung oder Schädigung privater Rechte ein, so wird eine Entschädigung
gezahlt. Doch das preußische sog. ästhetische Polizeigesetz verbietet nur Störungsmaxime,
weshalb es auch keine Entschädigungen vorsieht. In Sachsen besteht ein hervorragendes
Verunstaltungsgesetz, und Oldenburg besitzt sogar beide Arten der Schutzgesetze, das
Verunstaltungs- und Denkmalschutzgesetz. Ira ganzen existieren schon fast ein Dutzend
Verunstaltungsgesetze, während es erst zwei Denkmalschutzgesetze gibt.
In Preußen fehlt noch ein durchgreifendes Gesetz, welches die Privatdenkmäler schützt.
Vieles ist da noch zu tun. In jedem Falle ist jedoch erst zu prüfen, ob nicht wirtschaftliche
Interessen vorliegen und höher sind.
Ein Ausgrabungsgesetz wurde im Februar verflossenen Jahres dem Abgeordnetenhaus
vorgelegt, steht, wie die Thronrede besagte, auch auf dem gegenwärtig zu erledigenden
Programme und wird wohl auch zustande kommen. Danach ist bei Ausgrabungen die
Genehmigung des Regierungspräsidenten nötig. Funde müssen spätestens am nächsten
Werktage der Polizei angemeldet und gegen Erstattung des Sachwertes abgeliefert werden.
Redner sprach zum Schlüsse seiner Ausführungen den Wunsch aus: Möge der Sinn
und das Verständnis für die Denkmalpflege so wachsen, daß Staatsgesetze nur das äußerste
Mittel zu deren Erhaltung und Pflege sind.
(Vgl. das aus diesem Vortrag erwachsene Werk: Kneer, Die Denkmalpflege mit
besonderer Berücksichtigung der Rechtsverhältnisse. München-Gladbach 1915.)