Hinweis: Dies ist eine zusätzlich gescannte Seite, um Farbkeil und Maßstab abbilden zu können.
0.5
1 cm
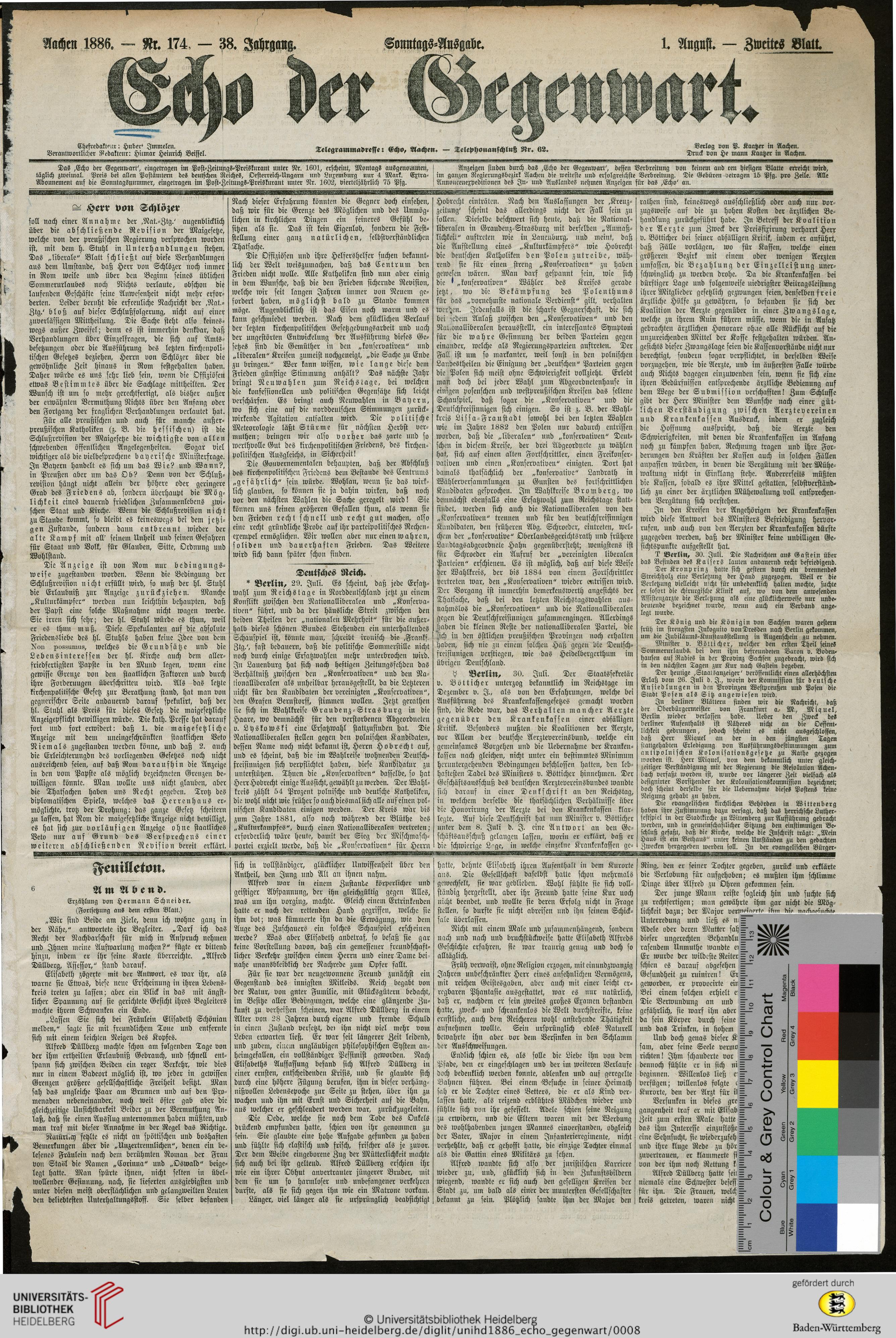
1. AiWst. — ZwcitcS Blalt.
Aachcn 1888. — Rr. 174 — 38. JahrMg.
Chefredakt->ur: Hubcr' Jmnrelen.
Verantwortlicher Medaktcnr: Hiunar Hemrich Beissel.
Telegrammadrefle r Echo, Aache«. — Telephoua«schl«ß Nr. 6S.
Berlog von P. Kaatzer in Aachen.
Druck von He mann Kaatzer in Aachen.
Das ,Echo der Gegenwarth cingetragen im Post-Zeitungs-Preiskurant unter Nr. 1601, erscheint, Montags ausgenommen,
täglich zwcimal. Preis bei allen Postämtern des deutschen Reiches, Ocsterreich-Ungarn und Lnxemburg nur 4 Mark. Extra-
Abonnement auf die Sonntagsnummer, eingetragen im Post-Zcitungs.Preiskurant unter Nr. 1602, vierteljährlich 75 Pfg.
Anzeigen findcn durch das ,Echo der Gegenwart', desscn Bcrbreitung von keinem and cen hiesigen Blatte erreicht wird,
im ganzen Regicrungsbezirk Aachcn die wcitestc und erfolgreichste Vcrbreitung. Die Gebüren oetragen 15 Pfg. pro Zeile. Alle
Annoncenexpeditionen des Jn- und Auslandes nehmen Anzeigen für das ,Echch an.
^ Herr von Schlözer
soll nach einer Annahme der ,Nat.-Ztg/ augenblicklich
über die abschließende Revision der Maigesetze,
welche von der preußischen Regierung versprochen wvrden
ist, mit dem h. Stuhl in Unterhandlungen stehen.
Das „liberale" Blatt schließt auf diese Verhandlungen
aus dem Umstande, daß Herr von Schlözer noch immer
in Rom weile und über deu Beginn seines üblichen
Sommerurlaubes noch Nichts verlaute, obschon die
laufendcn Geschäfte seine Anwcsenheit nicht mehr crfor-
derten. Lcider beruht die erfceuliche Nachricht der ,Nat.-
Ztg? bloß auf dieser Schlußfolgerung, nicht auf einer
zuverlässigcn Mittheilung. Die Sache steht also keines-
wegs außer Zweifel; denn es ist immerhin dcnkbar, daß
Verhandlungen über Einzelfragen, die sich auf Amts-
besetzungen oder die Ausführung des letzten kirchcnpoli-
tischen Gesetzes beziehen, Herrn von Schlözcr über die
gewöhnliche Zeit hinaus in Rom festgehalten haben.
Daher würde es uns sehr lieb sein, wenn die Offiziöscn
etwas Bestimmtes über die Sachlage mittheilten. Der
Wunsch ist um so mehr gerechtfertigt, als bisher außcr
der erwähnten Vermuthung Nichts über den Anfang oder
den Fortgang der fraglichen Verhandlungen verlautet hat.
Für alle preußischcn und auch für manche außer-
preußischen Katholiken (z. B. die hessischen) ist die
Schlußrevision der Maigesetze die wichtigste von allen
fchwebenden öffentlichen Angelegenheiten. Sogar viel
wichtiger als die vielbesprochene b ay erische Ministerfrage.
Jn Bayern handelt es sich um das Wie? und Wann?,
in Preußen aber um das Ob? Denn von der Schluß-
revisivn hängt nicht allein der höhere oder geringere
Grad des Friedens ab, sondern überhaupt die Mög-
lichkeit eines dauernd friedlichen Zusammenlebens zwi-
schen Staat und Kirche. Wenn die Schlußrevision nicht
zuStande kommt, so bleibt es keineswegs bei dem jetzi-
gen Zustande, sondern dann entbrcnnt wieder der
alte Kampf mit all' seinem Unheil und seincn Gefahren
für Staat und Volk, für Glauben, Sitte, Ordnung und
Wohlstand.
Die Anzeige ist von Rom nur bedingungs-
weise zugestanden worden. Wenn die Bedingung dcr
Schlußrevision nicht erfüllt wird, so muß der hl. Stuhl
die Erlaubniß zur Anzeige zurückziehen. Manche
„Kulturkämpfer" werden nun lcichthin behaupten, daß
dcr Papst eine solche Maßnahme nicht wagen werde.
Sie irren sich sehr; der hl. Stuhl würde es thun, weil
er es thuu muß. Diese Spekulanten auf die absvlute
Friedensliebe des hl. Stuhls haben keine Jdce von dem
Äou possninus, welches die Grundsätze und die
Lebensinteressen der hl. Kirche auch dem aller-
friedfertigsten Papste in den Mund legen, wenn eine
gewisse Grcnze von den staatlichen Faktoren und durch
ihre Forderuugen überschritteu wird. Als das letzte
kirchenpolttische Gesetz zur Berathung stand, hat man von
gegnerischer Seite andauernd darauf spekulirt, daß der
hl. Stuhl als Prcis für dieses Gesetz die maigesetzliche
Anzeigepflicht bewilligen würde. Die kath. Presse hat darauf
fort und fort erwidert: daß 1. die maigesetzliche
Anzeige mit dem uneingeschräukten staatlichen Beto
Nicmals zugestanden wcrden könne, und daß 2. auch
die Erleichterungdn des vorliegenden Gesetzes nvch nicht
ausrcichend seien, auf daß Rom daraufhin die Anzeige
in dcn vom Papste als möglich bezeichneten Grenzen be-
willigen könnte. Man wollte uns nicht glauben, aber
die Thatsachen haben uns Recht gcgcben. Trotz des
diplomatischen Spiels, Welches das Herrenhaus er-
möglichte, trotz der Drohung: das ganze Gesetz scheitern
zu lassen, hat Rom die maigcsetzliche Anzcige nicht bewilligt,
es hat sich zur vorläufigen Anzeige ohne staatliches
Veto nur auf Grund des Versprechens einer
weiteren abschließenden Revision bereit erklärt.
Nach dieser Erfahrung könnten die Gegner doch einsehen,
daß wir für die Grenze des Möglichen und des Unmög-
lichen in kirchlichen Dingen ein feincres Gefühl be-
sitzen als sie. Das ist kein Eigenlob, sondcrn die Fest-
stellung einer ganz natürlichen, selbstverständlichcn
Thatsache.
Die Offiziösen und ihre Helfershelfer suchen bekannt-
lich der Welt weiszumachen, daß das Centrum den
Friedeu nicht wolle. Alle Katholiken sind nun aber einig
in dem Wunsche, daß die den Frieden sichernde Revision,
welche wir seit langen Jahren immer von Neuem ge-
fordert haben, möglichst bald zu Stande kommen
möge. Augenblicklich ist das Eisen noch warm und es
kann geschmiedet werden. Nach dem glücklichen Verlauf
der letzten kirchenpolitischen Gesetzgebungsarbeit und uach
der ungestörten Entwickelung dcr Ausführung dieses Ge-
setzes sind die Gemüther in den „konservativen" und
„liberalen" Krcisen zumeist nochgeneigt, „die Sachc zu Ende
zu bringen." Wer kann wissen, wie lange dicse dem
Frieden günstige Stimmung anhält? Das nächste Jahr
bringt Neuwahlen zum Reichstage, bei welchen
die konfessionellen und politfichen Gegensätze sich leicht
verschärfen. Es bringt auch Neuwahlen in Bayern,
wo sich cine auf die norddeutschen Stimmungcn zurück-
wirkende Agitation entfalten wird. Dic politische
Meteorologie läßt Stürme für nächsten Herbst ver-
muthen; bringen wir also vorher das zarte und so
werthvolle Gut des kirchenpolitischen Friedens, des kirchen-
Politischen Ausgleichs, in Sicherheit!
Die Gouvernementalen behaupten, daß der Abschluß
des kirchenpolitischen Fricdens dem Bcstande des Centrums
„gefährlich" sein würde. Wohlan, wenn sie das wirk-
lich glauben, so können sie ja dahin wirken, daß noch
vor den nächsten Wahlen die Sache geregelt wird! Sie
können uns keinen größeren Gefallen thun, als wenn sie
den Frieden recht schnell und recht gut machen, also
eine recht gründliche Probe auf ihr parteipolitisches Rcchen-
exempel crmöglichen. Wir wollen aber nur einen w ahren,
soliden und dauerhaften Frieden. Das Weitere
wird sich dann später schon finden.
Deutsches Reich.
* Verlin, 29. Juli. Es scheint, daß jede Ersatz-
wahl zum Reichstage in Norddeutschland jetzt zu einem
Konflikt zwischen den Nationalliberalen und „Konserva-
tivcn" führt, und da der häusliche Streit zwischen den
beiden Theilen der „nationalen Mehrhcit" für die außer-
halb diescs schönen Bundes Stehenden ein unterhaltendes
Schauspiel ist, könnte man, schreibt ironisch die ,Frankf
Ztg.', fast bedauern, daß die Politische Sommerstille nicht
noch durch einige Ersatzwahlen mehr unterbrochen wird.
Jn Lauenburg hat sich nach heftigen Zeitungsfehdcn das
Berhältniß zwischen den „Konservativeu" und den Na-
tionalliberalen als unheilbar herausgestellt, da die Letzteren
nicht für den Kandidaten der vereinigten „Konservativen",
den Grafen Bernstorff, stimmen wollen. Jetzt gerathcn
sie sich im Wahlkreise Graudenz-Strasburg in die
Haare, wo demnächst für dcn verstorbenen Abgeordneten
v. Lyskowski eine Ersatzwahl stattzufinden hat. Die
Nationalliberalen stellen gegcn den polnischen Kandidaten,
dessen Name noch nicht bekannt ist, Herrn Hobrecht auf,
und es scheint, daß die im Wahlreise wohnenden Dcutsch-
freisinnigen sich verpflichtet haben, diese Kanlndatur zu
unterstützen. Thucn die „Konservativen" dasselbe, so hat
Herr Hobrecht einige Aussicht, gewählt zu werden. Der Wahl-
kreis zählt 54 Prozent polnischc und deutsche Katholiken,
die wohl nicht wie früher so auch diesmalsich alle aufeinen Pol-
nischen Kandidaten einigen wcrden. Der Kreis wär bis
zum Jahre 1881, also noch während der Blüthe des
„Kulturkampfes", durch cinen Nationalliberalen vertreten;
erforderlich wäre heute, damit der Sieg der Mischmasch-
partei erzielt werde, daß die „Konservativen" für Herrn
Hobrecht cinträten. Nach den Auslassungen dcr ,Kreuz-
zeitung' scheint das allerdings nicht der Fall sein zu
sollcn. Dieselbe beschwert sich heute, daß die National-
libcralen in Graudenz-Strasburg mit derselben „Anmaß-
lichkeit" auftrcteu wie in Lauenburg. und mcint, daß
die Aufstellung eines „Kulturkämpfers" wie Hobrecht
die dcutschen Katholiken den Polen zutreibe, wäh-
rend sie für einen streng „Konservativen" zu haben
geweseu wärcn. Man darf gespannt sein, wie sich
die ' „konservativen" Wähler des Kreises gerade
jetzt, wo die Bekämpfung des Polenthums
für das „vornehmste nationale Verdienst" gilt, verhaltcn
wcr^cn. Jedenfalls ist die scharfe Gegnerschaft, die sich
bci ixdem Anlaß zwischen den „Konservativen" und den
Nat.onalliberalcn herausstellt, ein intercssantes Symptom
für die wahre Gesinnung der beiden Parteien gegen
einander, welche als Regierungsparteien auftreten. Der
Fall ist um so markanter, weil sonst in den polnischen
Landestheilen die Einigung der „deutschen" Parteien gegen
die Polen sich meist ohne Schwierigkeit vollzieht. Erlebt
man doch bei jeder Wahl zum Abgeordnetenhause in
einigen posenschen und westpreußischen Kreisen das seltene
Schauspiel, daß sogar die „Konservativen" und die
Deutschfreisinnigen sich einigen. So ist z. B. der Wahl-
kreis Lissa-Fraustadt sowohl bei dcn letzten Wahlen
wie im Jahre 1882 den Polen nur dadurch entrissen
worden, daß die „liberalen" und „konservativen" Dcut-
schen in diesem Kreise, der drei Abgeordnete zu wählen
hat, sich auf einen alten Fortschrittler, einen Frcikonser-
vativen und einen „Konservativen" einigten. Dort hat
damals thatsächlich der „konservative" Landrath in
Wählerversammlungen zu Gunsten des fortschrittlichen
Kandidaten gesprochen. Jm Wahlkreise Bromberg, wo
demnächst ebenfalls eine Ersatzwahl zum Reichstage statt-
findet, werden sich auch die Nationalliberalen von den
„Konservativen" trennen und für den deutschfreisinnigen
Kandidaten, den früheren Abg. Schroeder, eintreten, wel-
chcm der „konservative" Oberlandesgerichtsrath und frühere
Landtagsabgeordnete Hahn gegenübersteht; wenigstens ist
für Schroeder ein Aufruf der „vereinigten liberalen
Parteicn" erschienen. Es ist möglich, daß auf diese Weise
üer Wahlkreis, der bis 1884 von einem Fortschrittler
vertreten war, den „Konservativen" wieder «itrissen wird.
Der Borgang ist immerhin bemerkenswerth angesichts dcr
Thatsache, daß bei den letzten Reichstagswahlen aus-
nahmslvs die „Konservativen" und die Nationalliberalen
gegen die Deutschfreisinnigen zusammengingen. Allerdiugs
chaben die kleinen Reste der nationalliberalen Partei, die
ffcki in dcn östlichen preußischen Provinzen noch erhalten
haben, sich nie zu einem solcheu Haß gegen oie Deutsch-
sreisinnigen verstiegen, wie das Heidelbergerthum im
übrigen Deutschland.
hi Bcrlin, 30. Juli. Der Staatssekretär
v. Bötticher unterzog bekanntlich im Reichstage im
Dczember v. I., als von den Erfahrungen, welche bei
Ausführung des Krankenkassengesetzes gemacht worden
sind, die Rede war, das Verhalten mancher Aerzte
gegenüber den Krankcnkasscn einer abfälligen
Kritik. Besonders mußten die Koalitionen der Aerzte,
vor Allem der deutsche Aerztevereinsbund, welche ein
gemeinsames Vorgehen und die Uebernahme der Kranken-
kaffen nach glcichen, nicht unter ein bestimmtes Minimum
hcruntergehenden Bedingungeu beschlossen hatten, den leb-
haftesten Tadel des Ministers v. Böttichcr hinnehmen. Der
Geschäftsausschuß des deutschen Aerztevercinsbundes wandte
sich darauf in eincr Denkschrift au den Reichstag,
in welchem derselbe die thatsächlichen Verhältuisse über
die Hvnorirung der Aerzte bei den Krankenkassen klar-
legte. Auf diese Denkschrift hat nun Minister v. Bötticher
unter dem 8. Juli d. I. cine Antwort an den Gc-
schäftsausschuß gelangen lasscn, worin cr crklärt, daß er
die schwierige Lcge, in welche einzelne Krankenkasscn gc-
rathen sind, keineswegs ausschließlich oder auch nur vor-
zugsweise auf die zu hohen Kosten der ärztlichen Be-
handlung zurückgeführt habe. Jn Betreff der Koalition
der Aerzte zum Zweck der Preisfixirung verharrt Herr
v. Bötticher bei sciner abfälligcn Kritik, indem er anführt,
daß Fälle vorlägen, wo für Kassen, welche einen
größcren Bezirk mit einem oder wenigen Aerzten
umfaffen, die Bezahlung der Einzelleistung uner-
schwinglich zu werden drohe. Da die Krankenkassen bei
dürftiger Lage und folgenweise niedrigster Beitragsleistung
ihrer Mitglieder gesetzlich gezwungen seien, denselben freie
ärztliche Hülfe zu gewähren, so befanden sie sich der
Koalition der Aerzte gegenüber in einer Zwangslage,
welche zu ihrem Rnin führen müsse, wenn die in Ansatz
gebrachten ärztlichen Honorare ohne alle Rücksicht auf die
unzureichenden Mittel der Kasse festgehalten würden. An-
gesichts dieser Zwangslage seien die Kasscnvorstände nicht nur
bcrechtigt, sondern sogar verpflichtet, in derselben Weise
vorzugehcn, wie dic Aerzte, und im äußersten Falle würde
auch Nichts dagegen einzuwenden sein, wenn sie sich eine
ihren Bedürfnissen entsprechende ärztliche Bedienung auf
dem Wege der Submission verschafften! Zum Schluffe
gibt der Herr Minister dem Wunsche nach einer güt-
lichen Verständigung zwischen Aerztevereinen
und Krankenkassen Ausdruck, indem er zugleich
dic Hoffnung ausspricht, daß die Aerzte den
Schwierigkeiten, mit denen die Krankenkassen im Anfang
noch zu kämpfen haben, Rechnung tragen und ihre For-
derungen den Kräften der Kassen auch in solchen Fällen
anpassen würden, in denen die Vergütung mit der Mühe-
waltung nicht in Einklang stehe. Andererseits müßten
die Kassen, sobald es ihre Mittel gestatten, selbstverständ-
lich zu einer der ärztlichen Mühewaltung voll entsprechen-
den Vergütung sich verstehen.
Jn den Kreisen dcr Angehörigen der Krankenkaffen
wird diese Antwort des Ministers Befriedigung hervor-
rufen, und auch von den Aerzten der Krankenkaffen dürfte
zugegeben werden, daß der Minister keine unbilligen Ge°
sichtspunkte aufgestellt hat.
1 Bcrlin, 30. Juli. Die Nachrichten aus Gastcin über
das Befinden des Kaisers lauten andauernd recht befriedigend.
Der Kronprinz hatte sich gestern durch ein brennendes
Strcichholz eiue Verletzung dcr Hand zugezogen. Weil er die
Verletzung vielleicht nicht für unbedenklich halten mochte, suchte
er sosort die chirurgische Klinik auf, wo von dem anwesenden
Assistenzarztc die Verktzung als eine glücklicherweise nur unbe-
deulende bezeichnet wurde, wenn auch cin Verband ange-
legt wurde.
Der König und die Königin von Sachsen waren gestern
früh im strengsten Jnkognito vonDresden nach Berlin gekommcn,
um die Jubiläums-Kunstausstellung in Augenschein zu nehmen.
Minister v. Böttichcr, welcher den ersten Theil seineS
Sommerurlaubs bei dem ihm besreundeten Baron v. Boden-
hausen aus Radies in der Provinz Sachsen zugebracht, wird sich
in den nächsten Tagen zur Kur nach Gastein begeben.
Der heutige ,Staatsanzeiger' veröffentlicht einen allerhöchsten
Erlaß vom 26. Juli d. I., worin der Kommission für d euts che
Ansiedlungen in dm Provinzen Westpreußen und Posen die
Stadt Posen als Sitz angewiesen wird.
Jn berliner Blättern finden wir die Nachricht, daß
der Oberbürgermeister von Franksurt a.- M., Miquel,
Bcrlin wieder verlassen habe. Ueber den Zweck des
berliner Aufeuthalts ist Näheres nicht an die Oeffent-
lichkeit gedrungen, jedoch scheint es nicht ausgeschloffen,
daß Herr Miquel an der in den jüngsten Tagen
stattgehabtcn Erledigung von Ausführungsbestimmungen zum
antipolnischen Kolonisationsgesetze zu Rathe gezogen
worden ist. Herr Miquel, von dem bekanntlich unter gleich-
zeitiger Vcrständigung mit dcr Regicruug die Resolution Ächen-
bach verfaht worden ist, wurde vor längerer Zeit vielfach als
designirter Borsitzendcr dcr Kolonisationskommission bezeichnet;
doch scheint derselbe für die Uebernahme dieses Postens keine
Ncigung gehabt zu haben.
Die evangelischen kirchlichen Behörden in Wittenberg
haben ihre Zustivnnung dazu versagt, daß das herrichsche Luther-
festspicl in der Stadtkirche zu Wittcnberg zur Aufführung gebracht
werdcn, und in gemeinschasilicher Sitzung dcn einstimmigen Be-
schluß gesaßt, daß die Kirche, welche die Jnschrift trägt: „Mein
Haus ist ein Bethaus" unter keinen Umständen zu den gedachten
Zwecken hergegeven werden soll. Jn der evangelischen Bürger-
Ferriüetom
6 Um Abend.
Erzählung von Hermann Schueider.
(Fortsetzung aus dem ersten Blatt.)
„Wir sind Beide am Ziele, denn ich wohne ganz in
der Nähe," antwortete ihr Begleiter. „Darf ich das
Recht der Nachbarschaft für mich in Anspruch nehmen
und Jhnen meine Aufwartung machen?" fügte er bittend
hinzu, indem er ihr seine Karte überreichte. „Alfred
Düllberg, Asseffor," stand darauf.
Elisabeth zögerte mit der Antwort, es war ihr, als
warne sie Etwas, diese ncue Erscheinung in ihren Lebens-
kreis treten zu lassen; aber ein Blick in das mit ängst-
licher Spannung auf sie gerichtete Gesicht ihres Begleiters
machte ihrem Schwanken ein Ende.
„Lassen Sie sich bei Fräulein Elisabeth Schönian
mclden," sagte sie mit freundlichem Tone und entfernte
sich mit einem leichten Neigen des Kopfes.
Alfred Düllberg machte schon am folgenden Tage von
der ihm ertheilten Erlaubniß Gebrauch, und schnell ent-
spann sich zwischen Beiden ein reger Verkehr, wie dies
nur in einem Badeort möglich ist, wo jeder in gewissen
Grenzen größere gesellschaftliche Freiheit besitzt. Man
sah das nngleiche Paar am Brunnen und auf den Pro-
menaden nebeneinander, noch weit öftcr gab aber die
gleichzeitige Unsichtbarkeit Beidcr zu der Vermuthung An-
laß, baß sie einen Ausflug unternommen haben müßten, und
man traf mit dieser Annahme in der Regel das Richtige.
Natürl.cy feylte es nicht an spöttischen und boshaften
Bemerkungen über die „Unzertrennlichen", denen ein be-
lesenes Fräulein nach dem berühmten Roman der Frau
von Staöl die Namen „Corinna" und „Oswald" beige-
legt hatte. Man spürte ihnen, nicht selten in übel-
wollender Gesinnung, nach, sie lieferten ausgiebigsten und
unter diesen meist oberflächlichen und gelangweilten Leuten
den beliebtesten Unterhaltungsstoff. Sie selber befanden
sich in vollständiger, glücklicher Unwiffenheit über den
Antheil, den Jung und Alt an ihnen nahm.
Alfred war in einem Zustande körperlicher und
geistiger Abspannung, der ihn gleichgültig gegen Alles,
was um ihn vorging, machte. Gleich einem Ertrinkenden
hatte er nach der rcttenden Hand gegriffen, Welche sie
ihm bot; was kümmerte ihn da die Erwägung, wie dem
Auge dcs Zuschauers ein solches Schauspiel erscheinen
werde? Was aber Elisabeth anbetraf, so besaß sie gar
keine Vorstellung davon, daß ein gemessener freundschaft-
licher Verkehr zwischen einem Herrn und einer Dame bei-
nahe unansbleiblich der Nachrede zum Opfer fallt.
Für sie war der ncugewonnene Freund zunächst ein
Gegenstand des innigsten Mitleids. Reich begabt von
der Natur, von gnter Fumilie, mit Glücksgütcrn bedacht,
im Besitze aller Bedingnngen, welche eine glänzende Zu-
kunft zu verheißen scheinen, war Alfred Düllberg in einem
Alter von 28 Jahren durch eigene und frcmde Schuld
in einen Zustand versetzt, dei ihn nicht viel mehr vom
Leben erwarten ließ. Er War seit längerer Zeit leidend,
und zudem, eincm ungläubigcn philosophischen System an-
heimgefallen, ein vollständiger Pessimist geworden. Nach
Elisabeths Auffassung befand sich Alfred Düllberg in
einer ernsten, entscheidcnden Krisis, und sie glaubte sich
durch eine höhere Fügung berufen, ihm in dieser verhäng-
nißvollen Lebensepoche zur Seite zu stehen, über ihn zu
wachen und ihn mit Ernst und Sicherheit auf die Bahn,
aus welcher er geschleudert worden war, zurückzugeleiten.
Die Oede, welche sie nach dem Tode des Onkels
drückend empfunden hatte, schien von ihr genommen zu
sein. Sie glaubte eine hohe Aufgabe gefuuden zu haben
und fühlte sich clastisch und frisch, frischer als je zuvor.
Dcr dem Weibe eingeborene Zug der Mütterlichkeit machtc
sich auch bci ihr geltend. Alfred Düllberg erschien ihr
wie ein ihrer Obhut anvertrauter jüngerer Bruder, mit
dem sie um so harmloser und unbefangener verkehren
durfte, als sie sich gegen ihn wie ein Matrone vorkam.
Länger, viel länger als sie ursprünglich beabsichtigt,
hatte, dehnte Elisabeth ihren Ausenthalt in dem Kurorte
ans. Die Gesellschaft daselbst hatte schon mehrmals
gcwechselt, sie war geblieben. Wohl fühlte sie sich voll-
ständig hergestellt, aber ihr Freund hatte seine Kur uoch
nicht beendet, und wollte sie deren Erfolg nicht in Frage
stellen, so durfte sie nicht abreisen und ihn seinem Schick-
sale überlassen.
Nicht mit eincm Male und zusammenhängend, sondern
nach und nach und bruchstückweise hatte Elisabeth Alfreds
Geschichte erfahren, sie war traurig genng und doch so
alltäglich.
Früh verwaist, ohne Religion erzogen, niit einundzwanzig
Jahren unbeschränkter Herr cines ansehnlichen Vermögens,
mit reichen Geistesgaben, abcr auch mit ciner leicht er-
regbaren Phantasie ausgestattet, war es nur natürlich,
daß er, nachdem er sein zweites großes Examen bestanden
hatte, zweck- und schrankenlos die Welt durchstreifte, keine
ernstliche, auch dem Reicheren wohl anstehende Thätigkeit
aufnehmen wollte. Sein ursprünglich edles Naturell
bewahrte ihn aber vor dem Versinken in den Schlamm
dcr Ausschweifungen.
Endlich schien es, als solle die Liebc ihn von dem
Pfade, den er eingeschlagen und der im weiteren Verlaufe
doch bedenklich werden konnte, ablenken und auf geregelte
Bahncn führen. Bei einem Besuche in seiner Heimath
sah er die Tochter eines Vetters, die er als Kind ver-
laffen hatte, als reizend erblühtes Mädchen wieder und
fühlte sich von ihr gefesselt. Adele schien seine Neigung
zu erwidern, und die Eltern warcn mit der Werbung
des wohlhabenden jungen Mannes einverstanden, obgleich
der Vater, Major in einem Jnsanterieregimente, mcht
verhehlte, daß cr gehofft hatte, die einzige Tochter einmal
als die Gattin eines Militärs zu sehen.
Alfred wandte sich also der juristischen Karriere
wieder zu, und, glücklich sich in den Zukunftsbildern
wiegend, wandte er sich auch den geselligen Kreisen der
Stadt zu, um bald als einer der muntersten Gesellschafter
I bekannt zu sein. Plötzlich sandte ihm der Major den
Aachcn 1888. — Rr. 174 — 38. JahrMg.
Chefredakt->ur: Hubcr' Jmnrelen.
Verantwortlicher Medaktcnr: Hiunar Hemrich Beissel.
Telegrammadrefle r Echo, Aache«. — Telephoua«schl«ß Nr. 6S.
Berlog von P. Kaatzer in Aachen.
Druck von He mann Kaatzer in Aachen.
Das ,Echo der Gegenwarth cingetragen im Post-Zeitungs-Preiskurant unter Nr. 1601, erscheint, Montags ausgenommen,
täglich zwcimal. Preis bei allen Postämtern des deutschen Reiches, Ocsterreich-Ungarn und Lnxemburg nur 4 Mark. Extra-
Abonnement auf die Sonntagsnummer, eingetragen im Post-Zcitungs.Preiskurant unter Nr. 1602, vierteljährlich 75 Pfg.
Anzeigen findcn durch das ,Echo der Gegenwart', desscn Bcrbreitung von keinem and cen hiesigen Blatte erreicht wird,
im ganzen Regicrungsbezirk Aachcn die wcitestc und erfolgreichste Vcrbreitung. Die Gebüren oetragen 15 Pfg. pro Zeile. Alle
Annoncenexpeditionen des Jn- und Auslandes nehmen Anzeigen für das ,Echch an.
^ Herr von Schlözer
soll nach einer Annahme der ,Nat.-Ztg/ augenblicklich
über die abschließende Revision der Maigesetze,
welche von der preußischen Regierung versprochen wvrden
ist, mit dem h. Stuhl in Unterhandlungen stehen.
Das „liberale" Blatt schließt auf diese Verhandlungen
aus dem Umstande, daß Herr von Schlözer noch immer
in Rom weile und über deu Beginn seines üblichen
Sommerurlaubes noch Nichts verlaute, obschon die
laufendcn Geschäfte seine Anwcsenheit nicht mehr crfor-
derten. Lcider beruht die erfceuliche Nachricht der ,Nat.-
Ztg? bloß auf dieser Schlußfolgerung, nicht auf einer
zuverlässigcn Mittheilung. Die Sache steht also keines-
wegs außer Zweifel; denn es ist immerhin dcnkbar, daß
Verhandlungen über Einzelfragen, die sich auf Amts-
besetzungen oder die Ausführung des letzten kirchcnpoli-
tischen Gesetzes beziehen, Herrn von Schlözcr über die
gewöhnliche Zeit hinaus in Rom festgehalten haben.
Daher würde es uns sehr lieb sein, wenn die Offiziöscn
etwas Bestimmtes über die Sachlage mittheilten. Der
Wunsch ist um so mehr gerechtfertigt, als bisher außcr
der erwähnten Vermuthung Nichts über den Anfang oder
den Fortgang der fraglichen Verhandlungen verlautet hat.
Für alle preußischcn und auch für manche außer-
preußischen Katholiken (z. B. die hessischen) ist die
Schlußrevision der Maigesetze die wichtigste von allen
fchwebenden öffentlichen Angelegenheiten. Sogar viel
wichtiger als die vielbesprochene b ay erische Ministerfrage.
Jn Bayern handelt es sich um das Wie? und Wann?,
in Preußen aber um das Ob? Denn von der Schluß-
revisivn hängt nicht allein der höhere oder geringere
Grad des Friedens ab, sondern überhaupt die Mög-
lichkeit eines dauernd friedlichen Zusammenlebens zwi-
schen Staat und Kirche. Wenn die Schlußrevision nicht
zuStande kommt, so bleibt es keineswegs bei dem jetzi-
gen Zustande, sondern dann entbrcnnt wieder der
alte Kampf mit all' seinem Unheil und seincn Gefahren
für Staat und Volk, für Glauben, Sitte, Ordnung und
Wohlstand.
Die Anzeige ist von Rom nur bedingungs-
weise zugestanden worden. Wenn die Bedingung dcr
Schlußrevision nicht erfüllt wird, so muß der hl. Stuhl
die Erlaubniß zur Anzeige zurückziehen. Manche
„Kulturkämpfer" werden nun lcichthin behaupten, daß
dcr Papst eine solche Maßnahme nicht wagen werde.
Sie irren sich sehr; der hl. Stuhl würde es thun, weil
er es thuu muß. Diese Spekulanten auf die absvlute
Friedensliebe des hl. Stuhls haben keine Jdce von dem
Äou possninus, welches die Grundsätze und die
Lebensinteressen der hl. Kirche auch dem aller-
friedfertigsten Papste in den Mund legen, wenn eine
gewisse Grcnze von den staatlichen Faktoren und durch
ihre Forderuugen überschritteu wird. Als das letzte
kirchenpolttische Gesetz zur Berathung stand, hat man von
gegnerischer Seite andauernd darauf spekulirt, daß der
hl. Stuhl als Prcis für dieses Gesetz die maigesetzliche
Anzeigepflicht bewilligen würde. Die kath. Presse hat darauf
fort und fort erwidert: daß 1. die maigesetzliche
Anzeige mit dem uneingeschräukten staatlichen Beto
Nicmals zugestanden wcrden könne, und daß 2. auch
die Erleichterungdn des vorliegenden Gesetzes nvch nicht
ausrcichend seien, auf daß Rom daraufhin die Anzeige
in dcn vom Papste als möglich bezeichneten Grenzen be-
willigen könnte. Man wollte uns nicht glauben, aber
die Thatsachen haben uns Recht gcgcben. Trotz des
diplomatischen Spiels, Welches das Herrenhaus er-
möglichte, trotz der Drohung: das ganze Gesetz scheitern
zu lassen, hat Rom die maigcsetzliche Anzcige nicht bewilligt,
es hat sich zur vorläufigen Anzeige ohne staatliches
Veto nur auf Grund des Versprechens einer
weiteren abschließenden Revision bereit erklärt.
Nach dieser Erfahrung könnten die Gegner doch einsehen,
daß wir für die Grenze des Möglichen und des Unmög-
lichen in kirchlichen Dingen ein feincres Gefühl be-
sitzen als sie. Das ist kein Eigenlob, sondcrn die Fest-
stellung einer ganz natürlichen, selbstverständlichcn
Thatsache.
Die Offiziösen und ihre Helfershelfer suchen bekannt-
lich der Welt weiszumachen, daß das Centrum den
Friedeu nicht wolle. Alle Katholiken sind nun aber einig
in dem Wunsche, daß die den Frieden sichernde Revision,
welche wir seit langen Jahren immer von Neuem ge-
fordert haben, möglichst bald zu Stande kommen
möge. Augenblicklich ist das Eisen noch warm und es
kann geschmiedet werden. Nach dem glücklichen Verlauf
der letzten kirchenpolitischen Gesetzgebungsarbeit und uach
der ungestörten Entwickelung dcr Ausführung dieses Ge-
setzes sind die Gemüther in den „konservativen" und
„liberalen" Krcisen zumeist nochgeneigt, „die Sachc zu Ende
zu bringen." Wer kann wissen, wie lange dicse dem
Frieden günstige Stimmung anhält? Das nächste Jahr
bringt Neuwahlen zum Reichstage, bei welchen
die konfessionellen und politfichen Gegensätze sich leicht
verschärfen. Es bringt auch Neuwahlen in Bayern,
wo sich cine auf die norddeutschen Stimmungcn zurück-
wirkende Agitation entfalten wird. Dic politische
Meteorologie läßt Stürme für nächsten Herbst ver-
muthen; bringen wir also vorher das zarte und so
werthvolle Gut des kirchenpolitischen Friedens, des kirchen-
Politischen Ausgleichs, in Sicherheit!
Die Gouvernementalen behaupten, daß der Abschluß
des kirchenpolitischen Fricdens dem Bcstande des Centrums
„gefährlich" sein würde. Wohlan, wenn sie das wirk-
lich glauben, so können sie ja dahin wirken, daß noch
vor den nächsten Wahlen die Sache geregelt wird! Sie
können uns keinen größeren Gefallen thun, als wenn sie
den Frieden recht schnell und recht gut machen, also
eine recht gründliche Probe auf ihr parteipolitisches Rcchen-
exempel crmöglichen. Wir wollen aber nur einen w ahren,
soliden und dauerhaften Frieden. Das Weitere
wird sich dann später schon finden.
Deutsches Reich.
* Verlin, 29. Juli. Es scheint, daß jede Ersatz-
wahl zum Reichstage in Norddeutschland jetzt zu einem
Konflikt zwischen den Nationalliberalen und „Konserva-
tivcn" führt, und da der häusliche Streit zwischen den
beiden Theilen der „nationalen Mehrhcit" für die außer-
halb diescs schönen Bundes Stehenden ein unterhaltendes
Schauspiel ist, könnte man, schreibt ironisch die ,Frankf
Ztg.', fast bedauern, daß die Politische Sommerstille nicht
noch durch einige Ersatzwahlen mehr unterbrochen wird.
Jn Lauenburg hat sich nach heftigen Zeitungsfehdcn das
Berhältniß zwischen den „Konservativeu" und den Na-
tionalliberalen als unheilbar herausgestellt, da die Letzteren
nicht für den Kandidaten der vereinigten „Konservativen",
den Grafen Bernstorff, stimmen wollen. Jetzt gerathcn
sie sich im Wahlkreise Graudenz-Strasburg in die
Haare, wo demnächst für dcn verstorbenen Abgeordneten
v. Lyskowski eine Ersatzwahl stattzufinden hat. Die
Nationalliberalen stellen gegcn den polnischen Kandidaten,
dessen Name noch nicht bekannt ist, Herrn Hobrecht auf,
und es scheint, daß die im Wahlreise wohnenden Dcutsch-
freisinnigen sich verpflichtet haben, diese Kanlndatur zu
unterstützen. Thucn die „Konservativen" dasselbe, so hat
Herr Hobrecht einige Aussicht, gewählt zu werden. Der Wahl-
kreis zählt 54 Prozent polnischc und deutsche Katholiken,
die wohl nicht wie früher so auch diesmalsich alle aufeinen Pol-
nischen Kandidaten einigen wcrden. Der Kreis wär bis
zum Jahre 1881, also noch während der Blüthe des
„Kulturkampfes", durch cinen Nationalliberalen vertreten;
erforderlich wäre heute, damit der Sieg der Mischmasch-
partei erzielt werde, daß die „Konservativen" für Herrn
Hobrecht cinträten. Nach den Auslassungen dcr ,Kreuz-
zeitung' scheint das allerdings nicht der Fall sein zu
sollcn. Dieselbe beschwert sich heute, daß die National-
libcralen in Graudenz-Strasburg mit derselben „Anmaß-
lichkeit" auftrcteu wie in Lauenburg. und mcint, daß
die Aufstellung eines „Kulturkämpfers" wie Hobrecht
die dcutschen Katholiken den Polen zutreibe, wäh-
rend sie für einen streng „Konservativen" zu haben
geweseu wärcn. Man darf gespannt sein, wie sich
die ' „konservativen" Wähler des Kreises gerade
jetzt, wo die Bekämpfung des Polenthums
für das „vornehmste nationale Verdienst" gilt, verhaltcn
wcr^cn. Jedenfalls ist die scharfe Gegnerschaft, die sich
bci ixdem Anlaß zwischen den „Konservativen" und den
Nat.onalliberalcn herausstellt, ein intercssantes Symptom
für die wahre Gesinnung der beiden Parteien gegen
einander, welche als Regierungsparteien auftreten. Der
Fall ist um so markanter, weil sonst in den polnischen
Landestheilen die Einigung der „deutschen" Parteien gegen
die Polen sich meist ohne Schwierigkeit vollzieht. Erlebt
man doch bei jeder Wahl zum Abgeordnetenhause in
einigen posenschen und westpreußischen Kreisen das seltene
Schauspiel, daß sogar die „Konservativen" und die
Deutschfreisinnigen sich einigen. So ist z. B. der Wahl-
kreis Lissa-Fraustadt sowohl bei dcn letzten Wahlen
wie im Jahre 1882 den Polen nur dadurch entrissen
worden, daß die „liberalen" und „konservativen" Dcut-
schen in diesem Kreise, der drei Abgeordnete zu wählen
hat, sich auf einen alten Fortschrittler, einen Frcikonser-
vativen und einen „Konservativen" einigten. Dort hat
damals thatsächlich der „konservative" Landrath in
Wählerversammlungen zu Gunsten des fortschrittlichen
Kandidaten gesprochen. Jm Wahlkreise Bromberg, wo
demnächst ebenfalls eine Ersatzwahl zum Reichstage statt-
findet, werden sich auch die Nationalliberalen von den
„Konservativen" trennen und für den deutschfreisinnigen
Kandidaten, den früheren Abg. Schroeder, eintreten, wel-
chcm der „konservative" Oberlandesgerichtsrath und frühere
Landtagsabgeordnete Hahn gegenübersteht; wenigstens ist
für Schroeder ein Aufruf der „vereinigten liberalen
Parteicn" erschienen. Es ist möglich, daß auf diese Weise
üer Wahlkreis, der bis 1884 von einem Fortschrittler
vertreten war, den „Konservativen" wieder «itrissen wird.
Der Borgang ist immerhin bemerkenswerth angesichts dcr
Thatsache, daß bei den letzten Reichstagswahlen aus-
nahmslvs die „Konservativen" und die Nationalliberalen
gegen die Deutschfreisinnigen zusammengingen. Allerdiugs
chaben die kleinen Reste der nationalliberalen Partei, die
ffcki in dcn östlichen preußischen Provinzen noch erhalten
haben, sich nie zu einem solcheu Haß gegen oie Deutsch-
sreisinnigen verstiegen, wie das Heidelbergerthum im
übrigen Deutschland.
hi Bcrlin, 30. Juli. Der Staatssekretär
v. Bötticher unterzog bekanntlich im Reichstage im
Dczember v. I., als von den Erfahrungen, welche bei
Ausführung des Krankenkassengesetzes gemacht worden
sind, die Rede war, das Verhalten mancher Aerzte
gegenüber den Krankcnkasscn einer abfälligen
Kritik. Besonders mußten die Koalitionen der Aerzte,
vor Allem der deutsche Aerztevereinsbund, welche ein
gemeinsames Vorgehen und die Uebernahme der Kranken-
kaffen nach glcichen, nicht unter ein bestimmtes Minimum
hcruntergehenden Bedingungeu beschlossen hatten, den leb-
haftesten Tadel des Ministers v. Böttichcr hinnehmen. Der
Geschäftsausschuß des deutschen Aerztevercinsbundes wandte
sich darauf in eincr Denkschrift au den Reichstag,
in welchem derselbe die thatsächlichen Verhältuisse über
die Hvnorirung der Aerzte bei den Krankenkassen klar-
legte. Auf diese Denkschrift hat nun Minister v. Bötticher
unter dem 8. Juli d. I. cine Antwort an den Gc-
schäftsausschuß gelangen lasscn, worin cr crklärt, daß er
die schwierige Lcge, in welche einzelne Krankenkasscn gc-
rathen sind, keineswegs ausschließlich oder auch nur vor-
zugsweise auf die zu hohen Kosten der ärztlichen Be-
handlung zurückgeführt habe. Jn Betreff der Koalition
der Aerzte zum Zweck der Preisfixirung verharrt Herr
v. Bötticher bei sciner abfälligcn Kritik, indem er anführt,
daß Fälle vorlägen, wo für Kassen, welche einen
größcren Bezirk mit einem oder wenigen Aerzten
umfaffen, die Bezahlung der Einzelleistung uner-
schwinglich zu werden drohe. Da die Krankenkassen bei
dürftiger Lage und folgenweise niedrigster Beitragsleistung
ihrer Mitglieder gesetzlich gezwungen seien, denselben freie
ärztliche Hülfe zu gewähren, so befanden sie sich der
Koalition der Aerzte gegenüber in einer Zwangslage,
welche zu ihrem Rnin führen müsse, wenn die in Ansatz
gebrachten ärztlichen Honorare ohne alle Rücksicht auf die
unzureichenden Mittel der Kasse festgehalten würden. An-
gesichts dieser Zwangslage seien die Kasscnvorstände nicht nur
bcrechtigt, sondern sogar verpflichtet, in derselben Weise
vorzugehcn, wie dic Aerzte, und im äußersten Falle würde
auch Nichts dagegen einzuwenden sein, wenn sie sich eine
ihren Bedürfnissen entsprechende ärztliche Bedienung auf
dem Wege der Submission verschafften! Zum Schluffe
gibt der Herr Minister dem Wunsche nach einer güt-
lichen Verständigung zwischen Aerztevereinen
und Krankenkassen Ausdruck, indem er zugleich
dic Hoffnung ausspricht, daß die Aerzte den
Schwierigkeiten, mit denen die Krankenkassen im Anfang
noch zu kämpfen haben, Rechnung tragen und ihre For-
derungen den Kräften der Kassen auch in solchen Fällen
anpassen würden, in denen die Vergütung mit der Mühe-
waltung nicht in Einklang stehe. Andererseits müßten
die Kassen, sobald es ihre Mittel gestatten, selbstverständ-
lich zu einer der ärztlichen Mühewaltung voll entsprechen-
den Vergütung sich verstehen.
Jn den Kreisen dcr Angehörigen der Krankenkaffen
wird diese Antwort des Ministers Befriedigung hervor-
rufen, und auch von den Aerzten der Krankenkaffen dürfte
zugegeben werden, daß der Minister keine unbilligen Ge°
sichtspunkte aufgestellt hat.
1 Bcrlin, 30. Juli. Die Nachrichten aus Gastcin über
das Befinden des Kaisers lauten andauernd recht befriedigend.
Der Kronprinz hatte sich gestern durch ein brennendes
Strcichholz eiue Verletzung dcr Hand zugezogen. Weil er die
Verletzung vielleicht nicht für unbedenklich halten mochte, suchte
er sosort die chirurgische Klinik auf, wo von dem anwesenden
Assistenzarztc die Verktzung als eine glücklicherweise nur unbe-
deulende bezeichnet wurde, wenn auch cin Verband ange-
legt wurde.
Der König und die Königin von Sachsen waren gestern
früh im strengsten Jnkognito vonDresden nach Berlin gekommcn,
um die Jubiläums-Kunstausstellung in Augenschein zu nehmen.
Minister v. Böttichcr, welcher den ersten Theil seineS
Sommerurlaubs bei dem ihm besreundeten Baron v. Boden-
hausen aus Radies in der Provinz Sachsen zugebracht, wird sich
in den nächsten Tagen zur Kur nach Gastein begeben.
Der heutige ,Staatsanzeiger' veröffentlicht einen allerhöchsten
Erlaß vom 26. Juli d. I., worin der Kommission für d euts che
Ansiedlungen in dm Provinzen Westpreußen und Posen die
Stadt Posen als Sitz angewiesen wird.
Jn berliner Blättern finden wir die Nachricht, daß
der Oberbürgermeister von Franksurt a.- M., Miquel,
Bcrlin wieder verlassen habe. Ueber den Zweck des
berliner Aufeuthalts ist Näheres nicht an die Oeffent-
lichkeit gedrungen, jedoch scheint es nicht ausgeschloffen,
daß Herr Miquel an der in den jüngsten Tagen
stattgehabtcn Erledigung von Ausführungsbestimmungen zum
antipolnischen Kolonisationsgesetze zu Rathe gezogen
worden ist. Herr Miquel, von dem bekanntlich unter gleich-
zeitiger Vcrständigung mit dcr Regicruug die Resolution Ächen-
bach verfaht worden ist, wurde vor längerer Zeit vielfach als
designirter Borsitzendcr dcr Kolonisationskommission bezeichnet;
doch scheint derselbe für die Uebernahme dieses Postens keine
Ncigung gehabt zu haben.
Die evangelischen kirchlichen Behörden in Wittenberg
haben ihre Zustivnnung dazu versagt, daß das herrichsche Luther-
festspicl in der Stadtkirche zu Wittcnberg zur Aufführung gebracht
werdcn, und in gemeinschasilicher Sitzung dcn einstimmigen Be-
schluß gesaßt, daß die Kirche, welche die Jnschrift trägt: „Mein
Haus ist ein Bethaus" unter keinen Umständen zu den gedachten
Zwecken hergegeven werden soll. Jn der evangelischen Bürger-
Ferriüetom
6 Um Abend.
Erzählung von Hermann Schueider.
(Fortsetzung aus dem ersten Blatt.)
„Wir sind Beide am Ziele, denn ich wohne ganz in
der Nähe," antwortete ihr Begleiter. „Darf ich das
Recht der Nachbarschaft für mich in Anspruch nehmen
und Jhnen meine Aufwartung machen?" fügte er bittend
hinzu, indem er ihr seine Karte überreichte. „Alfred
Düllberg, Asseffor," stand darauf.
Elisabeth zögerte mit der Antwort, es war ihr, als
warne sie Etwas, diese ncue Erscheinung in ihren Lebens-
kreis treten zu lassen; aber ein Blick in das mit ängst-
licher Spannung auf sie gerichtete Gesicht ihres Begleiters
machte ihrem Schwanken ein Ende.
„Lassen Sie sich bei Fräulein Elisabeth Schönian
mclden," sagte sie mit freundlichem Tone und entfernte
sich mit einem leichten Neigen des Kopfes.
Alfred Düllberg machte schon am folgenden Tage von
der ihm ertheilten Erlaubniß Gebrauch, und schnell ent-
spann sich zwischen Beiden ein reger Verkehr, wie dies
nur in einem Badeort möglich ist, wo jeder in gewissen
Grenzen größere gesellschaftliche Freiheit besitzt. Man
sah das nngleiche Paar am Brunnen und auf den Pro-
menaden nebeneinander, noch weit öftcr gab aber die
gleichzeitige Unsichtbarkeit Beidcr zu der Vermuthung An-
laß, baß sie einen Ausflug unternommen haben müßten, und
man traf mit dieser Annahme in der Regel das Richtige.
Natürl.cy feylte es nicht an spöttischen und boshaften
Bemerkungen über die „Unzertrennlichen", denen ein be-
lesenes Fräulein nach dem berühmten Roman der Frau
von Staöl die Namen „Corinna" und „Oswald" beige-
legt hatte. Man spürte ihnen, nicht selten in übel-
wollender Gesinnung, nach, sie lieferten ausgiebigsten und
unter diesen meist oberflächlichen und gelangweilten Leuten
den beliebtesten Unterhaltungsstoff. Sie selber befanden
sich in vollständiger, glücklicher Unwiffenheit über den
Antheil, den Jung und Alt an ihnen nahm.
Alfred war in einem Zustande körperlicher und
geistiger Abspannung, der ihn gleichgültig gegen Alles,
was um ihn vorging, machte. Gleich einem Ertrinkenden
hatte er nach der rcttenden Hand gegriffen, Welche sie
ihm bot; was kümmerte ihn da die Erwägung, wie dem
Auge dcs Zuschauers ein solches Schauspiel erscheinen
werde? Was aber Elisabeth anbetraf, so besaß sie gar
keine Vorstellung davon, daß ein gemessener freundschaft-
licher Verkehr zwischen einem Herrn und einer Dame bei-
nahe unansbleiblich der Nachrede zum Opfer fallt.
Für sie war der ncugewonnene Freund zunächst ein
Gegenstand des innigsten Mitleids. Reich begabt von
der Natur, von gnter Fumilie, mit Glücksgütcrn bedacht,
im Besitze aller Bedingnngen, welche eine glänzende Zu-
kunft zu verheißen scheinen, war Alfred Düllberg in einem
Alter von 28 Jahren durch eigene und frcmde Schuld
in einen Zustand versetzt, dei ihn nicht viel mehr vom
Leben erwarten ließ. Er War seit längerer Zeit leidend,
und zudem, eincm ungläubigcn philosophischen System an-
heimgefallen, ein vollständiger Pessimist geworden. Nach
Elisabeths Auffassung befand sich Alfred Düllberg in
einer ernsten, entscheidcnden Krisis, und sie glaubte sich
durch eine höhere Fügung berufen, ihm in dieser verhäng-
nißvollen Lebensepoche zur Seite zu stehen, über ihn zu
wachen und ihn mit Ernst und Sicherheit auf die Bahn,
aus welcher er geschleudert worden war, zurückzugeleiten.
Die Oede, welche sie nach dem Tode des Onkels
drückend empfunden hatte, schien von ihr genommen zu
sein. Sie glaubte eine hohe Aufgabe gefuuden zu haben
und fühlte sich clastisch und frisch, frischer als je zuvor.
Dcr dem Weibe eingeborene Zug der Mütterlichkeit machtc
sich auch bci ihr geltend. Alfred Düllberg erschien ihr
wie ein ihrer Obhut anvertrauter jüngerer Bruder, mit
dem sie um so harmloser und unbefangener verkehren
durfte, als sie sich gegen ihn wie ein Matrone vorkam.
Länger, viel länger als sie ursprünglich beabsichtigt,
hatte, dehnte Elisabeth ihren Ausenthalt in dem Kurorte
ans. Die Gesellschaft daselbst hatte schon mehrmals
gcwechselt, sie war geblieben. Wohl fühlte sie sich voll-
ständig hergestellt, aber ihr Freund hatte seine Kur uoch
nicht beendet, und wollte sie deren Erfolg nicht in Frage
stellen, so durfte sie nicht abreisen und ihn seinem Schick-
sale überlassen.
Nicht mit eincm Male und zusammenhängend, sondern
nach und nach und bruchstückweise hatte Elisabeth Alfreds
Geschichte erfahren, sie war traurig genng und doch so
alltäglich.
Früh verwaist, ohne Religion erzogen, niit einundzwanzig
Jahren unbeschränkter Herr cines ansehnlichen Vermögens,
mit reichen Geistesgaben, abcr auch mit ciner leicht er-
regbaren Phantasie ausgestattet, war es nur natürlich,
daß er, nachdem er sein zweites großes Examen bestanden
hatte, zweck- und schrankenlos die Welt durchstreifte, keine
ernstliche, auch dem Reicheren wohl anstehende Thätigkeit
aufnehmen wollte. Sein ursprünglich edles Naturell
bewahrte ihn aber vor dem Versinken in den Schlamm
dcr Ausschweifungen.
Endlich schien es, als solle die Liebc ihn von dem
Pfade, den er eingeschlagen und der im weiteren Verlaufe
doch bedenklich werden konnte, ablenken und auf geregelte
Bahncn führen. Bei einem Besuche in seiner Heimath
sah er die Tochter eines Vetters, die er als Kind ver-
laffen hatte, als reizend erblühtes Mädchen wieder und
fühlte sich von ihr gefesselt. Adele schien seine Neigung
zu erwidern, und die Eltern warcn mit der Werbung
des wohlhabenden jungen Mannes einverstanden, obgleich
der Vater, Major in einem Jnsanterieregimente, mcht
verhehlte, daß cr gehofft hatte, die einzige Tochter einmal
als die Gattin eines Militärs zu sehen.
Alfred wandte sich also der juristischen Karriere
wieder zu, und, glücklich sich in den Zukunftsbildern
wiegend, wandte er sich auch den geselligen Kreisen der
Stadt zu, um bald als einer der muntersten Gesellschafter
I bekannt zu sein. Plötzlich sandte ihm der Major den




