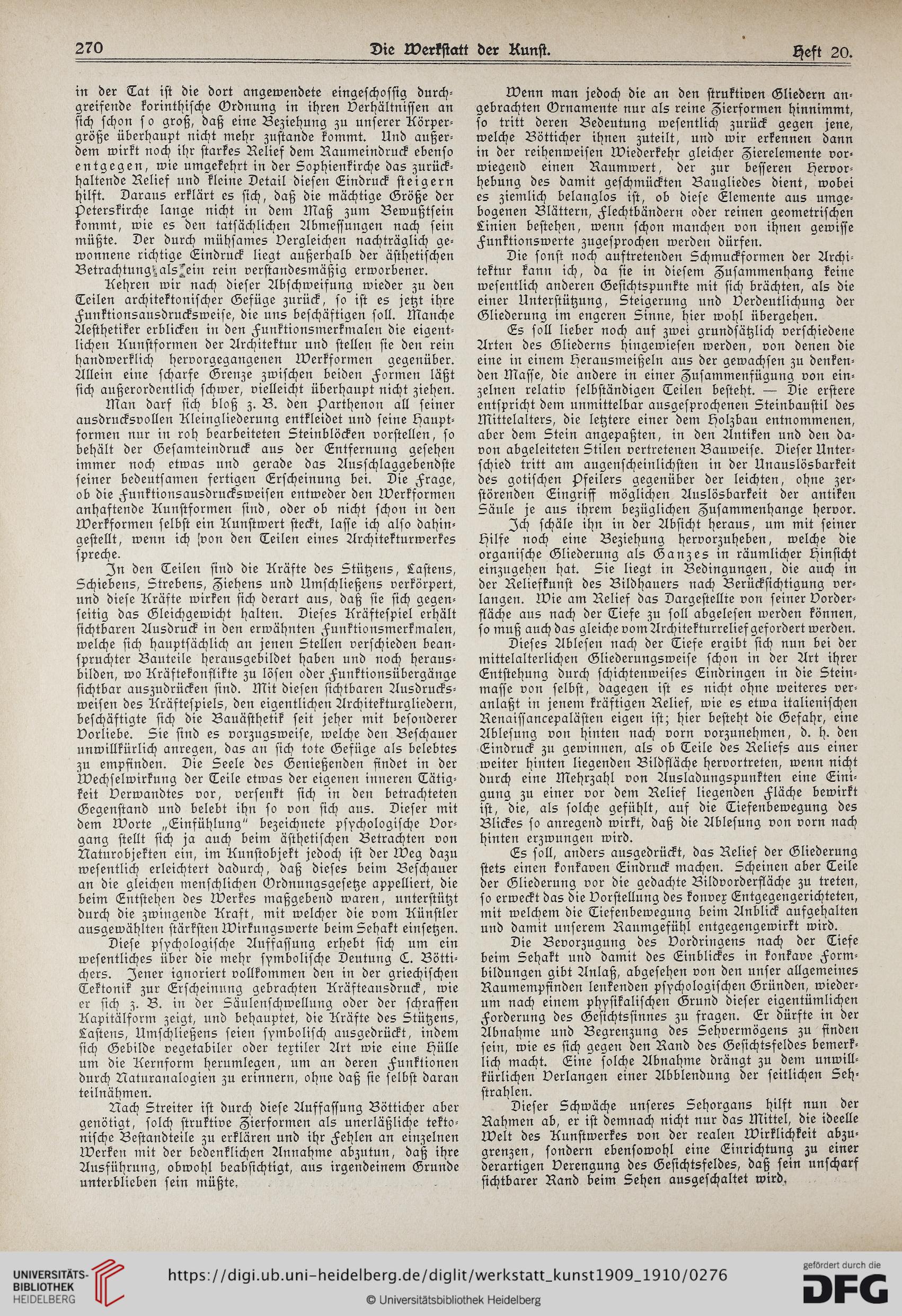270
Die Werkstatt der Kunst.
heft 20.
in der Tat ist die dort angewendete eingeschossig durch-
greifende korinthische Ordnung in ihren Verhältnissen an
sich schon s o groß, daß eine Beziehung zu unserer Körper-
größe überhaupt nicht mehr zustande kommt. Und außer-
dem wirkt noch ihr starkes Relief dem Raumeindruck ebenso
entgegen, wie umgekehrt in der Sophienkirche das zurück-
haltende Relief und kleine Detail diesen Eindruck steigern
Hilst. Daraus erklärt es sich, daß die mächtige Größe der
Peterskirche lange nicht in dem Maß zum Bewußtsein
kommt, wie es den tatsächlichen Abmessungen nach sein
müßte. Der durch mühsames vergleichen nachträglich ge-
wonnene richtige Eindruck liegt außerhalb der ästhetischen
Betrachtung^als^ein rein verstandesmäßig erworbener.
Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu den
Teilen architektonischer Gefüge zurück, so ist es jetzt ihre
Funktionsausdrucksweise, die uns beschäftigen soll. Manche
Aesthetiker erblicken in den Funktionsmerkmalen die eigent-
lichen Kunstformen der Architektur und stellen sie den rein
handwerklich hervorgegangenen Werkformen gegenüber.
Allein eine scharfe Grenze zwischen beiden Formen läßt
sich außerordentlich schwer, vielleicht überhaupt nicht ziehen.
Man darf sich bloß z. B. den Parthenon all seiner
ausdrucksvollen Kleingliederung entkleidet und seine Paupt-
sormen nur in roh bearbeiteten Steinblöcken vorstellen, so
behält der Gesamteindruck aus der Entfernung gesehen
immer noch etwas und gerade das Ausschlaggebendste
seiner bedeutsamen fertigen Erscheinung bei. Die Frage,
ob die Funktionsausdrucksweisen entweder den Werkformen
anhaftende Kunstsormen sind, oder ob nicht schon in den
Werkformen selbst ein Kunstwert steckt, lasse ich also dahin-
gestellt, wenn ich chon den Teilen eines Architekturwerkes
spreche.
In den Teilen sind die Kräfte des Stützens, Lastens,
Schiebens, Strebens, Ziehens und Umschließens verkörpert,
und diese Kräfte wirken sich derart aus, daß sie sich gegen-
seitig das Gleichgewicht halten. Dieses Kräftespiel erhält
sichtbaren Ausdruck in den erwähnten Funktionsmerkmalen,
welche sich hauptsächlich an jenen Stellen verschieden bean-
spruchter Bauteile heransgebildet haben und noch heraus-
bilden, wo Kräftekonslikte zu lösen oder Funktionsübergänge
sichtbar auszudrücken sind. Mit diesen sichtbaren Ausdrucks-
weisen des Kräftesxiels, den eigentlichen Architekturgliedern,
beschäftigte sich die Bauästhetik seit jeher mit besonderer
Vorliebe. Sie sind es vorzugsweise, welche den Beschauer
unwillkürlich anregen, das an sich tote Gefüge als belebtes
zu empfinden. Die Seele des Genießenden findet in der
Wechselwirkung der Teile etwas der eigenen inneren Tätig-
keit verwandtes vor, versenkt sich in den betrachteten
Gegenstand und belebt ihn so von sich aus. Dieser mit
dem Worte „Einfühlung" bezeichnete psychologische Vor-
gang stellt sich ja auch beim ästhetischen Betrachten von
Naturobjekten ein, im Kunstobjekt jedoch ist der Weg dazu
wesentlich erleichtert dadurch, daß dieses beim Beschauer
an die gleichen menschlichen Grdnungsgesetze appelliert, die
beim Entstehen des Werkes maßgebend waren, unterstützt
durch die zwingende Kraft, mit welcher die vom Künstler
ausgewählten stärksten Wirkungswerte beim Sehakt einsetzen.
Diese psychologische Auffassung erhebt sich um ein
wesentliches über die mehr symbolische Deutung L. Bötti-
chers. Jener ignoriert vollkommen den in der griechischen
Tektonik zur Erscheinung gebrachten Kräfteausdruck, wie
er sich z. B. in der Säulenschwellung oder der schroffen
Kapitälsorm zeigt, und behauptet, die Kräfte des Stützens,
Lastens, Umschließens seien symbolisch ausgedrückt, indem
sich Gebilde vegetabiler oder textiler Art wie eine pülle
um die Kernsorm herumlegen, um an deren Funktionen
durch Naturanalogien zu erinnern, ohne daß sie selbst daran
teilnähmen.
Nach Streiter ist durch diese Auffassung Bötticher aber
genötigt, solch struktive Zierformen als unerläßliche tekto-
nische Bestandteile zu erklären und ihr Fehlen an einzelnen
Werken mit der bedenklichen Annahme abzutun, daß ihre
Ausführung, obwohl beabsichtigt, aus irgendeinem Grunde
unterblieben fein müßte.
wenn man jedoch die an den struktiven Gliedern an-
gebrachten Ornamente nur als reine Zierformen hinnimmt,
so tritt deren Bedeutung wesentlich zurück gegen jene,
welche Bötticher ihnen zuteilt, und wir erkennen dann
in der reihenweisen Wiederkehr gleicher Zierelemente vor-
wiegend einen Raumwert, der zur besseren Pervor-
hebung des damit geschmückten Baugliedes dient, wobei
es ziemlich belanglos ist, ob diese Elemente aus umge-
bogenen Blättern, Flechtbändern oder reinen geometrischen
Linien bestehen, wenn schon manchen von ihnen gewisse
Funktionswerte zugesprochen werden dürfen.
Die sonst noch auftretenden Schmuckformen der Archi-
tektur kann ich, da sie in diesem Zusammenhang keine
wesentlich anderen Gesichtspunkte mit sich brächten, als die
einer Unterstützung, Steigerung und Verdeutlichung der
Gliederung im engeren Sinne, hier wohl übergehen.
Es soll lieber noch auf zwei grundsätzlich verschiedene
Arten des Gliederns hingewiesen werden, von denen die
eine in einem Perausmeißeln aus der gewachsen zu denken-
den Masse, die andere in einer Zusammenfügung von ein-
zelnen relativ selbständigen Teilen besteht. — Die erstere
entspricht dem unmittelbar ausgesprochenen Steinbaustil des
Mittelalters, die letztere einer dem polzbau entnommenen,
aber dem Stein angepaßten, in den Antiken und den da-
von abgeleiteten Stilen vertretenen Bauweise. Dieser Unter-
schied tritt am augenscheinlichsten in der Unauslösbarkeit
des gotischen Pfeilers gegenüber der leichten, ohne zer-
störenden Eingriff möglichen Auslösbarkeit der antiken
Säule je aus ihrem bezüglichen Zusammenhänge hervor.
Ich schäle ihn in der Absicht heraus, um mit feiner
Pilse noch eine Beziehung hervorzuheben, welche die
organische Gliederung als Ganzes in räumlicher Pinsicht
einzugehen hat. Sie liegt in Bedingungen, die auch in
der Reliefkunst des Bildhauers nach Berücksichtigung ver-
langen. wie am Relief das Dargestellte von seiner Vorder-
fläche aus nach der Tiefe zu soll abgelesen werden können,
so muß auch das gleiche vom Architekturrelief gefordert werden.
Dieses Ablesen nach der Tiefe ergibt sich nun bei der
mittelalterlichen Gliederungsweise schon in der Art ihrer
Entstehung durch schichtenweifes Eindringen in die Stein-
masse von selbst, dagegen ist es nicht ohne weiteres ver-
anlaßt in jenem kräftigen Relief, wie es etwa italienischen
Renaissancexalästen eigen ist; hier besteht die Gefahr, eine
Ablesung von hinten nach vorn vorzunehmen, d. h. den
Eindruck zu gewinnen, als ob Teile des Reliefs aus einer
weiter hinten liegenden Bildfläche hervortreten, wenn nicht
durch eine Mehrzahl von Ausladungspunkten eine Eini-
gung zu einer vor dem Relief liegenden Fläche bewirkt
ist, die, als solche gefühlt, auf die Tiefenbewegung des
Blickes so anregend wirkt, daß die Ablesung von vorn nach
hinten erzwungen wird.
Ls soll, anders ausgedrückt, das Relief der Gliederung
stets einen konkaven Eindruck machen. Scheinen aber Teile
der Gliederung vor die gedachte Bildvorderfläche zu treten,
so erweckt das die Vorstellung des konvex Lntgegengerichteten,
mit welchem die Tiefenbewegung beim Anblick aufgehalten
und damit unserem Raumgefühl entgegengewirkt wird.
Die Bevorzugung des Vordringens nach der Tiefe
beim Sehakt und damit des Einblickes in konkave Form-
bildungen gibt Anlaß, abgesehen von den unser allgemeines
Raumempfinden lenkenden psychologischen Gründen, wieder-
um nach einem physikalischen Grund dieser eigentümlichen
Forderung des Gesichtssinnes zu fragen. Er dürfte in der
Abnahme und Begrenzung des Sehvermögens zu finden
fein, wie es sich gegen den Rand des Gesichtsfeldes bemerk-
lich macht. Line solche Abnahme drängt zu dem unwill-
kürlichen verlangen einer Abblendung der seitlichen Seh-
strahlen.
Dieser Schwäche unseres Sehorgans hilft nun der
Rahmen ab, er ist demnach nicht nur das Mittel, die ideelle
Welt des Kunstwerkes von der realen Wirklichkeit abzu-
grenzen, sondern ebensowohl eine Einrichtung zu einer
derartigen Verengung des Gesichtsfeldes, daß sein unscharf
sichtbarer Rand beim Sehen ausgefchaltet wird.
Die Werkstatt der Kunst.
heft 20.
in der Tat ist die dort angewendete eingeschossig durch-
greifende korinthische Ordnung in ihren Verhältnissen an
sich schon s o groß, daß eine Beziehung zu unserer Körper-
größe überhaupt nicht mehr zustande kommt. Und außer-
dem wirkt noch ihr starkes Relief dem Raumeindruck ebenso
entgegen, wie umgekehrt in der Sophienkirche das zurück-
haltende Relief und kleine Detail diesen Eindruck steigern
Hilst. Daraus erklärt es sich, daß die mächtige Größe der
Peterskirche lange nicht in dem Maß zum Bewußtsein
kommt, wie es den tatsächlichen Abmessungen nach sein
müßte. Der durch mühsames vergleichen nachträglich ge-
wonnene richtige Eindruck liegt außerhalb der ästhetischen
Betrachtung^als^ein rein verstandesmäßig erworbener.
Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu den
Teilen architektonischer Gefüge zurück, so ist es jetzt ihre
Funktionsausdrucksweise, die uns beschäftigen soll. Manche
Aesthetiker erblicken in den Funktionsmerkmalen die eigent-
lichen Kunstformen der Architektur und stellen sie den rein
handwerklich hervorgegangenen Werkformen gegenüber.
Allein eine scharfe Grenze zwischen beiden Formen läßt
sich außerordentlich schwer, vielleicht überhaupt nicht ziehen.
Man darf sich bloß z. B. den Parthenon all seiner
ausdrucksvollen Kleingliederung entkleidet und seine Paupt-
sormen nur in roh bearbeiteten Steinblöcken vorstellen, so
behält der Gesamteindruck aus der Entfernung gesehen
immer noch etwas und gerade das Ausschlaggebendste
seiner bedeutsamen fertigen Erscheinung bei. Die Frage,
ob die Funktionsausdrucksweisen entweder den Werkformen
anhaftende Kunstsormen sind, oder ob nicht schon in den
Werkformen selbst ein Kunstwert steckt, lasse ich also dahin-
gestellt, wenn ich chon den Teilen eines Architekturwerkes
spreche.
In den Teilen sind die Kräfte des Stützens, Lastens,
Schiebens, Strebens, Ziehens und Umschließens verkörpert,
und diese Kräfte wirken sich derart aus, daß sie sich gegen-
seitig das Gleichgewicht halten. Dieses Kräftespiel erhält
sichtbaren Ausdruck in den erwähnten Funktionsmerkmalen,
welche sich hauptsächlich an jenen Stellen verschieden bean-
spruchter Bauteile heransgebildet haben und noch heraus-
bilden, wo Kräftekonslikte zu lösen oder Funktionsübergänge
sichtbar auszudrücken sind. Mit diesen sichtbaren Ausdrucks-
weisen des Kräftesxiels, den eigentlichen Architekturgliedern,
beschäftigte sich die Bauästhetik seit jeher mit besonderer
Vorliebe. Sie sind es vorzugsweise, welche den Beschauer
unwillkürlich anregen, das an sich tote Gefüge als belebtes
zu empfinden. Die Seele des Genießenden findet in der
Wechselwirkung der Teile etwas der eigenen inneren Tätig-
keit verwandtes vor, versenkt sich in den betrachteten
Gegenstand und belebt ihn so von sich aus. Dieser mit
dem Worte „Einfühlung" bezeichnete psychologische Vor-
gang stellt sich ja auch beim ästhetischen Betrachten von
Naturobjekten ein, im Kunstobjekt jedoch ist der Weg dazu
wesentlich erleichtert dadurch, daß dieses beim Beschauer
an die gleichen menschlichen Grdnungsgesetze appelliert, die
beim Entstehen des Werkes maßgebend waren, unterstützt
durch die zwingende Kraft, mit welcher die vom Künstler
ausgewählten stärksten Wirkungswerte beim Sehakt einsetzen.
Diese psychologische Auffassung erhebt sich um ein
wesentliches über die mehr symbolische Deutung L. Bötti-
chers. Jener ignoriert vollkommen den in der griechischen
Tektonik zur Erscheinung gebrachten Kräfteausdruck, wie
er sich z. B. in der Säulenschwellung oder der schroffen
Kapitälsorm zeigt, und behauptet, die Kräfte des Stützens,
Lastens, Umschließens seien symbolisch ausgedrückt, indem
sich Gebilde vegetabiler oder textiler Art wie eine pülle
um die Kernsorm herumlegen, um an deren Funktionen
durch Naturanalogien zu erinnern, ohne daß sie selbst daran
teilnähmen.
Nach Streiter ist durch diese Auffassung Bötticher aber
genötigt, solch struktive Zierformen als unerläßliche tekto-
nische Bestandteile zu erklären und ihr Fehlen an einzelnen
Werken mit der bedenklichen Annahme abzutun, daß ihre
Ausführung, obwohl beabsichtigt, aus irgendeinem Grunde
unterblieben fein müßte.
wenn man jedoch die an den struktiven Gliedern an-
gebrachten Ornamente nur als reine Zierformen hinnimmt,
so tritt deren Bedeutung wesentlich zurück gegen jene,
welche Bötticher ihnen zuteilt, und wir erkennen dann
in der reihenweisen Wiederkehr gleicher Zierelemente vor-
wiegend einen Raumwert, der zur besseren Pervor-
hebung des damit geschmückten Baugliedes dient, wobei
es ziemlich belanglos ist, ob diese Elemente aus umge-
bogenen Blättern, Flechtbändern oder reinen geometrischen
Linien bestehen, wenn schon manchen von ihnen gewisse
Funktionswerte zugesprochen werden dürfen.
Die sonst noch auftretenden Schmuckformen der Archi-
tektur kann ich, da sie in diesem Zusammenhang keine
wesentlich anderen Gesichtspunkte mit sich brächten, als die
einer Unterstützung, Steigerung und Verdeutlichung der
Gliederung im engeren Sinne, hier wohl übergehen.
Es soll lieber noch auf zwei grundsätzlich verschiedene
Arten des Gliederns hingewiesen werden, von denen die
eine in einem Perausmeißeln aus der gewachsen zu denken-
den Masse, die andere in einer Zusammenfügung von ein-
zelnen relativ selbständigen Teilen besteht. — Die erstere
entspricht dem unmittelbar ausgesprochenen Steinbaustil des
Mittelalters, die letztere einer dem polzbau entnommenen,
aber dem Stein angepaßten, in den Antiken und den da-
von abgeleiteten Stilen vertretenen Bauweise. Dieser Unter-
schied tritt am augenscheinlichsten in der Unauslösbarkeit
des gotischen Pfeilers gegenüber der leichten, ohne zer-
störenden Eingriff möglichen Auslösbarkeit der antiken
Säule je aus ihrem bezüglichen Zusammenhänge hervor.
Ich schäle ihn in der Absicht heraus, um mit feiner
Pilse noch eine Beziehung hervorzuheben, welche die
organische Gliederung als Ganzes in räumlicher Pinsicht
einzugehen hat. Sie liegt in Bedingungen, die auch in
der Reliefkunst des Bildhauers nach Berücksichtigung ver-
langen. wie am Relief das Dargestellte von seiner Vorder-
fläche aus nach der Tiefe zu soll abgelesen werden können,
so muß auch das gleiche vom Architekturrelief gefordert werden.
Dieses Ablesen nach der Tiefe ergibt sich nun bei der
mittelalterlichen Gliederungsweise schon in der Art ihrer
Entstehung durch schichtenweifes Eindringen in die Stein-
masse von selbst, dagegen ist es nicht ohne weiteres ver-
anlaßt in jenem kräftigen Relief, wie es etwa italienischen
Renaissancexalästen eigen ist; hier besteht die Gefahr, eine
Ablesung von hinten nach vorn vorzunehmen, d. h. den
Eindruck zu gewinnen, als ob Teile des Reliefs aus einer
weiter hinten liegenden Bildfläche hervortreten, wenn nicht
durch eine Mehrzahl von Ausladungspunkten eine Eini-
gung zu einer vor dem Relief liegenden Fläche bewirkt
ist, die, als solche gefühlt, auf die Tiefenbewegung des
Blickes so anregend wirkt, daß die Ablesung von vorn nach
hinten erzwungen wird.
Ls soll, anders ausgedrückt, das Relief der Gliederung
stets einen konkaven Eindruck machen. Scheinen aber Teile
der Gliederung vor die gedachte Bildvorderfläche zu treten,
so erweckt das die Vorstellung des konvex Lntgegengerichteten,
mit welchem die Tiefenbewegung beim Anblick aufgehalten
und damit unserem Raumgefühl entgegengewirkt wird.
Die Bevorzugung des Vordringens nach der Tiefe
beim Sehakt und damit des Einblickes in konkave Form-
bildungen gibt Anlaß, abgesehen von den unser allgemeines
Raumempfinden lenkenden psychologischen Gründen, wieder-
um nach einem physikalischen Grund dieser eigentümlichen
Forderung des Gesichtssinnes zu fragen. Er dürfte in der
Abnahme und Begrenzung des Sehvermögens zu finden
fein, wie es sich gegen den Rand des Gesichtsfeldes bemerk-
lich macht. Line solche Abnahme drängt zu dem unwill-
kürlichen verlangen einer Abblendung der seitlichen Seh-
strahlen.
Dieser Schwäche unseres Sehorgans hilft nun der
Rahmen ab, er ist demnach nicht nur das Mittel, die ideelle
Welt des Kunstwerkes von der realen Wirklichkeit abzu-
grenzen, sondern ebensowohl eine Einrichtung zu einer
derartigen Verengung des Gesichtsfeldes, daß sein unscharf
sichtbarer Rand beim Sehen ausgefchaltet wird.