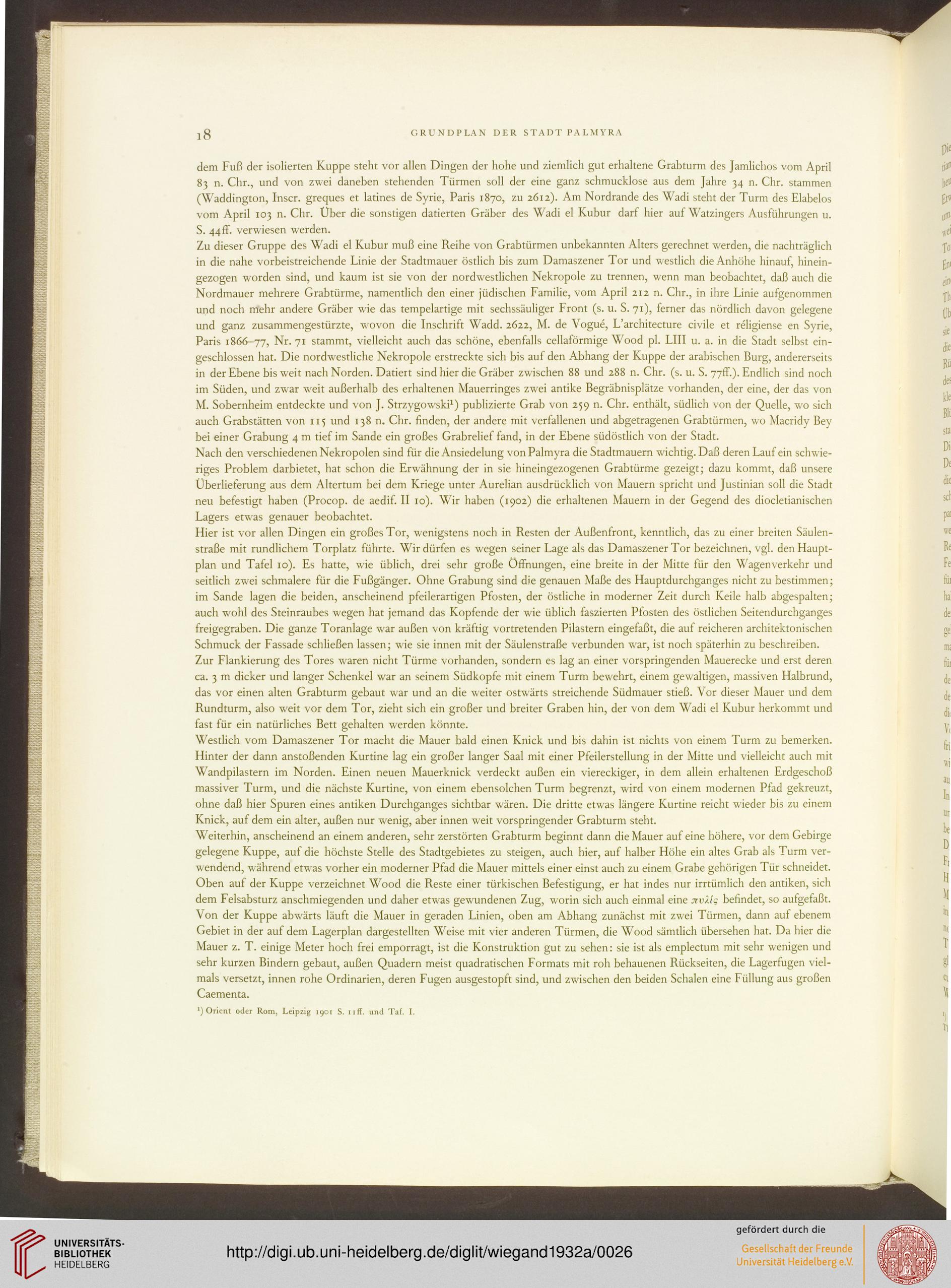i8
GRUNDPLAN DER STADT PALMYRA
dem Fuß der isolierten Kuppe steht vor allen Dingen der hohe und ziemlich gut erhaltene Grabturm des Jamlichos vom April
83 n. Chr., und von zwei daneben stehenden Türmen soll der eine ganz schmucklose aus dem Jahre 34 n. Chr. stammen
(Waddington, Inscr. greques et latines de Syrie, Paris 1870, zu 2612). Am Nordrande des Wadi steht der Turm des Elabelos
vom April 103 n. Chr. Über die sonstigen datierten Gräber des Wadi el Kubur darf hier auf Watzingers Ausführungen u.
S. 44 fr. verwiesen werden.
Zu dieser Gruppe des Wadi el Kubur muß eine Reihe von Grabtürmen unbekannten Alters gerechnet werden, die nachträglich
in die nahe vorbeistreichende Linie der Stadtmauer östlich bis zum Damaszener Tor und westlich die Anhöhe hinauf, hinein-
gezogen worden sind, und kaum ist sie von der nordwestlichen Nekropole zu trennen, wenn man beobachtet, daß auch die
Nordmauer mehrere Grabtürme, namentlich den einer jüdischen Familie, vom April 212 n. Chr., in ihre Linie aufgenommen
und noch mehr andere Gräber wie das tempelartige mit sechssäuliger Front (s. u. S. 71), ferner das nördlich davon gelegene
und ganz zusammengestürzte, wovon die Inschrift Wadd. 2622, M. de Vogue, L'architecture civile et religiense en Syrie,
Paris 1866-77, Nr. 71 stammt, vielleicht auch das schöne, ebenfalls cellaförmige Wood pl. LIII u. a. in die Stadt selbst ein-
geschlossen hat. Die nordwestliche Nekropole erstreckte sich bis auf den Abhang der Kuppe der arabischen Burg, andererseits
in der Ebene bis weit nach Norden. Datiert sind hier die Gräber zwischen 88 und 288 n. Chr. (s. u. S. 77fr.). Endlich sind noch
im Süden, und zwar weit außerhalb des erhaltenen Mauerringes zwei antike Begräbnisplätze vorhanden, der eine, der das von
M. Sobernheim entdeckte und von J. Strzygowski1) publizierte Grab von 259 n. Chr. enthält, südlich von der Quelle, wo sich
auch Grabstätten von 115 und 138 n. Chr. finden, der andere mit verfallenen und abgetragenen Grabtürmen, wo Macridy Bey
bei einer Grabung 4 m tief im Sande ein großes Grabrelief fand, in der Ebene südöstlich von der Stadt.
Nach den verschiedenen Nekropolen sind für die Ansiedelung vonPalmyra die Stadtmauern wichtig. Daß deren Lauf ein schwie-
riges Problem darbietet, hat schon die Erwähnung der in sie hineingezogenen Grabtürme gezeigt; dazu kommt, daß unsere
Überlieferung aus dem Altertum bei dem Kriege unter Aurelian ausdrücklich von Mauern spricht und Justinian soll die Stadt
neu befestigt haben (Procop. de aedif. II 10). Wir haben (1902) die erhaltenen Mauern in der Gegend des diocletianischen
Lagers etwas genauer beobachtet.
Hier ist vor allen Dingen ein großes Tor, wenigstens noch in Resten der Außenfront, kenntlich, das zu einer breiten Säulen-
straße mit rundlichem Torplatz führte. Wir dürfen es wegen seiner Lage als das Damaszener Tor bezeichnen, vgl. den Haupt-
plan und Taiel 10). Es hatte, wie üblich, drei sehr große Öffnungen, eine breite in der Mitte für den Wagenverkehr und
seitlich zwei schmalere für die Fußgänger. Ohne Grabung sind die genauen Maße des Hauptdurchganges nicht zu bestimmen;
im Sande lagen die beiden, anscheinend pfeilerartigen Pfosten, der östliche in moderner Zeit durch Keile halb abgespalten;
auch wohl des Steinraubes wegen hat jemand das Kopfende der wie üblich faszierten Pfosten des östlichen Seitendurchganges
freigegraben. Die ganze Toranlage war außen von kräftig vortretenden Pilastern eingefaßt, die auf reicheren architektonischen
Schmuck der Fassade schließen lassen; wie sie innen mit der Säulenstraße verbunden war, ist noch späterhin zu beschreiben.
Zur Flankierung des Tores waren nicht Türme vorhanden, sondern es lag an einer vorspringenden Mauerecke und erst deren
ca. 3 m dicker und langer Schenkel war an seinem Südkopfe mit einem Turm bewehrt, einem gewaltigen, massiven Halbrund,
das vor einen alten Grabturm gebaut war und an die weiter ostwärts streichende Südmauer stieß. Vor dieser Mauer und dem
Rundturm, also weit vor dem Tor, zieht sich ein großer und breiter Graben hin, der von dem Wadi el Kubur herkommt und
fast für ein natürliches Bett gehalten werden könnte.
Westlich vom Damaszener Tor macht die Mauer bald einen Knick und bis dahin ist nichts von einem Turm zu bemerken.
Hinter der dann anstoßenden Kurtine lag ein großer langer Saal mit einer Pfeilerstellung in der Mitte und vielleicht auch mit
Wandpilastern im Norden. Einen neuen Mauerknick verdeckt außen ein viereckiger, in dem allein erhaltenen Erdgeschoß
massiver Turm, und die nächste Kurtine, von einem ebensolchen Turm begrenzt, wird von einem modernen Pfad gekreuzt,
ohne daß hier Spuren eines antiken Durchganges sichtbar wären. Die dritte etwas längere Kurtine reicht wieder bis zu einem
Knick, auf dem ein alter, außen nur wenig, aber innen weit vorspringender Grabturm steht.
Weiterhin, anscheinend an einem anderen, sehr zerstörten Grabturm beginnt dann die Mauer auf eine höhere, vor dem Gebirge
gelegene Kuppe, auf die höchste Stelle des Stadtgebietes zu steigen, auch hier, auf halber Höhe ein altes Grab als Turm ver-
wendend, während etwas vorher ein moderner Pfad die Mauer mittels einer einst auch zu einem Grabe gehörigen Tür schneidet.
Oben auf der Kuppe verzeichnet Wood die Reste einer türkischen Befestigung, er hat indes nur irrtümlich den antiken, sich
dem Felsabsturz anschmiegenden und daher etwas gewundenen Zug, worin sich auch einmal eine xvliq befindet, so aufgefaßt.
Von der Kuppe abwärts läuft die Mauer in geraden Linien, oben am Abhang zunächst mit zwei Türmen, dann auf ebenem
Gebiet in der auf dem Lagerplan dargestellten Weise mit vier anderen Türmen, die Wood sämtlich übersehen hat. Da hier die
Mauer z. T. einige Meter hoch frei emporragt, ist die Konstruktion gut zu sehen: sie ist als emplectum mit sehr wenigen und
sehr kurzen Bindern gebaut, außen Quadern meist quadratischen Formats mit roh behauenen Rückseiten, die Lagerfugen viel-
mals versetzt, innen rohe Ordinarien, deren Fugen ausgestopft sind, und zwischen den beiden Schalen eine Füllung aus großen
Caementa.
^Orient oder Rom, Leipzig 1901 S. nff. und Taf. I.
GRUNDPLAN DER STADT PALMYRA
dem Fuß der isolierten Kuppe steht vor allen Dingen der hohe und ziemlich gut erhaltene Grabturm des Jamlichos vom April
83 n. Chr., und von zwei daneben stehenden Türmen soll der eine ganz schmucklose aus dem Jahre 34 n. Chr. stammen
(Waddington, Inscr. greques et latines de Syrie, Paris 1870, zu 2612). Am Nordrande des Wadi steht der Turm des Elabelos
vom April 103 n. Chr. Über die sonstigen datierten Gräber des Wadi el Kubur darf hier auf Watzingers Ausführungen u.
S. 44 fr. verwiesen werden.
Zu dieser Gruppe des Wadi el Kubur muß eine Reihe von Grabtürmen unbekannten Alters gerechnet werden, die nachträglich
in die nahe vorbeistreichende Linie der Stadtmauer östlich bis zum Damaszener Tor und westlich die Anhöhe hinauf, hinein-
gezogen worden sind, und kaum ist sie von der nordwestlichen Nekropole zu trennen, wenn man beobachtet, daß auch die
Nordmauer mehrere Grabtürme, namentlich den einer jüdischen Familie, vom April 212 n. Chr., in ihre Linie aufgenommen
und noch mehr andere Gräber wie das tempelartige mit sechssäuliger Front (s. u. S. 71), ferner das nördlich davon gelegene
und ganz zusammengestürzte, wovon die Inschrift Wadd. 2622, M. de Vogue, L'architecture civile et religiense en Syrie,
Paris 1866-77, Nr. 71 stammt, vielleicht auch das schöne, ebenfalls cellaförmige Wood pl. LIII u. a. in die Stadt selbst ein-
geschlossen hat. Die nordwestliche Nekropole erstreckte sich bis auf den Abhang der Kuppe der arabischen Burg, andererseits
in der Ebene bis weit nach Norden. Datiert sind hier die Gräber zwischen 88 und 288 n. Chr. (s. u. S. 77fr.). Endlich sind noch
im Süden, und zwar weit außerhalb des erhaltenen Mauerringes zwei antike Begräbnisplätze vorhanden, der eine, der das von
M. Sobernheim entdeckte und von J. Strzygowski1) publizierte Grab von 259 n. Chr. enthält, südlich von der Quelle, wo sich
auch Grabstätten von 115 und 138 n. Chr. finden, der andere mit verfallenen und abgetragenen Grabtürmen, wo Macridy Bey
bei einer Grabung 4 m tief im Sande ein großes Grabrelief fand, in der Ebene südöstlich von der Stadt.
Nach den verschiedenen Nekropolen sind für die Ansiedelung vonPalmyra die Stadtmauern wichtig. Daß deren Lauf ein schwie-
riges Problem darbietet, hat schon die Erwähnung der in sie hineingezogenen Grabtürme gezeigt; dazu kommt, daß unsere
Überlieferung aus dem Altertum bei dem Kriege unter Aurelian ausdrücklich von Mauern spricht und Justinian soll die Stadt
neu befestigt haben (Procop. de aedif. II 10). Wir haben (1902) die erhaltenen Mauern in der Gegend des diocletianischen
Lagers etwas genauer beobachtet.
Hier ist vor allen Dingen ein großes Tor, wenigstens noch in Resten der Außenfront, kenntlich, das zu einer breiten Säulen-
straße mit rundlichem Torplatz führte. Wir dürfen es wegen seiner Lage als das Damaszener Tor bezeichnen, vgl. den Haupt-
plan und Taiel 10). Es hatte, wie üblich, drei sehr große Öffnungen, eine breite in der Mitte für den Wagenverkehr und
seitlich zwei schmalere für die Fußgänger. Ohne Grabung sind die genauen Maße des Hauptdurchganges nicht zu bestimmen;
im Sande lagen die beiden, anscheinend pfeilerartigen Pfosten, der östliche in moderner Zeit durch Keile halb abgespalten;
auch wohl des Steinraubes wegen hat jemand das Kopfende der wie üblich faszierten Pfosten des östlichen Seitendurchganges
freigegraben. Die ganze Toranlage war außen von kräftig vortretenden Pilastern eingefaßt, die auf reicheren architektonischen
Schmuck der Fassade schließen lassen; wie sie innen mit der Säulenstraße verbunden war, ist noch späterhin zu beschreiben.
Zur Flankierung des Tores waren nicht Türme vorhanden, sondern es lag an einer vorspringenden Mauerecke und erst deren
ca. 3 m dicker und langer Schenkel war an seinem Südkopfe mit einem Turm bewehrt, einem gewaltigen, massiven Halbrund,
das vor einen alten Grabturm gebaut war und an die weiter ostwärts streichende Südmauer stieß. Vor dieser Mauer und dem
Rundturm, also weit vor dem Tor, zieht sich ein großer und breiter Graben hin, der von dem Wadi el Kubur herkommt und
fast für ein natürliches Bett gehalten werden könnte.
Westlich vom Damaszener Tor macht die Mauer bald einen Knick und bis dahin ist nichts von einem Turm zu bemerken.
Hinter der dann anstoßenden Kurtine lag ein großer langer Saal mit einer Pfeilerstellung in der Mitte und vielleicht auch mit
Wandpilastern im Norden. Einen neuen Mauerknick verdeckt außen ein viereckiger, in dem allein erhaltenen Erdgeschoß
massiver Turm, und die nächste Kurtine, von einem ebensolchen Turm begrenzt, wird von einem modernen Pfad gekreuzt,
ohne daß hier Spuren eines antiken Durchganges sichtbar wären. Die dritte etwas längere Kurtine reicht wieder bis zu einem
Knick, auf dem ein alter, außen nur wenig, aber innen weit vorspringender Grabturm steht.
Weiterhin, anscheinend an einem anderen, sehr zerstörten Grabturm beginnt dann die Mauer auf eine höhere, vor dem Gebirge
gelegene Kuppe, auf die höchste Stelle des Stadtgebietes zu steigen, auch hier, auf halber Höhe ein altes Grab als Turm ver-
wendend, während etwas vorher ein moderner Pfad die Mauer mittels einer einst auch zu einem Grabe gehörigen Tür schneidet.
Oben auf der Kuppe verzeichnet Wood die Reste einer türkischen Befestigung, er hat indes nur irrtümlich den antiken, sich
dem Felsabsturz anschmiegenden und daher etwas gewundenen Zug, worin sich auch einmal eine xvliq befindet, so aufgefaßt.
Von der Kuppe abwärts läuft die Mauer in geraden Linien, oben am Abhang zunächst mit zwei Türmen, dann auf ebenem
Gebiet in der auf dem Lagerplan dargestellten Weise mit vier anderen Türmen, die Wood sämtlich übersehen hat. Da hier die
Mauer z. T. einige Meter hoch frei emporragt, ist die Konstruktion gut zu sehen: sie ist als emplectum mit sehr wenigen und
sehr kurzen Bindern gebaut, außen Quadern meist quadratischen Formats mit roh behauenen Rückseiten, die Lagerfugen viel-
mals versetzt, innen rohe Ordinarien, deren Fugen ausgestopft sind, und zwischen den beiden Schalen eine Füllung aus großen
Caementa.
^Orient oder Rom, Leipzig 1901 S. nff. und Taf. I.