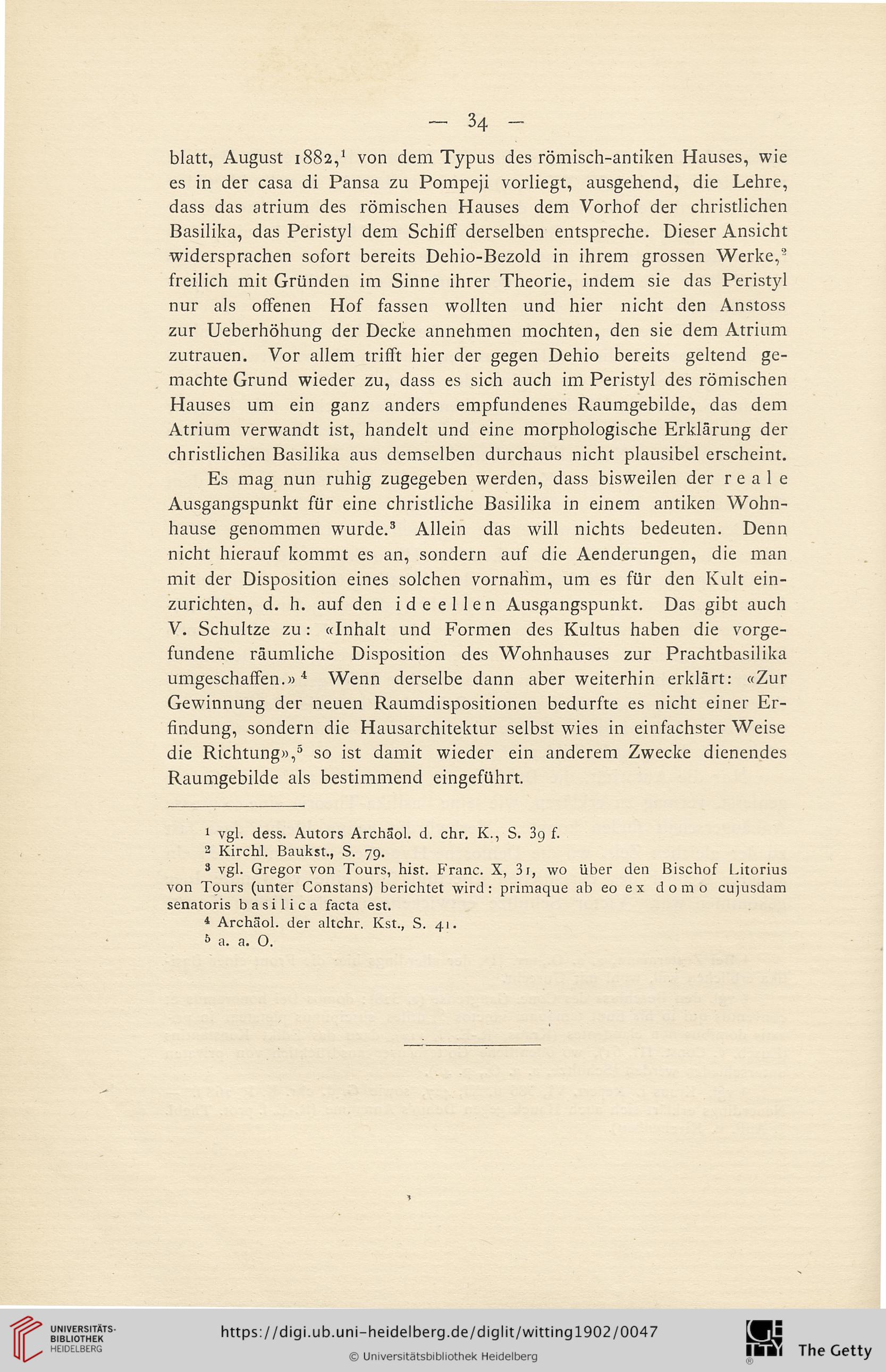— 34 —
blatt, August 1882,1 von dem Typus des römisch-antiken Hauses, wie
es in der casa di Pansa zu Pompeji vorliegt, ausgehend, die Lehre,
dass das atrium des römischen Hauses dem Vorhof der christlichen
Basilika, das Peristyl dem Schiff derselben entspreche. Dieser Ansicht
widersprachen sofort bereits Dehio-Bezold in ihrem grossen Werke,2
freilich mit Gründen im Sinne ihrer Theorie, indem sie das Peristyl
nur als offenen Hof fassen wollten und hier nicht den Anstoss
zur Ueberhöhung der Decke annehmen mochten, den sie dem Atrium
zutrauen. Vor allem trifft hier der gegen Dehio bereits geltend ge-
machte Grund wieder zu, dass es sich auch im Peristyl des römischen
Hauses um ein ganz anders empfundenes Raumgebilde, das dem
Atrium verwandt ist, handelt und eine morphologische Erklärung der
christlichen Basilika aus demselben durchaus nicht plausibel erscheint.
Es mag nun ruhig zugegeben werden, dass bisweilen der reale
Ausgangspunkt für eine christliche Basilika in einem antiken Wohn-
hause genommen wurde.3 Allein das will nichts bedeuten. Denn
nicht hierauf kommt es an, sondern auf die Aenderungen, die man
mit der Disposition eines solchen vornahm, um es für den Kult ein-
zurichten, d. h. auf den ideellen Ausgangspunkt. Das gibt auch
V. Schultze zu: «Inhalt und Formen des Kultus haben die vorge-
fundene räumliche Disposition des Wohnhauses zur Prachtbasilika
umgeschaffen.»4 5 Wenn derselbe dann aber weiterhin erklärt: «Zur
Gewinnung der neuen Raumdispositionen bedurfte es nicht einer Er-
findung, sondern die Hausarchitektur selbst wies in einfachster Weise
die Richtung»,3 so ist damit wieder ein anderem Zwecke dienendes
Raumgebilde als bestimmend eingeführt.
1 vgl. dess. Autors Archäol. d. ehr. K., S. 3g f.
3 Kirchl. Baukst., S. 79.
3 vgl. Gregor von Tours, hist. Franc. X, 3 t, wo über den Bischof Litorius
von Tours (unter Constans) berichtet wird: primaque ab eo e x domo cujusdam
senatoris b a s i 1 i c a facta est.
4 Archäol. der altchr. ICst., S. 41.
5 a. a. O.
blatt, August 1882,1 von dem Typus des römisch-antiken Hauses, wie
es in der casa di Pansa zu Pompeji vorliegt, ausgehend, die Lehre,
dass das atrium des römischen Hauses dem Vorhof der christlichen
Basilika, das Peristyl dem Schiff derselben entspreche. Dieser Ansicht
widersprachen sofort bereits Dehio-Bezold in ihrem grossen Werke,2
freilich mit Gründen im Sinne ihrer Theorie, indem sie das Peristyl
nur als offenen Hof fassen wollten und hier nicht den Anstoss
zur Ueberhöhung der Decke annehmen mochten, den sie dem Atrium
zutrauen. Vor allem trifft hier der gegen Dehio bereits geltend ge-
machte Grund wieder zu, dass es sich auch im Peristyl des römischen
Hauses um ein ganz anders empfundenes Raumgebilde, das dem
Atrium verwandt ist, handelt und eine morphologische Erklärung der
christlichen Basilika aus demselben durchaus nicht plausibel erscheint.
Es mag nun ruhig zugegeben werden, dass bisweilen der reale
Ausgangspunkt für eine christliche Basilika in einem antiken Wohn-
hause genommen wurde.3 Allein das will nichts bedeuten. Denn
nicht hierauf kommt es an, sondern auf die Aenderungen, die man
mit der Disposition eines solchen vornahm, um es für den Kult ein-
zurichten, d. h. auf den ideellen Ausgangspunkt. Das gibt auch
V. Schultze zu: «Inhalt und Formen des Kultus haben die vorge-
fundene räumliche Disposition des Wohnhauses zur Prachtbasilika
umgeschaffen.»4 5 Wenn derselbe dann aber weiterhin erklärt: «Zur
Gewinnung der neuen Raumdispositionen bedurfte es nicht einer Er-
findung, sondern die Hausarchitektur selbst wies in einfachster Weise
die Richtung»,3 so ist damit wieder ein anderem Zwecke dienendes
Raumgebilde als bestimmend eingeführt.
1 vgl. dess. Autors Archäol. d. ehr. K., S. 3g f.
3 Kirchl. Baukst., S. 79.
3 vgl. Gregor von Tours, hist. Franc. X, 3 t, wo über den Bischof Litorius
von Tours (unter Constans) berichtet wird: primaque ab eo e x domo cujusdam
senatoris b a s i 1 i c a facta est.
4 Archäol. der altchr. ICst., S. 41.
5 a. a. O.