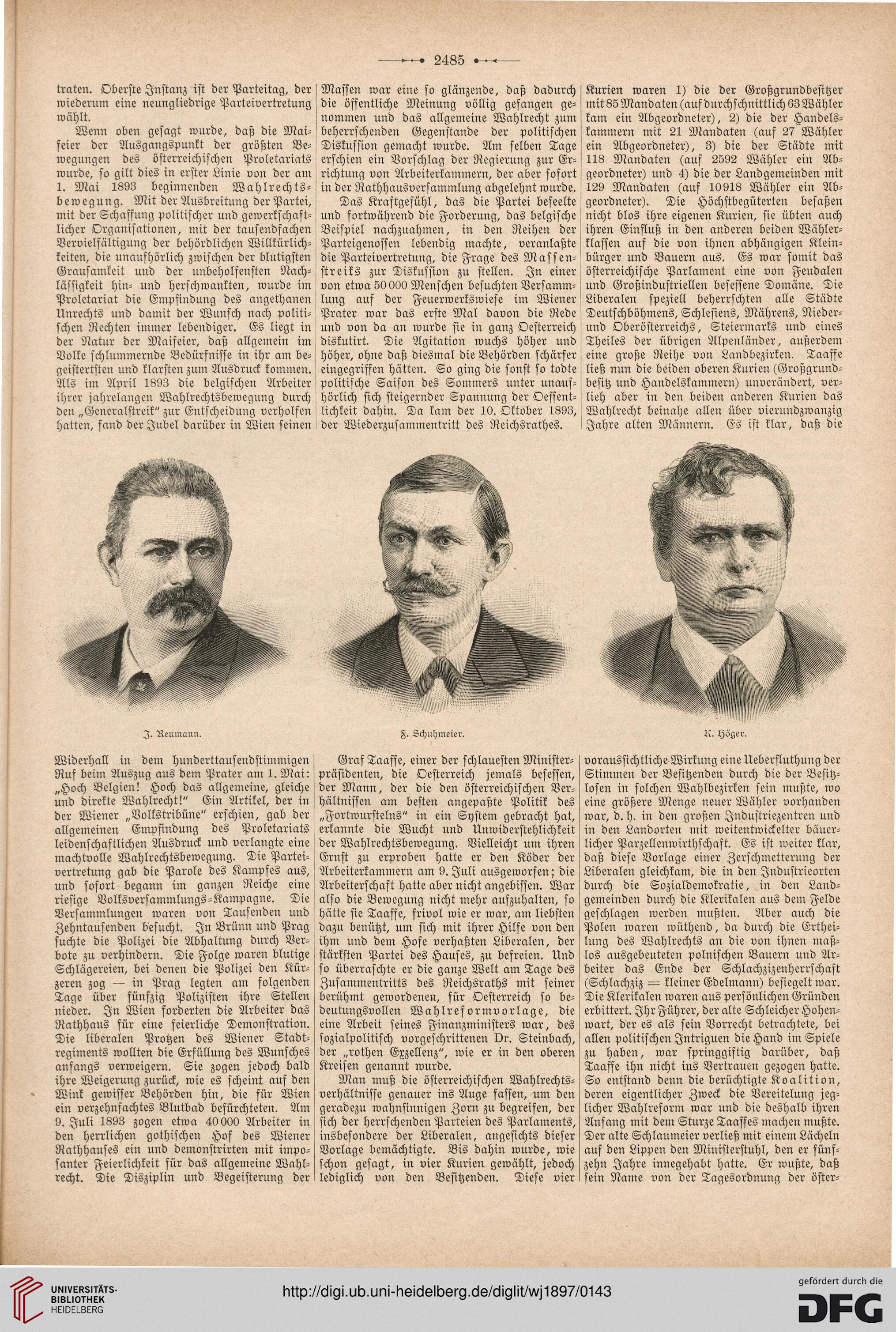2485
traten. Oberste Instanz ist der Parteitag, der
wiederum eine neungliedrige Parteivertretung
wählt.
Wenn oben gesagt wurde, daß die Mai-
feier der Ausgangspunkt der größten Be-
wegungen des österreichischen Proletariats
wurde, so gilt dies in erster Linie von der am
1. Mai 1893 beginnenden Wahlrechts-
bewegung. Mit der Ausbreitung der Partei,
mit der Schaffung politischer und gewerkschaft-
licher Organisationen, mit der tausendfachen
Vervielfältigung der behördlichen Willkürlich-
keiten, die unaufhörlich zwischen der blutigsten
Grausamkeit und der unbeholfensten Nach-
lässigkeit hin- und herschwankten, wurde im
Proletariat die Empfindung des angethanen
Unrechts und damit der Wunsch nach politi-
schen Rechten immer lebendiger. Es liegt in
der Natur der Maifeier, daß allgemein im
Volke schlummernde Bedürfnisse in ihr am be-
geistertsten und klarsten zum Ausdruck kommen.
Als im April 1893 die belgischen Arbeiter
ihrer jahrelangen Wahlrechtsbewegung durch
den „Generalstreik" zur Entscheidung verhalfen
hatten, fand der Jubel darüber in Wien seinen
Massen war eine so glänzende, daß dadurch
die öffentliche Meinung völlig gefangen ge-
nommen und das allgemeine Wahlrecht zum
beherrschenden Gegenstände der politischen
Diskussion gemacht wurde. Am selben Tage
erschien ein Vorschlag der Regierung zur Er-
richtung von Arbeiterkammern, der aber sofort
in der Rathhausversammlung abgelehnt wurde.
Das Kraftgefühl, das die Partei beseelte
und fortwährend die Forderung, das belgische
Beispiel nachzuahmen, in den Reihen der
Parteigenossen lebendig machte, veranlaßte
die Parteivertretung, die Frage des Massen-
streiks zur Diskussion zu stellen. In einer
von etwa 50000 Menschen besuchten Versamm-
lung auf der Feuerwerkswiese im Wiener
Prater war das erste Mal davon die Rede
und von da an wurde sie in ganz Oesterreich
diskutirt. Die Agitation wuchs höher und
höher, ohne daß diesmal die Behörden schärfer
eingegriffen hätten. So ging die sonst so todte
politische Saison des Sommers unter unauf-
hörlich sich steigernder Spannung der Oeffent-
lichkeit dahin. Da kam der 10. Oktober 1893,
der Wiederzusammentritt des Reichsrathes.
Kurien waren 1) die der Großgrundbesitzer
mit 85 Mandaten (auf durchschnittlich 63Wähler
kam ein Abgeordneter), 2) die der Handels-
kammern mit 21 Mandaten (auf 27 Wähler
ein Abgeordneter), 3) die der Städte mit
118 Mandaten (auf 2592 Wähler ein Ab-
geordneter) und 4) die der Landgemeinden mit
129 Mandaten (auf 10918 Wähler ein Ab-
geordneter). Die Höchstbegüterten besaßen
nicht blos ihre eigenen Kurien, sie übten auch
ihren Einfluß in den anderen beiden Wähler-
klassen auf die von ihnen abhängigen Klein-
bürger und Bauern aus. Es war somit das
österreichische Parlament eine von Feudalen
und Großindustriellen besessene Domäne. Die
Liberalen speziell beherrschten alle Städte
Deutschböhmens, Schlesiens, Mährens, Nieder-
und Oberösterreichs, Steiermarks und eines
Theiles der übrigen Alpenländer, außerdem
eine große Reihe von Landbezirken. Taaffe
ließ nun die beiden oberen Kurien (Großgrund-
besitz und Handelskammern) unverändert, ver-
lieh aber in den beiden anderen Kurien das
Wahlrecht beinahe allen über vierundzwanzig
Jahre alten Männern. Es ist klar, daß die
Lchuhmeier.
R. Höger.
Widerhall in dem hunderttausendstimmigen
Ruf beim Auszug aus dem Prater am 1. Mai:
„Hoch Belgien! Hoch das allgemeine, gleiche
und direkte Wahlrecht!" Ein Artikel, der in
der Wiener „Volkstribüne" erschien, gab der
allgemeinen Empfindung des Proletariats
leidenschaftlichen Ausdruck und verlangte eine
machtvolle Wahlrechtsbewegung. Die Partei-
vertretung gab die Parole des Kampfes aus,
und sofort begann im ganzen Reiche eine
riesige Volksversammlungs-Kampagne. Die
Versammlungen waren von Tausenden und
Zehntausenden besucht. In Brünn und Prag
suchte die Polizei die Abhaltung durch Ver-
bote zu verhindern. Die Folge waren blutige
Schlägereien, bei denen die Polizei den Kür-
zeren zog — in Prag legten am folgenden
Tage über fünfzig Polizisten ihre Stellen
nieder. In Wien forderten die Arbeiter das
Rathhaus für eine feierliche Demonstration.
Die liberalen Protzen des Wiener Stadt-
regiments wollten die Erfüllung des Wunsches
anfangs verweigern. Sie zogen jedoch bald
ihre Weigerung zurück, wie es scheint auf den
Wink gewisser Behörden hin, die für Wien
ein verzehnfachtes Blutbad befürchteten. Am
9. Juli 1893 zogen etwa 40000 Arbeiter in
den herrlichen gothischen Hof des Wiener
Rathhauses ein und demonstrirten mit impo-
santer Feierlichkeit für das allgemeine Wahl-
recht. Die Disziplin und Begeisterung der
Graf Taaffe, einer der schlauesten Minister-
präsidenten, die Oesterreich jemals besessen,
der Mann, der die den österreichischen Ver-
hältnissen am besten angepaßte Politik des
„Fortwurstelns" in ein System gebracht hat,
erkannte die Wucht und Unwiderstehlichkeit
der Wahlrechtsbewegung. Vielleicht um ihren
Ernst zu erproben hatte er den Köder der
Arbeiterkammern am 9. Juli ausgeworfen; die
Arbeiterschaft hatte aber nicht angebissen. War
also die Bewegung nicht mehr aufzuhalten, so
hätte sie Taaffe, frivol wie er war, am liebsten
dazu benützt, um sich mit ihrer Hilfe von den
ihm und dem Hofe verhaßten Liberalen, der
stärksten Partei des Hauses, zu befreien. Und
so überraschte er die ganze Welt am Tage des
Zusammentritts des Reichsraths mit seiner
berühmt gewordenen, für Oesterreich so be-
deutungsvollen Wahlreformvorlage, die
eine Arbeit seines Finanzministers war, des
sozialpolitisch vorgeschrittenen Or. Steinbach,
der „rothen Exzellenz", wie er in den oberen
Kreisen genannt wurde.
Man muß die österreichischen Wahlrechts-
verhältnisse genauer ins Auge fassen, um den
geradezu wahnsinnigen Zorn zu begreifen, der
sich der herrschenden Parteien des Parlaments,
insbesondere der Liberalen, angesichts dieser
Vorlage bemächtigte. Bis dahin wurde, wie
schon gesagt, in vier Kurien gewählt, jedoch
lediglich von den Besitzenden. Diese vier
voraussichtliche Wirkung eine Ueberfluthung der
Stimmen der Besitzenden durch die der Besitz-
losen in solchen Wahlbezirken sein mußte, wo
eine größere Menge neuer Wähler vorhanden
war, d. h. in den großen Industriezentren und
in den Landorten mit weitentwickelter bäuer-
licher Parzellenwirthschaft. Es ist weiter klar,
daß diese Vorlage einer Zerschmetterung der
Liberalen gleichkam, die in den Jndustrieorten
durch die Sozialdemokratie, in den Land-
gemeinden durch die Klerikalen aus dem Felde
geschlagen werden mußten. Aber auch die
Polen waren wüthend, da durch die Erthei-
lung des Wahlrechts an die von ihnen maß-
los ausgebeuteten polnischen Bauern und Ar-
beiter das Ende der Schlachzizenherrschaft
(Schlachziz — kleiner Edelmann) besiegelt war.
Die Klerikalen waren aus persönlichen Gründen
erbittert. Ihr Führer, der alte Schleicher Hohen-
wart, der es als sein Vorrecht betrachtete, bei
allen politischen Jntriguen die Hand im Spiele
zu haben, war springgiftig darüber, daß
Taaffe ihn nicht ins Vertrauen gezogen hatte.
So entstand denn die berüchtigte Koalition,
deren eigentlicher Zweck die Vereitelung jeg-
licher Wahlreform war und die deshalb ihren
Anfang mit dem Sturze Taaffes machen mußte.
Der alte Schlaumeier verließ mit einem Lächeln
auf den Lippen den Ministerstuhl, den er fünf-
zehn Jahre innegehabt hatte. Er wußte, daß
sein Name von der Tagesordnung der öfter-
traten. Oberste Instanz ist der Parteitag, der
wiederum eine neungliedrige Parteivertretung
wählt.
Wenn oben gesagt wurde, daß die Mai-
feier der Ausgangspunkt der größten Be-
wegungen des österreichischen Proletariats
wurde, so gilt dies in erster Linie von der am
1. Mai 1893 beginnenden Wahlrechts-
bewegung. Mit der Ausbreitung der Partei,
mit der Schaffung politischer und gewerkschaft-
licher Organisationen, mit der tausendfachen
Vervielfältigung der behördlichen Willkürlich-
keiten, die unaufhörlich zwischen der blutigsten
Grausamkeit und der unbeholfensten Nach-
lässigkeit hin- und herschwankten, wurde im
Proletariat die Empfindung des angethanen
Unrechts und damit der Wunsch nach politi-
schen Rechten immer lebendiger. Es liegt in
der Natur der Maifeier, daß allgemein im
Volke schlummernde Bedürfnisse in ihr am be-
geistertsten und klarsten zum Ausdruck kommen.
Als im April 1893 die belgischen Arbeiter
ihrer jahrelangen Wahlrechtsbewegung durch
den „Generalstreik" zur Entscheidung verhalfen
hatten, fand der Jubel darüber in Wien seinen
Massen war eine so glänzende, daß dadurch
die öffentliche Meinung völlig gefangen ge-
nommen und das allgemeine Wahlrecht zum
beherrschenden Gegenstände der politischen
Diskussion gemacht wurde. Am selben Tage
erschien ein Vorschlag der Regierung zur Er-
richtung von Arbeiterkammern, der aber sofort
in der Rathhausversammlung abgelehnt wurde.
Das Kraftgefühl, das die Partei beseelte
und fortwährend die Forderung, das belgische
Beispiel nachzuahmen, in den Reihen der
Parteigenossen lebendig machte, veranlaßte
die Parteivertretung, die Frage des Massen-
streiks zur Diskussion zu stellen. In einer
von etwa 50000 Menschen besuchten Versamm-
lung auf der Feuerwerkswiese im Wiener
Prater war das erste Mal davon die Rede
und von da an wurde sie in ganz Oesterreich
diskutirt. Die Agitation wuchs höher und
höher, ohne daß diesmal die Behörden schärfer
eingegriffen hätten. So ging die sonst so todte
politische Saison des Sommers unter unauf-
hörlich sich steigernder Spannung der Oeffent-
lichkeit dahin. Da kam der 10. Oktober 1893,
der Wiederzusammentritt des Reichsrathes.
Kurien waren 1) die der Großgrundbesitzer
mit 85 Mandaten (auf durchschnittlich 63Wähler
kam ein Abgeordneter), 2) die der Handels-
kammern mit 21 Mandaten (auf 27 Wähler
ein Abgeordneter), 3) die der Städte mit
118 Mandaten (auf 2592 Wähler ein Ab-
geordneter) und 4) die der Landgemeinden mit
129 Mandaten (auf 10918 Wähler ein Ab-
geordneter). Die Höchstbegüterten besaßen
nicht blos ihre eigenen Kurien, sie übten auch
ihren Einfluß in den anderen beiden Wähler-
klassen auf die von ihnen abhängigen Klein-
bürger und Bauern aus. Es war somit das
österreichische Parlament eine von Feudalen
und Großindustriellen besessene Domäne. Die
Liberalen speziell beherrschten alle Städte
Deutschböhmens, Schlesiens, Mährens, Nieder-
und Oberösterreichs, Steiermarks und eines
Theiles der übrigen Alpenländer, außerdem
eine große Reihe von Landbezirken. Taaffe
ließ nun die beiden oberen Kurien (Großgrund-
besitz und Handelskammern) unverändert, ver-
lieh aber in den beiden anderen Kurien das
Wahlrecht beinahe allen über vierundzwanzig
Jahre alten Männern. Es ist klar, daß die
Lchuhmeier.
R. Höger.
Widerhall in dem hunderttausendstimmigen
Ruf beim Auszug aus dem Prater am 1. Mai:
„Hoch Belgien! Hoch das allgemeine, gleiche
und direkte Wahlrecht!" Ein Artikel, der in
der Wiener „Volkstribüne" erschien, gab der
allgemeinen Empfindung des Proletariats
leidenschaftlichen Ausdruck und verlangte eine
machtvolle Wahlrechtsbewegung. Die Partei-
vertretung gab die Parole des Kampfes aus,
und sofort begann im ganzen Reiche eine
riesige Volksversammlungs-Kampagne. Die
Versammlungen waren von Tausenden und
Zehntausenden besucht. In Brünn und Prag
suchte die Polizei die Abhaltung durch Ver-
bote zu verhindern. Die Folge waren blutige
Schlägereien, bei denen die Polizei den Kür-
zeren zog — in Prag legten am folgenden
Tage über fünfzig Polizisten ihre Stellen
nieder. In Wien forderten die Arbeiter das
Rathhaus für eine feierliche Demonstration.
Die liberalen Protzen des Wiener Stadt-
regiments wollten die Erfüllung des Wunsches
anfangs verweigern. Sie zogen jedoch bald
ihre Weigerung zurück, wie es scheint auf den
Wink gewisser Behörden hin, die für Wien
ein verzehnfachtes Blutbad befürchteten. Am
9. Juli 1893 zogen etwa 40000 Arbeiter in
den herrlichen gothischen Hof des Wiener
Rathhauses ein und demonstrirten mit impo-
santer Feierlichkeit für das allgemeine Wahl-
recht. Die Disziplin und Begeisterung der
Graf Taaffe, einer der schlauesten Minister-
präsidenten, die Oesterreich jemals besessen,
der Mann, der die den österreichischen Ver-
hältnissen am besten angepaßte Politik des
„Fortwurstelns" in ein System gebracht hat,
erkannte die Wucht und Unwiderstehlichkeit
der Wahlrechtsbewegung. Vielleicht um ihren
Ernst zu erproben hatte er den Köder der
Arbeiterkammern am 9. Juli ausgeworfen; die
Arbeiterschaft hatte aber nicht angebissen. War
also die Bewegung nicht mehr aufzuhalten, so
hätte sie Taaffe, frivol wie er war, am liebsten
dazu benützt, um sich mit ihrer Hilfe von den
ihm und dem Hofe verhaßten Liberalen, der
stärksten Partei des Hauses, zu befreien. Und
so überraschte er die ganze Welt am Tage des
Zusammentritts des Reichsraths mit seiner
berühmt gewordenen, für Oesterreich so be-
deutungsvollen Wahlreformvorlage, die
eine Arbeit seines Finanzministers war, des
sozialpolitisch vorgeschrittenen Or. Steinbach,
der „rothen Exzellenz", wie er in den oberen
Kreisen genannt wurde.
Man muß die österreichischen Wahlrechts-
verhältnisse genauer ins Auge fassen, um den
geradezu wahnsinnigen Zorn zu begreifen, der
sich der herrschenden Parteien des Parlaments,
insbesondere der Liberalen, angesichts dieser
Vorlage bemächtigte. Bis dahin wurde, wie
schon gesagt, in vier Kurien gewählt, jedoch
lediglich von den Besitzenden. Diese vier
voraussichtliche Wirkung eine Ueberfluthung der
Stimmen der Besitzenden durch die der Besitz-
losen in solchen Wahlbezirken sein mußte, wo
eine größere Menge neuer Wähler vorhanden
war, d. h. in den großen Industriezentren und
in den Landorten mit weitentwickelter bäuer-
licher Parzellenwirthschaft. Es ist weiter klar,
daß diese Vorlage einer Zerschmetterung der
Liberalen gleichkam, die in den Jndustrieorten
durch die Sozialdemokratie, in den Land-
gemeinden durch die Klerikalen aus dem Felde
geschlagen werden mußten. Aber auch die
Polen waren wüthend, da durch die Erthei-
lung des Wahlrechts an die von ihnen maß-
los ausgebeuteten polnischen Bauern und Ar-
beiter das Ende der Schlachzizenherrschaft
(Schlachziz — kleiner Edelmann) besiegelt war.
Die Klerikalen waren aus persönlichen Gründen
erbittert. Ihr Führer, der alte Schleicher Hohen-
wart, der es als sein Vorrecht betrachtete, bei
allen politischen Jntriguen die Hand im Spiele
zu haben, war springgiftig darüber, daß
Taaffe ihn nicht ins Vertrauen gezogen hatte.
So entstand denn die berüchtigte Koalition,
deren eigentlicher Zweck die Vereitelung jeg-
licher Wahlreform war und die deshalb ihren
Anfang mit dem Sturze Taaffes machen mußte.
Der alte Schlaumeier verließ mit einem Lächeln
auf den Lippen den Ministerstuhl, den er fünf-
zehn Jahre innegehabt hatte. Er wußte, daß
sein Name von der Tagesordnung der öfter-