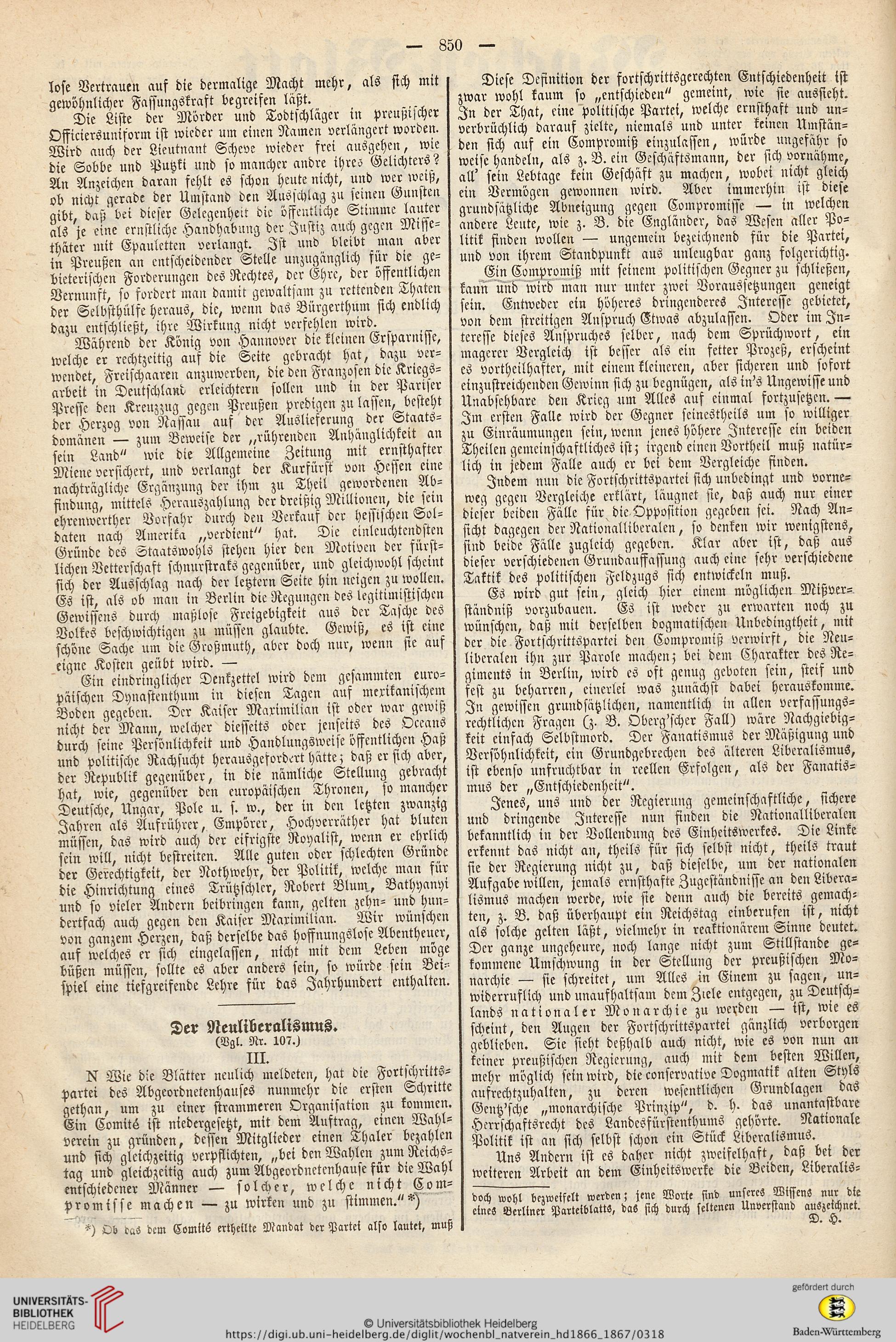850
lose Vertrauen auf die dermalige Macht mehr, als sich mit
gewöhnlicher Fassungskraft begreifen läßt.
Die Liste der Mörder und Todtschläger in preußischer
Officiersuniform ist wieder um einen Namen verlängert worden.
Wird auch der Lieutnant Scheve wieder frei ausgehcn, wie
die Sobbe und Putzki und so mancher andre ihres Gelichters?
An Anzeichen daran fehlt es schon heute nicht, und wer weiß,
ob nicht gerade der Umstand den Ausschlag zu seinen Gunsten
gibt, daß bei dieser Gelegenheit die öffentliche Stimme lauter
als je eine ernstliche Handhabung der Justiz auch gegen Misse-
thätcr mit Epaulettcn verlangt. Ist und bleibt man aber
in Preußen an entscheidender Stelle unzugänglich für die ge-
bieterischen Forderungen des Rechtes, der Ehre, der öffentlichen
Vernunft, so fordert man damit gewaltsam zu rettenden Thaten
der Selbsthülfe heraus, die, wenn das Bürgerthum sich endlich
dazu entschließt, ihre Wirkung nicht verfehlen wird.
Während der König von Hannover die kleinen Ersparnisse,
welche er rechtzeitig auf die Seite gebracht hat, dazu ver-
wendet, Freischaaren anzuwerben, die den Franzosen die Kriegs-
arbeit in Deutschland erleichtern sollen und in der Pariser-
Presse den Kreuzzug gegen Preußen predigen zu lassen, besteht
der Herzog von Nassau auf der Auslieferung der Staats-
domänen — zum Beweise der „rührenden Anhänglichkeit an
sein Land" wie die Allgemeine Zeitung mit ernsthafter
Miene versichert, und verlangt der Kurfürst von Hessen eine
nachträgliche Ergänzung der ihm zu Theil gewordenen Ab-
findung, mittels'Herauszahlung der dreißig Millionen, diesem
ehrcnwcrther Vorfahr durch den Verkauf der hessischen Sol-
daten nach Amerika „verdient" hat. Die einleuchtendsten
Gründe des Staatswohls stehen hier den Motiven der fürst-
lichen Vetterschaft schnurstraks gegenüber, und gleichwohl scheint
sich der Ausschlag nach der letzter» Seite hin neigen zu wollen.
Es ist, als ob man in Berlin die Regungen des legitimistischcn
Gewissens durch maßlose Freigebigkeit aus der Tasche des
Volkes beschwichtigen zu müssen glaubte. Gewiß, es ist eine
schöne Sache um die Großmuth, aber doch nur, wenn sie auf
eigne Kosten geübt wird. —
Ein eindringlicher Denkzettel wird dem gesummten euro-
päischen Dynastenthum in diesen Tagen auf mexikanischem
Boden gegeben. Der Kaiser Maximilian ist oder war gewiß
nicht der Mann, welcher diesseits oder jenseits des Oceans
durch seine Persönlichkeit und Handlungsweise öffentlichen Haß
und politische Rachsucht herausgefordert hätte; daß er sich aber,
der Republik gegenüber, in die nämliche Stellung gebracht
hat, wie, gegenüber den europäischen Thronen, so mancher
Deutsche, Ungar, Pole u. s. w., der in den letzten zwanzig
Jahren als Aufrührer, Empörer, Hochverräther hat bluten
müssen, das wird auch der eifrigste Royalist, wenn er ehrlich
sein will, nicht bestreiten. Alle guten oder schlechten Gründe
der Gerechtigkeit, der Nothwehr, der Politik, welche man für
die Hinrichtung eines Trützschlcr, Robert Blum, Bathyanyi
und so vieler Andern beibringen kann, gelten zehn- und hun-
dertfach auch gegen den Kaiser Maximilian. Wir wünschen
von ganzem Herzen, daß derselbe das hoffnungslose Abentheuer,
auf welches er sich eingelassen, nicht mit dem Leben möge
büßen müssen, sollte es aber anders sein, so würde sein Bei-
spiel eine tiefgreifende Lehre für das Jahrhundert enthalten.
Der Neuliberalismus.
(Vgl. Nr. 107.)
III.
Wie die Blätter neulich meldeten, hat die Fortschritts-
partei des Abgeordnetenhauses nunmehr die ersten Schritte
gethan, um zu einer strammeren Organisation zu kommen.
Ein Comitä ist niedcrgesetzt, mit dem Auftrag, einen Wahl-
verein zu gründen, dessen Mitglieder einen Thalcr bezahlen
und sich gleichzeitig verpflichten, „bei den Wahlen zum Reichs-
tag und gleichzeitig auch zum Abgeordnetenhaus«! für die Wahl
entschiedener Männer — solcher, welche nicht Kom-
promisse machen — zu wirken und zu stimmen."*)
*) Ob das dem Comits ertheilte Mandat der Partei also lautet, muß
Diese Definition der fortschrittsgerechten Entschiedenheit ist
zwar wohl kaum so „entschieden" gemeint, wie sie aussieht.
Zn der That, eine politische Partei, welche ernsthaft und un-
verbrüchlich darauf zielte, niemals und unter keinen Umstän-
den sich auf ein Kompromiß einzulassen, würde ungefähr so
weise handeln, als z. B. ein Geschäftsmann, der sich vornähme,
all' sein Lebtage kein Geschäft zu machen, wobei nicht gleich
ein Vermögen gewonnen wird. Aber immerhin ist diese
grundsätzliche Abneigung gegen Kompromisse — in welchen
andere Leute, wie z. B. die Engländer, das Wesen aller Po-
litik finden wollen — ungemein bezeichnend für die Partei,
und von ihrem Standpunkt aus unleugbar ganz folgerichtig.
Ein Kompromiß mit seinem politischen Gegner zu schließen,
kann und wird man nur unter zwei Voraussetzungen geneigt
sein. Entweder ein höheres dringenderes Interesse gebietet,
von dem streitigen Anspruch Etwas abzulasscn. Oder im In-
teresse dieses Anspruches selber, nach dem Sprüchwort, ein
magerer Vergleich ist besser als ein fetter Prozeß, erscheint
es vortheilhafter, mit einem kleineren, aber sicheren und sofort
einzustrcichcnden Gewinn sich zu begnügen, als in's Ungewisse und
Unabsehbare den Krieg um Alles auf einmal fortzusetzcn. —
Im ersten Falle wird der Gegner scinestheils um so williger
zu Einräumungen sein, wenn jenes höhere Interesse ein beiden
Theilen gemeinschaftliches ist; irgend einen Vortheil muß natür-
lich in jedem Falle auch er bei dem Vergleiche finden.
Indem nun die Fortschrittspartei sich unbedingt und vorne-
weg gegen Vergleiche erklärt, läugnet sie, daß auch nur einer
dieser beiden Fälle für die Opposition gegeben sei. Nach An-
sicht dagegen der Nationalliberalcn, so denken wir wenigstens,
sind beide Fälle zugleich gegeben. Klar aber ist, daß aus
dieser verschiedenen Grundauffassung auch eine sehr verschiedene
Taktik des politischen Feldzugs sich entwickeln muß.
Es wird gut sein, gleich hier einem möglichen Mißver-
ständniß vorzubaucn. Es ist weder zu erwarten noch zu
wünschen, daß mit derselben dogmatischen Unbedingtheit, mit
der die Fortschrittspartei den Kompromiß verwirft, die Neu-
liberalen ihn zur Parole machen; bei dem Charakter des Re-
giments in Berlin, wird es oft genug geboten sein, steif und
fest zu beharren, einerlei was zunächst dabei hcrauskomme.
In gewissen grundsätzlichen, namentlich in allen verfasiungs-
rcchtltchcn Fragen (z. B. Oberg'scher Fall) wäre Nachgiebig-
keit einfach Selbstmord. Der Fanatismus der Mäßigung und
Versöhnlichkeit, ein Grundgebrcchen des älteren Liberalismus,
ist ebenso unfruchtbar in reellen Erfolgen, als der Fanatis-
mus der „Entschiedenheit".
Jenes, uns und der Regierung gemeinschaftliche, sichere
und dringende Interesse nun finden die Nationalliberalcn
bekanntlich in der Vollendung des Einheitswerkes. Die Linke
erkennt das nicht an, theils für sich selbst nicht, thcils traut
sie der Regierung nicht zu, daß dieselbe, um der nationalen
Aufgabe willen, jemals ernsthafte Zugeständnisse an den Libera-
lismus machen werde, wie sie denn auch die bereits gemach-
ten, z. B. daß überhaupt ein Reichstag einbcrufcn ist, nicht
als solche gelten läßt, vielmehr in reaktionärem Sinne deutet.
Der ganze ungeheure, noch lange nicht zum Stillstände ge-
kommene Umschwung in der Stellung der preußischen Mo-
narchie — sie schreitet, um Alles in Einem zu sagen, un-
widerruflich und unaufhaltsam dem Ziele entgegen, zu Deutsch-
lands nationaler Monarchie zu werden — ist, wie es
scheint, den Augen der Fortschrittspartei gänzlich verborgen
geblieben. Sie sieht deßhalb auch nicht, wie es von nun an
keiner preußischen Negierung, auch mit dem besten Willen,
mehr möglich sein wird, die conscrvative Dogmatik alten Styls
aufrechtzuhalten, zu deren wesentlichen Grundlagen das
Gentz'sche „monarchische Prinzip", d. h. das unantastbare
Herrschaftsrecht des LandcsfürstenthumS gehörte. Nationale
Politik ist an sich selbst schon ein Stück Liberalismus.
Uns Andern ist es daher nicht zweifelhaft, daß bei der
weiteren Arbeit an dem Einheitöwerke die Beiden, Liberalis-
doch wohl bezweifelt werden; jene Worte sind unseres Wissens nur die
eines Berliner Parteiblatts, das sich durch seltenen Unverstand auSzeichnet.
D. H.
lose Vertrauen auf die dermalige Macht mehr, als sich mit
gewöhnlicher Fassungskraft begreifen läßt.
Die Liste der Mörder und Todtschläger in preußischer
Officiersuniform ist wieder um einen Namen verlängert worden.
Wird auch der Lieutnant Scheve wieder frei ausgehcn, wie
die Sobbe und Putzki und so mancher andre ihres Gelichters?
An Anzeichen daran fehlt es schon heute nicht, und wer weiß,
ob nicht gerade der Umstand den Ausschlag zu seinen Gunsten
gibt, daß bei dieser Gelegenheit die öffentliche Stimme lauter
als je eine ernstliche Handhabung der Justiz auch gegen Misse-
thätcr mit Epaulettcn verlangt. Ist und bleibt man aber
in Preußen an entscheidender Stelle unzugänglich für die ge-
bieterischen Forderungen des Rechtes, der Ehre, der öffentlichen
Vernunft, so fordert man damit gewaltsam zu rettenden Thaten
der Selbsthülfe heraus, die, wenn das Bürgerthum sich endlich
dazu entschließt, ihre Wirkung nicht verfehlen wird.
Während der König von Hannover die kleinen Ersparnisse,
welche er rechtzeitig auf die Seite gebracht hat, dazu ver-
wendet, Freischaaren anzuwerben, die den Franzosen die Kriegs-
arbeit in Deutschland erleichtern sollen und in der Pariser-
Presse den Kreuzzug gegen Preußen predigen zu lassen, besteht
der Herzog von Nassau auf der Auslieferung der Staats-
domänen — zum Beweise der „rührenden Anhänglichkeit an
sein Land" wie die Allgemeine Zeitung mit ernsthafter
Miene versichert, und verlangt der Kurfürst von Hessen eine
nachträgliche Ergänzung der ihm zu Theil gewordenen Ab-
findung, mittels'Herauszahlung der dreißig Millionen, diesem
ehrcnwcrther Vorfahr durch den Verkauf der hessischen Sol-
daten nach Amerika „verdient" hat. Die einleuchtendsten
Gründe des Staatswohls stehen hier den Motiven der fürst-
lichen Vetterschaft schnurstraks gegenüber, und gleichwohl scheint
sich der Ausschlag nach der letzter» Seite hin neigen zu wollen.
Es ist, als ob man in Berlin die Regungen des legitimistischcn
Gewissens durch maßlose Freigebigkeit aus der Tasche des
Volkes beschwichtigen zu müssen glaubte. Gewiß, es ist eine
schöne Sache um die Großmuth, aber doch nur, wenn sie auf
eigne Kosten geübt wird. —
Ein eindringlicher Denkzettel wird dem gesummten euro-
päischen Dynastenthum in diesen Tagen auf mexikanischem
Boden gegeben. Der Kaiser Maximilian ist oder war gewiß
nicht der Mann, welcher diesseits oder jenseits des Oceans
durch seine Persönlichkeit und Handlungsweise öffentlichen Haß
und politische Rachsucht herausgefordert hätte; daß er sich aber,
der Republik gegenüber, in die nämliche Stellung gebracht
hat, wie, gegenüber den europäischen Thronen, so mancher
Deutsche, Ungar, Pole u. s. w., der in den letzten zwanzig
Jahren als Aufrührer, Empörer, Hochverräther hat bluten
müssen, das wird auch der eifrigste Royalist, wenn er ehrlich
sein will, nicht bestreiten. Alle guten oder schlechten Gründe
der Gerechtigkeit, der Nothwehr, der Politik, welche man für
die Hinrichtung eines Trützschlcr, Robert Blum, Bathyanyi
und so vieler Andern beibringen kann, gelten zehn- und hun-
dertfach auch gegen den Kaiser Maximilian. Wir wünschen
von ganzem Herzen, daß derselbe das hoffnungslose Abentheuer,
auf welches er sich eingelassen, nicht mit dem Leben möge
büßen müssen, sollte es aber anders sein, so würde sein Bei-
spiel eine tiefgreifende Lehre für das Jahrhundert enthalten.
Der Neuliberalismus.
(Vgl. Nr. 107.)
III.
Wie die Blätter neulich meldeten, hat die Fortschritts-
partei des Abgeordnetenhauses nunmehr die ersten Schritte
gethan, um zu einer strammeren Organisation zu kommen.
Ein Comitä ist niedcrgesetzt, mit dem Auftrag, einen Wahl-
verein zu gründen, dessen Mitglieder einen Thalcr bezahlen
und sich gleichzeitig verpflichten, „bei den Wahlen zum Reichs-
tag und gleichzeitig auch zum Abgeordnetenhaus«! für die Wahl
entschiedener Männer — solcher, welche nicht Kom-
promisse machen — zu wirken und zu stimmen."*)
*) Ob das dem Comits ertheilte Mandat der Partei also lautet, muß
Diese Definition der fortschrittsgerechten Entschiedenheit ist
zwar wohl kaum so „entschieden" gemeint, wie sie aussieht.
Zn der That, eine politische Partei, welche ernsthaft und un-
verbrüchlich darauf zielte, niemals und unter keinen Umstän-
den sich auf ein Kompromiß einzulassen, würde ungefähr so
weise handeln, als z. B. ein Geschäftsmann, der sich vornähme,
all' sein Lebtage kein Geschäft zu machen, wobei nicht gleich
ein Vermögen gewonnen wird. Aber immerhin ist diese
grundsätzliche Abneigung gegen Kompromisse — in welchen
andere Leute, wie z. B. die Engländer, das Wesen aller Po-
litik finden wollen — ungemein bezeichnend für die Partei,
und von ihrem Standpunkt aus unleugbar ganz folgerichtig.
Ein Kompromiß mit seinem politischen Gegner zu schließen,
kann und wird man nur unter zwei Voraussetzungen geneigt
sein. Entweder ein höheres dringenderes Interesse gebietet,
von dem streitigen Anspruch Etwas abzulasscn. Oder im In-
teresse dieses Anspruches selber, nach dem Sprüchwort, ein
magerer Vergleich ist besser als ein fetter Prozeß, erscheint
es vortheilhafter, mit einem kleineren, aber sicheren und sofort
einzustrcichcnden Gewinn sich zu begnügen, als in's Ungewisse und
Unabsehbare den Krieg um Alles auf einmal fortzusetzcn. —
Im ersten Falle wird der Gegner scinestheils um so williger
zu Einräumungen sein, wenn jenes höhere Interesse ein beiden
Theilen gemeinschaftliches ist; irgend einen Vortheil muß natür-
lich in jedem Falle auch er bei dem Vergleiche finden.
Indem nun die Fortschrittspartei sich unbedingt und vorne-
weg gegen Vergleiche erklärt, läugnet sie, daß auch nur einer
dieser beiden Fälle für die Opposition gegeben sei. Nach An-
sicht dagegen der Nationalliberalcn, so denken wir wenigstens,
sind beide Fälle zugleich gegeben. Klar aber ist, daß aus
dieser verschiedenen Grundauffassung auch eine sehr verschiedene
Taktik des politischen Feldzugs sich entwickeln muß.
Es wird gut sein, gleich hier einem möglichen Mißver-
ständniß vorzubaucn. Es ist weder zu erwarten noch zu
wünschen, daß mit derselben dogmatischen Unbedingtheit, mit
der die Fortschrittspartei den Kompromiß verwirft, die Neu-
liberalen ihn zur Parole machen; bei dem Charakter des Re-
giments in Berlin, wird es oft genug geboten sein, steif und
fest zu beharren, einerlei was zunächst dabei hcrauskomme.
In gewissen grundsätzlichen, namentlich in allen verfasiungs-
rcchtltchcn Fragen (z. B. Oberg'scher Fall) wäre Nachgiebig-
keit einfach Selbstmord. Der Fanatismus der Mäßigung und
Versöhnlichkeit, ein Grundgebrcchen des älteren Liberalismus,
ist ebenso unfruchtbar in reellen Erfolgen, als der Fanatis-
mus der „Entschiedenheit".
Jenes, uns und der Regierung gemeinschaftliche, sichere
und dringende Interesse nun finden die Nationalliberalcn
bekanntlich in der Vollendung des Einheitswerkes. Die Linke
erkennt das nicht an, theils für sich selbst nicht, thcils traut
sie der Regierung nicht zu, daß dieselbe, um der nationalen
Aufgabe willen, jemals ernsthafte Zugeständnisse an den Libera-
lismus machen werde, wie sie denn auch die bereits gemach-
ten, z. B. daß überhaupt ein Reichstag einbcrufcn ist, nicht
als solche gelten läßt, vielmehr in reaktionärem Sinne deutet.
Der ganze ungeheure, noch lange nicht zum Stillstände ge-
kommene Umschwung in der Stellung der preußischen Mo-
narchie — sie schreitet, um Alles in Einem zu sagen, un-
widerruflich und unaufhaltsam dem Ziele entgegen, zu Deutsch-
lands nationaler Monarchie zu werden — ist, wie es
scheint, den Augen der Fortschrittspartei gänzlich verborgen
geblieben. Sie sieht deßhalb auch nicht, wie es von nun an
keiner preußischen Negierung, auch mit dem besten Willen,
mehr möglich sein wird, die conscrvative Dogmatik alten Styls
aufrechtzuhalten, zu deren wesentlichen Grundlagen das
Gentz'sche „monarchische Prinzip", d. h. das unantastbare
Herrschaftsrecht des LandcsfürstenthumS gehörte. Nationale
Politik ist an sich selbst schon ein Stück Liberalismus.
Uns Andern ist es daher nicht zweifelhaft, daß bei der
weiteren Arbeit an dem Einheitöwerke die Beiden, Liberalis-
doch wohl bezweifelt werden; jene Worte sind unseres Wissens nur die
eines Berliner Parteiblatts, das sich durch seltenen Unverstand auSzeichnet.
D. H.