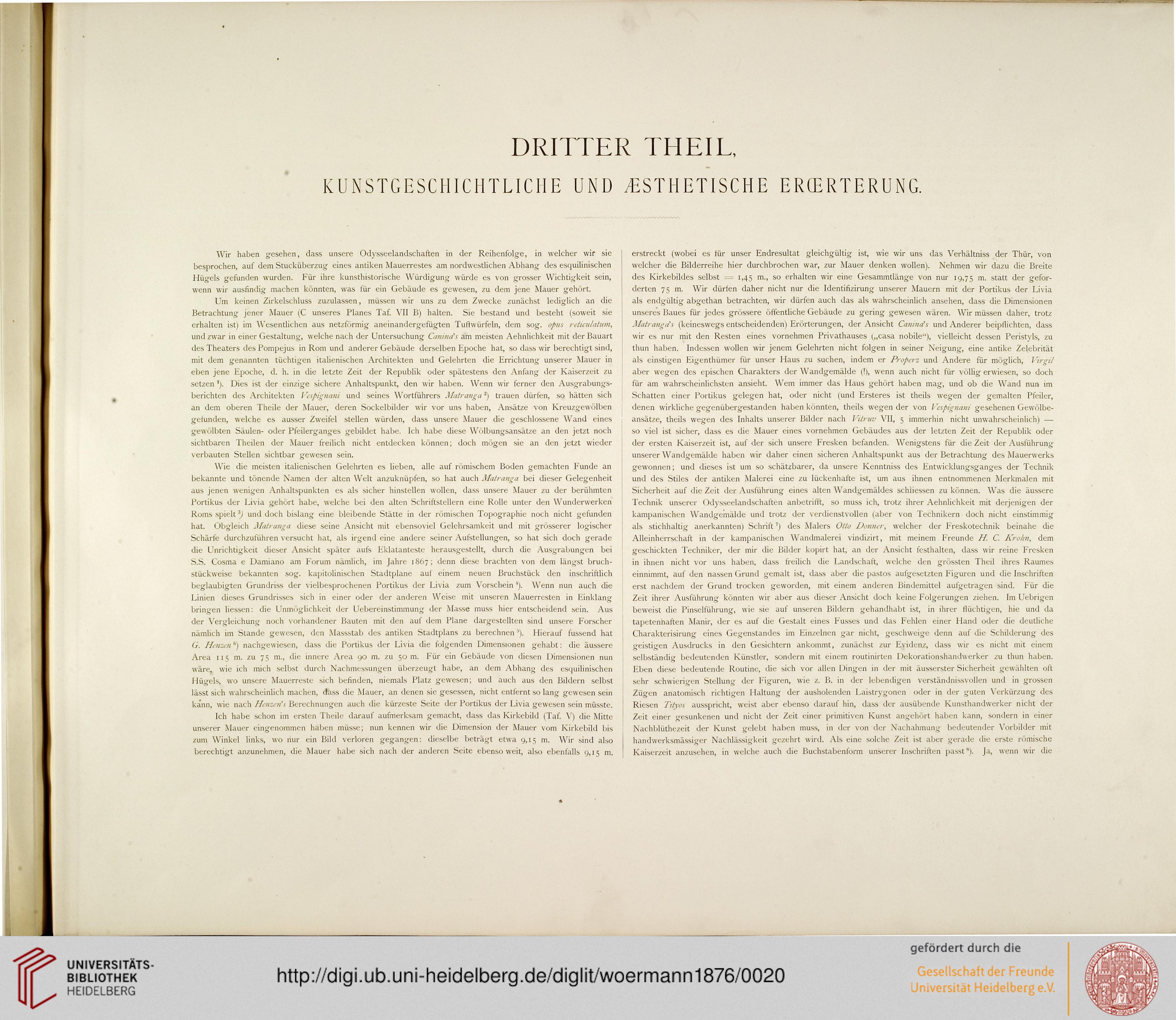DRITTER THEIL,
KUNSTGESCHICHTLICHE UND ÄSTHETISCHE ERÖRTERUNG.
AArir haben gesehen, dass unsere Odysseelandschaften in der Reihenfolge, in welcher wir sie
besprochen, auf dem Stucküberzug eines antiken Mauerrestes am nordwestlichen Abhang des esquilinischen
Hügels gefunden wurden. Für ihre kunsthistorische Würdigung würde es von grosser Wichtigkeit sein,
wenn wir ausfindig machen könnten, was für ein Gebäude es gewesen, zu dem jene Mauer gehört.
Um keinen Zirkelschluss zuzulassen, müssen wir uns zu dem Zwecke zunächst lediglich an die
Betrachtung jener Mauer (C unseres Planes Taf. VII B) halten. Sie bestand und besteht (soweit sie
erhalten ist) im Wesentlichen aus netzförmig aneinandergefügten Tuffwürfeln, dem sog. opus relicidatwm,
und zwar in einer Gestaltung, welche nach der Untersuchung Camna's am meisten Aehnlichkeit mit der Bauart
des Theaters des Pompejus in Rom und anderer Gebäude derselben Epoche hat, so dass wir berechtigt sind,
mit dem genannten tüchtigen italienischen Architekten und Gelehrten die Errichtung unserer Mauer in
eben jene Epoche, d. h. in die letzte Zeit der Republik oder spätestens den Anfang der Kaiserzeit zu
setzen'). Dies ist der einzige sichere Anhaltspunkt, den wir haben. Wenn wir ferner den Ausgrabungs-
berichten des Architekten Vespignani und seines Wortführers Mairanga2) trauen dürfen, so hätten sich
an dem oberen Theile der Mauer, deren Sockelbilder wir vor uns haben, Ansätze von Kreuzgewölben
gefunden, welche es ausser Zweifel stellen würden, dass unsere Mauer die geschlossene Wand eines
gewölbten Säulen- oder Pfeilerganges gebildet habe. Ich habe diese Wölbungsansätze an den jetzt noch
sichtbaren Theilen der Mauer freilich nicht entdecken können; doch mögen sie an den jetzt wieder
verbauten Stellen sichtbar gewesen sein.
Wie die meisten italienischen Gelehrten es lieben, alle auf römischem Boden gemachten Funde an
bekannte und tönende Namen der alten Welt anzuknüpfen, so hat auch Mairanga bei dieser Gelegenheit
aus jenen wenigen Anhaltspunkten es als sicher hinstellen wollen, dass unsere Mauer zu der berühmten
Portikus der Livia gehört habe, welche bei den alten Schriftstellern eine Rolle unter den Wunderwerken
Roms spielt%) und doch bislang eine bleibende Stätte in der römischen Topographie noch nicht gefunden
hat. Obgleich Mairanga diese seine Ansicht mit ebensoviel Gelehrsamkeit und mit grösserer logischer
Schärfe durchzuführen versucht hat, als irgend eine andere seiner Aufstellungen, so hat sich doch gerade
die Unrichtigkeit dieser Ansicht später aufs Eklatanteste herausgestellt, durch die Ausgrabungen bei
S.S. Cosma e Damiano am Forum nämlich, im Jahre 1867; denn diese brachten von dem längst bruch-
stückweise bekannten sog. kapitolinischen Stadtplane auf einem neuen Bruchstück den inschriftlich
beglaubigten Grundriss der vielbesprochenen Portikus der Livia zum Vorschein *). Wenn nun auch die
Linien dieses Grundrisses sich in einer oder der anderen Weise mit unseren Mauerresten in Einklang
bringen Hessen: die Unmöglichkeit der Uebereinstimmung der Masse muss hier entscheidend sein. Aus
der Vergleichung noch vorhandener Bauten mit den auf dem Plane dargestellten sind unsere Forscher
nämlich im Stande gewesen, den Massstab des antiken Stadtplans zu berechnen5). Hierauf fassend hat
G. Henzen6) nachgewiesen, dass die Portikus der Livia die folgenden Dimensionen gehabt: die äussere
Area 115 m. zu 75 m., die innere Area go m. zu 50 m. Für ein Gebäude von diesen Dimensionen nun
wäre, wie ich mich selbst durch Nachmessungen überzeugt habe, an dem Abhang des esquilinischen
Hügels, wo unsere Mauerreste sich befinden, niemals Platz gewesen; und auch aus den Bildern selbst
lässt sich wahrscheinlich machen, dass die Mauer, an denen sie gesessen, nicht entfernt so lang gewesen sein
kann, wie nach Hmzen's Berechnungen auch die kürzeste Seite der Portikus der Livia gewesen sein müsste.
Ich habe schon im ersten Theile darauf aufmerksam gemacht, dass das Kirkebild (Taf. V) die Mitte
unserer Mauer eingenommen haben müsse; nun kennen wir die Dimension der Mauer vom Kirkebild bis
zum Winkel links, wo nur ein Bild verloren gegangen; dieselbe beträgt etwa 9,15 m. Wir sind also
berechtigt anzunehmen, die Mauer habe sich nach der anderen Seite ebensoweit, also ebenfalls 9,15 m.
erstreckt (wobei es für unser Endresultat gleichgültig ist, wie wir uns das Verhältniss der Thür, von
welcher die Bilderreihe hier durchbrochen war, zur Mauer denken wollen). Nehmen wir dazu die Breite
des Kirkebildes selbst = 1,45 m., so erhalten wir eine Gesammtlänge von nur 19,75 m- statt der gefor-
derten 75 m. Wir dürfen daher nicht nur die Identifizirung unserer Mauern mit der Portikus der Livia
als endgültig abgethan betrachten, wir dürfen auch das als wahrscheinlich ansehen, dass die Dimensionen
unseres Baues für jedes grössere Öffentliche Gebäude zu gering gewesen wären. Wir müssen daher, trotz
Matrangds (keineswegs entscheidenden) Erörterungen, der Ansicht Camna's und Anderer beipflichten, dass
wir es nur mit den Resten eines vornehmen Privathauses u>casa nobile"), vielleicht dessen Peristyls, zu
thun haben. Indessen wollen wir jenem Gelehrten nicht folgen in seiner Neigung, eine antike Zelebrität
als einstigen Eigenthümer für unser Haus zu suchen, indem er Properz und Andere für möglich, Virgil
aber wegen des epischen Charakters der Wandgemälde (!), wenn auch nicht für völlig erwiesen, so doch
für am wahrscheinlichsten ansieht. Wem immer das Haus gehört haben mag, und ob die Wand nun im
Schatten einer Portikus gelegen hat, oder nicht (und Ersteres ist theils wegen der gemalten Pfeiler,
denen wirkliche gegenübergestanden haben könnten, theils wegen der von Vespignani gesehenen Gewölbe-
ansätze, theils wegen des Inhalts unserer Bilder nach Vitruv VII, 5 immerhin nicht unwahrscheinlich) —
so viel ist sicher, dass es die Mauer eines vornehmen Gebäudes aus der letzten Zeit der Republik oder
der ersten Kaiserzeit ist, auf der sich unsere Fresken befanden. Wenigstens für die Zeit der Ausführung
unserer Wandgemälde haben wir daher einen sicheren Anhaltspunkt aus der Betrachtung des Mauerwerks
gewonnen; und dieses ist um so schätzbarer, da unsere Kenntniss des Entwicklungsganges der Technik
und des Stiles der antiken Malerei eine zu lückenhafte ist, um aus ihnen entnommenen Merkmalen mit
Sicherheit auf die Zeit der Ausführung eines alten Wandgemäldes schiiessen zu können. Was die äussere
Technik unserer Odysseelandschaften anbetrifft, so muss ich, trotz ihrer Aehnlichkeit mit derjenigen der
kampanischen Wandgemälde und trotz der verdienstvollen (aber von Technikern doch nicht einstimmig
als stichhaltig anerkannten) Schrift 7J des Malers Otto Donner, welcher der Freskotechnik beinahe die
Alleinherrschaft in der kampanischen Wandmalerei vindizirt, mit meinem Freunde H. C. Krokn, dem
geschickten Techniker, der mir die Bilder kopirt hat, an der Ansicht festhalten, dass wir reine Fresken
in ihnen nicht vor uns haben, dass freilich die Landschaft, welche den grössten Theil ihres Raumes
einnimmt, auf den nassen Grund gemalt ist, dass aber die pastos aufgesetzten Figuren und die Inschriften
erst nachdem der Grund trocken geworden, mit einem anderen Bindemittel aufgetragen sind. Für die
Zeit ihrer Ausführung könnten wir aber aus dieser Ansicht doch keine Folgerungen ziehen. Im Uebrigen
beweist die Pinselführung, wie sie auf unseren Bildern gehandhabt ist, in ihrer flüchtigen, hie und da
tapetenhaften Manir, der es auf die Gestalt eines Fusses und das Fehlen einer Hand oder die deutliche
Charakterisirung eines Gegenstandes im Einzelnen gar nicht, geschweige denn auf die Schilderung des
geistigen Ausdrucks in den Gesichtern ankommt, zunächst zur Evidenz, dass wir es nicht mit einem
selbständig bedeutenden Künstler, sondern mit einem routinirten Dekorationshandwerker zu thun haben.
Eben diese bedeutende Routine, die sich vor allen Dingen in der mit äusserster Sicherheit gewählten oft
sehr schwierigen Stellung der Figuren, wie z. B. in der lebendigen verständnissvollen und in grossen
Zügen anatomisch richtigen Haltung der ausholenden Laistrygonen oder in der guten Verkürzung des
Riesen Tityos ausspricht, weist aber ebenso darauf hin, dass der ausübende Kunsthandwerker nicht der
Zeit einer gesunkenen und nicht der Zeit einer primitiven Kunst angehört haben kann, sondern in einer
Nachblüthezeit der Kunst gelebt haben muss, in der von der Nachahmung bedeutender Vorbilder mit
handwerksmässiger Nachlässigkeit gezehrt wird. Als eine solche Zeit ist aber gerade die erste römische
Kaiserzeit anzusehen, in welche auch die Buchstabenlbrm unserer Inschriften passt8). Ja, wenn wir die