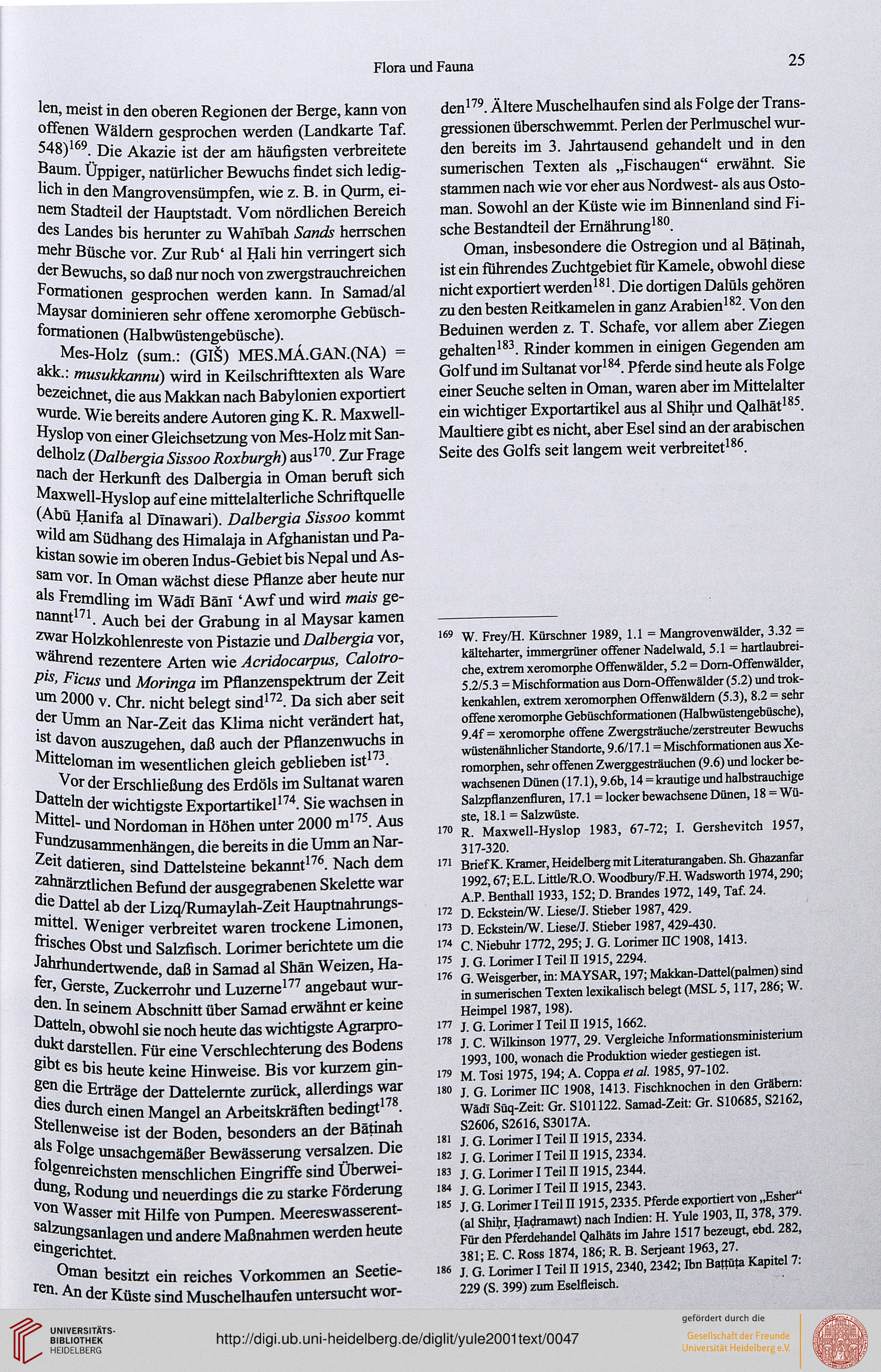Flora und Fauna
25
len, meist in den oberen Regionen der Berge, kann von
offenen Wäldern gesprochen werden (Landkarte Taf.
548)169. Die Akazie ist der am häufigsten verbreitete
Baum. Üppiger, natürlicher Bewuchs findet sich ledig-
lich in den Mangrovensümpfen, wie z. B. in Qurm, ei-
nem Stadteil der Hauptstadt. Vom nördlichen Bereich
des Landes bis herunter zu Wablbah Sands herrschen
mehr Büsche vor. Zur Rub' al Hali hin verringert sich
der Bewuchs, so daß nur noch von zwergstrauchreichen
Formationen gesprochen werden kann. In Samad/al
Maysar dominieren sehr offene xeromorphe Gebüsch-
formationen (Halbwüstengebüsche).
Mes-Holz (sum.: (GIS) MES.MÄ.GAN.(NA) =
akk.: musukkannu) wird in Keilschrifttexten als Ware
bezeichnet, die aus Makkan nach Babylonien exportiert
wurde. Wie bereits andere Autoren ging K. R Maxwell-
Hyslop von einer Gleichsetzung von Mes-Holz mit San-
delholz {Dalbergia Sissoo Roxburgh) aus170. Zur Frage
nach der Herkunft des Dalbergia in Oman beruft sich
Maxwell-Hyslop auf eine mittelalterliche Schriftquelle
(Abu Hanifa al Dmawari). Dalbergia Sissoo kommt
wild am Südhang des Himalaja in Afghanistan und Pa-
kistan sowie im oberen Indus-Gebiet bis Nepal und As-
sam vor. In Oman wächst diese Pflanze aber heute nur
als Fremdling im Wädl Barn 'Awf und wird mais ge-
nannt171. Auch bei der Grabung in al Maysar kamen
zwar Holzkohlenreste von Pistazie und Dalbergia vor,
während rezentere Arten wie Acridocarpus, Calotro-
Pü, Ficus und Moringa im Pflanzenspektrum der Zeit
u«12000 v. Chr. nicht belegt sind172. Da sich aber seit
der Urnm an Nar-Zeit das Klima nicht verändert hat,
ist davon auszugehen, daß auch der Pflanzenwuchs in
Mitteloman im wesentlichen gleich geblieben ist173.
Vor der Erschließung des Erdöls im Sultanat waren
Datteln der wichtigste Exportartikel174. Sie wachsen in
Mittel- und Nordoman in Höhen unter 2000 m175. Aus
Fundzusammenhängen, die bereits in die Umm an Nar-
Zeit datieren, sind Dattelsteine bekannt176. Nach dem
zahnärztlichen Befund der ausgegrabenen Skelette war
die Dattel ab der Lizq/Rumaylah-Zeit Hauptnahrungs-
mittel. Weniger verbreitet waren trockene Limonen,
frisches Obst und Salzfisch. Lorimer berichtete um die
Jahrhundertwende, daß in Samad al Shän Weizen, Ha-
fer, Gerste, Zuckerrohr und Luzerne177 angebaut wur-
den. In seinem Abschnitt über Samad erwähnt er keine
Datteln, obwohl sie noch heute das wichtigste Agrarpro-
dukt darstellen. Für eine Verschlechterung des Bodens
Sibt es bis heute keine Hinweise. Bis vor kurzem gin-
gen die Erträge der Dattelernte zurück, allerdings war
dies durch einen Mangel an Arbeitskräften bedingt178.
Stellenweise ist der Boden, besonders an der Bätinah
als Folge unsachgemäßer Bewässerung versalzen. Die
folgenreichsten menschlichen Eingriffe sind Überwei-
dung, Rodung und neuerdings die zu starke Förderung
v°n Wasser mit Hilfe von Pumpen. Meereswasserent-
salzungsanlagen und andere Maßnahmen werden heute
ungerichtet.
Oman besitzt ein reiches Vorkommen an Seetie-
ren. An der Küste sind Muschelhaufen untersucht wor-
den179. Ältere Muschelhaufen sind als Folge der Trans-
gressionen überschwemmt. Perlen der Perlmuschel wur-
den bereits im 3. Jahrtausend gehandelt und in den
sumerischen Texten als „Fischaugen" erwähnt. Sie
stammen nach wie vor eher aus Nordwest- als aus Osto-
man. Sowohl an der Küste wie im Binnenland sind Fi-
sche Bestandteil der Ernährung180.
Oman, insbesondere die Ostregion und al Bätinah,
ist ein führendes Zuchtgebiet für Kamele, obwohl diese
nicht exportiert werden181. Die dortigen Dalüls gehören
zu den besten Reitkamelen in ganz Arabien182. Von den
Beduinen werden z. T. Schafe, vor allem aber Ziegen
gehalten183. Rinder kommen in einigen Gegenden am
Golf und im Sultanat vor184. Pferde sind heute als Folge
einer Seuche selten in Oman, waren aber im Mittelalter
ein wichtiger Exportartikel aus al Shihr und Qalhät185.
Maultiere gibt es nicht, aber Esel sind an der arabischen
Seite des Golfs seit langem weit verbreitet186.
169 W. Frey/H. Kürschner 1989, 1.1 = Mangrovenwälder, 3.32 =
kälteharter, immergrüner offener Nadelwald, 5.1 = hartlaubrei-
che, extrem xeromorphe Offenwälder, 5.2 = Dorn-Offenwälder,
5.2/5.3 = Mischformation aus Dorn-Offenwälder (5.2) und trok-
kenkahlen, extrem xeromorphen Offenwäldern (5.3), 8.2 = sehr
offene xeromorphe Gebüschformationen (Halbwüstengebüsche),
9.4f = xeromorphe offene Zwergsträuche/zerstreuter Bewuchs
wüstenähnlicher Standorte, 9.6/17.1 = Mischformationen aus Xe-
romorphen, sehr offenen Zwerggesträuchen (9.6) und locker be-
wachsenen Dünen (17.1), 9.6b, 14 = krautige undhalbstrauchige
Salzpflanzenfluren, 17.1 = locker bewachsene Dünen, 18=Wü-
ste, 18.1 = Salzwüste.
170 R. Maxwell-Hyslop 1983, 67-72; I. Gershevitch 1957,
317-320.
171 Brief K Kramer, Heidelberg mit Literaturangaben. Sh. Ghazanfar
1992,67; E.L. Little/RO. Woodbury/F.H. Wadsworth 1974,290;
A.P. Benthall 1933,152; D. Brandes 1972,149, Taf. 24.
172 D. Eckstein/W. Liese/J. Stieber 1987,429.
173 D. Eckstein/W. Liese/J. Stieber 1987,429-430.
174 C. Niebuhr 1772,295; J. G. Lorimer HC 1908,1413.
175 J. G. Lorimer I Teil H 1915,2294.
176 G. Weisgerber, in: MAYSAR, 197; Makkan-Dattel(palmen) sind
in sumerischen Texten lexikalisch belegt (MSL 5,117,286; W.
Heimpel 1987,198).
177 J. G. Lorimer I Teil H 1915,1662.
178 J. C. Wilkinson 1977, 29. Vergleiche Tnformauonsministerium
1993,100, wonach die Produktion wieder gestiegen ist.
179 M. Tosi 1975,194; A. Coppa et al. 1985,97-102.
180 J. G. Lorimer HC 1908, 1413. Fischknochen in den Gräbern:
Wädl Süq-Zeit: Gr. S101122. Samad-Zeit: Gr. S10685, S2162,
S2606, S2616, S3017A.
181 J. G. Lorimer I Teil H 1915,2334.
182 J. G. Lorimer I Teil JJ 1915,2334.
183 J. G. Lorimer I Teil H 1915,2344.
184 J. G. Lorimer I Teil U 1915,2343.
185 J. G. Lorimer I Teil H 1915,2335. Pferde exportiert von „Esher"
(al Shihr, Hadramawt) nach Indien: H. Yule 1903, H, 378,379.
Für den Pferdehandel Qalhäts im Jahre 1517 bezeugt, ebd. 282,
381; E. C. Ross 1874,186; R B. Serjeant 1963,27.
186 J. G. Lorimer I Teil II1915,2340,2342; Ibn Baftüta Kapitel 7:
229 (S. 399) zum Eselfleisch.
25
len, meist in den oberen Regionen der Berge, kann von
offenen Wäldern gesprochen werden (Landkarte Taf.
548)169. Die Akazie ist der am häufigsten verbreitete
Baum. Üppiger, natürlicher Bewuchs findet sich ledig-
lich in den Mangrovensümpfen, wie z. B. in Qurm, ei-
nem Stadteil der Hauptstadt. Vom nördlichen Bereich
des Landes bis herunter zu Wablbah Sands herrschen
mehr Büsche vor. Zur Rub' al Hali hin verringert sich
der Bewuchs, so daß nur noch von zwergstrauchreichen
Formationen gesprochen werden kann. In Samad/al
Maysar dominieren sehr offene xeromorphe Gebüsch-
formationen (Halbwüstengebüsche).
Mes-Holz (sum.: (GIS) MES.MÄ.GAN.(NA) =
akk.: musukkannu) wird in Keilschrifttexten als Ware
bezeichnet, die aus Makkan nach Babylonien exportiert
wurde. Wie bereits andere Autoren ging K. R Maxwell-
Hyslop von einer Gleichsetzung von Mes-Holz mit San-
delholz {Dalbergia Sissoo Roxburgh) aus170. Zur Frage
nach der Herkunft des Dalbergia in Oman beruft sich
Maxwell-Hyslop auf eine mittelalterliche Schriftquelle
(Abu Hanifa al Dmawari). Dalbergia Sissoo kommt
wild am Südhang des Himalaja in Afghanistan und Pa-
kistan sowie im oberen Indus-Gebiet bis Nepal und As-
sam vor. In Oman wächst diese Pflanze aber heute nur
als Fremdling im Wädl Barn 'Awf und wird mais ge-
nannt171. Auch bei der Grabung in al Maysar kamen
zwar Holzkohlenreste von Pistazie und Dalbergia vor,
während rezentere Arten wie Acridocarpus, Calotro-
Pü, Ficus und Moringa im Pflanzenspektrum der Zeit
u«12000 v. Chr. nicht belegt sind172. Da sich aber seit
der Urnm an Nar-Zeit das Klima nicht verändert hat,
ist davon auszugehen, daß auch der Pflanzenwuchs in
Mitteloman im wesentlichen gleich geblieben ist173.
Vor der Erschließung des Erdöls im Sultanat waren
Datteln der wichtigste Exportartikel174. Sie wachsen in
Mittel- und Nordoman in Höhen unter 2000 m175. Aus
Fundzusammenhängen, die bereits in die Umm an Nar-
Zeit datieren, sind Dattelsteine bekannt176. Nach dem
zahnärztlichen Befund der ausgegrabenen Skelette war
die Dattel ab der Lizq/Rumaylah-Zeit Hauptnahrungs-
mittel. Weniger verbreitet waren trockene Limonen,
frisches Obst und Salzfisch. Lorimer berichtete um die
Jahrhundertwende, daß in Samad al Shän Weizen, Ha-
fer, Gerste, Zuckerrohr und Luzerne177 angebaut wur-
den. In seinem Abschnitt über Samad erwähnt er keine
Datteln, obwohl sie noch heute das wichtigste Agrarpro-
dukt darstellen. Für eine Verschlechterung des Bodens
Sibt es bis heute keine Hinweise. Bis vor kurzem gin-
gen die Erträge der Dattelernte zurück, allerdings war
dies durch einen Mangel an Arbeitskräften bedingt178.
Stellenweise ist der Boden, besonders an der Bätinah
als Folge unsachgemäßer Bewässerung versalzen. Die
folgenreichsten menschlichen Eingriffe sind Überwei-
dung, Rodung und neuerdings die zu starke Förderung
v°n Wasser mit Hilfe von Pumpen. Meereswasserent-
salzungsanlagen und andere Maßnahmen werden heute
ungerichtet.
Oman besitzt ein reiches Vorkommen an Seetie-
ren. An der Küste sind Muschelhaufen untersucht wor-
den179. Ältere Muschelhaufen sind als Folge der Trans-
gressionen überschwemmt. Perlen der Perlmuschel wur-
den bereits im 3. Jahrtausend gehandelt und in den
sumerischen Texten als „Fischaugen" erwähnt. Sie
stammen nach wie vor eher aus Nordwest- als aus Osto-
man. Sowohl an der Küste wie im Binnenland sind Fi-
sche Bestandteil der Ernährung180.
Oman, insbesondere die Ostregion und al Bätinah,
ist ein führendes Zuchtgebiet für Kamele, obwohl diese
nicht exportiert werden181. Die dortigen Dalüls gehören
zu den besten Reitkamelen in ganz Arabien182. Von den
Beduinen werden z. T. Schafe, vor allem aber Ziegen
gehalten183. Rinder kommen in einigen Gegenden am
Golf und im Sultanat vor184. Pferde sind heute als Folge
einer Seuche selten in Oman, waren aber im Mittelalter
ein wichtiger Exportartikel aus al Shihr und Qalhät185.
Maultiere gibt es nicht, aber Esel sind an der arabischen
Seite des Golfs seit langem weit verbreitet186.
169 W. Frey/H. Kürschner 1989, 1.1 = Mangrovenwälder, 3.32 =
kälteharter, immergrüner offener Nadelwald, 5.1 = hartlaubrei-
che, extrem xeromorphe Offenwälder, 5.2 = Dorn-Offenwälder,
5.2/5.3 = Mischformation aus Dorn-Offenwälder (5.2) und trok-
kenkahlen, extrem xeromorphen Offenwäldern (5.3), 8.2 = sehr
offene xeromorphe Gebüschformationen (Halbwüstengebüsche),
9.4f = xeromorphe offene Zwergsträuche/zerstreuter Bewuchs
wüstenähnlicher Standorte, 9.6/17.1 = Mischformationen aus Xe-
romorphen, sehr offenen Zwerggesträuchen (9.6) und locker be-
wachsenen Dünen (17.1), 9.6b, 14 = krautige undhalbstrauchige
Salzpflanzenfluren, 17.1 = locker bewachsene Dünen, 18=Wü-
ste, 18.1 = Salzwüste.
170 R. Maxwell-Hyslop 1983, 67-72; I. Gershevitch 1957,
317-320.
171 Brief K Kramer, Heidelberg mit Literaturangaben. Sh. Ghazanfar
1992,67; E.L. Little/RO. Woodbury/F.H. Wadsworth 1974,290;
A.P. Benthall 1933,152; D. Brandes 1972,149, Taf. 24.
172 D. Eckstein/W. Liese/J. Stieber 1987,429.
173 D. Eckstein/W. Liese/J. Stieber 1987,429-430.
174 C. Niebuhr 1772,295; J. G. Lorimer HC 1908,1413.
175 J. G. Lorimer I Teil H 1915,2294.
176 G. Weisgerber, in: MAYSAR, 197; Makkan-Dattel(palmen) sind
in sumerischen Texten lexikalisch belegt (MSL 5,117,286; W.
Heimpel 1987,198).
177 J. G. Lorimer I Teil H 1915,1662.
178 J. C. Wilkinson 1977, 29. Vergleiche Tnformauonsministerium
1993,100, wonach die Produktion wieder gestiegen ist.
179 M. Tosi 1975,194; A. Coppa et al. 1985,97-102.
180 J. G. Lorimer HC 1908, 1413. Fischknochen in den Gräbern:
Wädl Süq-Zeit: Gr. S101122. Samad-Zeit: Gr. S10685, S2162,
S2606, S2616, S3017A.
181 J. G. Lorimer I Teil H 1915,2334.
182 J. G. Lorimer I Teil JJ 1915,2334.
183 J. G. Lorimer I Teil H 1915,2344.
184 J. G. Lorimer I Teil U 1915,2343.
185 J. G. Lorimer I Teil H 1915,2335. Pferde exportiert von „Esher"
(al Shihr, Hadramawt) nach Indien: H. Yule 1903, H, 378,379.
Für den Pferdehandel Qalhäts im Jahre 1517 bezeugt, ebd. 282,
381; E. C. Ross 1874,186; R B. Serjeant 1963,27.
186 J. G. Lorimer I Teil II1915,2340,2342; Ibn Baftüta Kapitel 7:
229 (S. 399) zum Eselfleisch.