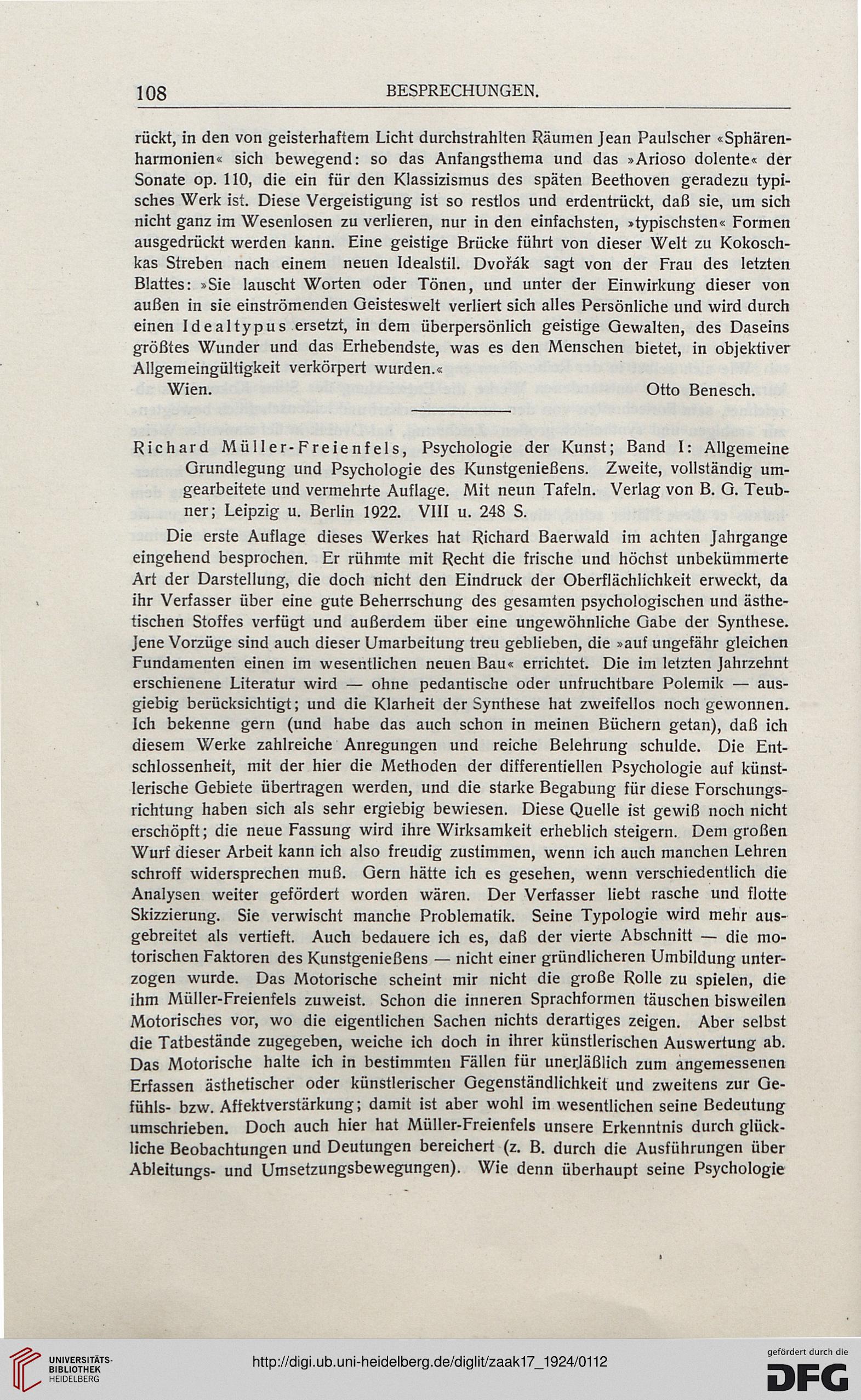108 BESPRECHUNGEN.
rückt, in den von geisterhaftem Licht durchstrahlten Räumen Jean Paulscher «Sphären-
harmonien« sich bewegend: so das Anfangsthema und das »Arioso dolente« der
Sonate op. 110, die ein für den Klassizismus des späten Beethoven geradezu typi-
sches Werk ist. Diese Vergeistigung ist so restlos und erdentrückt, daß sie, um sich
nicht ganz im Wesenlosen zu verlieren, nur in den einfachsten, »typischsten« Formen
ausgedrückt werden kann. Eine geistige Brücke führt von dieser Welt zu Kokosch-
kas Streben nach einem neuen Idealstil. Dvorak sagt von der Frau des letzten
Blattes: »Sie lauscht Worten oder Tönen, und unter der Einwirkung dieser von
außen in sie einströmenden Geisteswelt verliert sich alles Persönliche und wird durch
einen Idealtypus ersetzt, in dem überpersönlich geistige Gewalten, des Daseins
größtes Wunder und das Erhebendste, was es den Menschen bietet, in objektiver
Allgemeingültigkeit verkörpert wurden.«
Wien. Otto Benesch.
Richard Müll er-Freienfels, Psychologie der Kunst; Band I: Allgemeine
Grundlegung und Psychologie des Kunstgenießens. Zweite, vollständig um-
gearbeitete und vermehrte Auflage. Mit neun Tafeln. Verlag von B. G. Teub-
ner; Leipzig u. Berlin 1922. VIII u. 248 S.
Die erste Auflage dieses Werkes hat Richard Baerwald im achten Jahrgange
eingehend besprochen. Er rühmte mit Recht die frische und höchst unbekümmerte
Art der Darstellung, die doch nicht den Eindruck der Oberflächlichkeit erweckt, da
ihr Verfasser über eine gute Beherrschung des gesamten psychologischen und ästhe-
tischen Stoffes verfügt und außerdem über eine ungewöhnliche Gabe der Synthese.
Jene Vorzüge sind auch dieser Umarbeitung treu geblieben, die »auf ungefähr gleichen
Fundamenten einen im wesentlichen neuen Bau« errichtet. Die im letzten Jahrzehnt
erschienene Literatur wird — ohne pedantische oder unfruchtbare Polemik — aus-
giebig berücksichtigt; und die Klarheit der Synthese hat zweifellos noch gewonnen.
Ich bekenne gern (und habe das auch schon in meinen Büchern getan), daß ich
diesem Werke zahlreiche Anregungen und reiche Belehrung schulde. Die Ent-
schlossenheit, mit der hier die Methoden der differentiellen Psychologie auf künst-
lerische Gebiete übertragen werden, und die starke Begabung für diese Forschungs-
richtung haben sich als sehr ergiebig bewiesen. Diese Quelle ist gewiß noch nicht
erschöpft; die neue Fassung wird ihre Wirksamkeit erheblich steigern. Dem großen
Wurf dieser Arbeit kann ich also freudig zustimmen, wenn ich auch manchen Lehren
schroff widersprechen muß. Gern hätte ich es gesehen, wenn verschiedentlich die
Analysen weiter gefördert worden wären. Der Verfasser liebt rasche und flotte
Skizzierung. Sie verwischt manche Problematik. Seine Typologie wird mehr aus-
gebreitet als vertieft. Auch bedauere ich es, daß der vierte Abschnitt — die mo-
torischen Faktoren des Kunstgenießens — nicht einer gründlicheren Umbildung unter-
zogen wurde. Das Motorische scheint mir nicht die große Rolle zu spielen, die
ihm Müller-Freienfels zuweist. Schon die inneren Sprachformen täuschen bisweilen
Motorisches vor, wo die eigentlichen Sachen nichts derartiges zeigen. Aber selbst
die Tatbestände zugegeben, weiche ich doch in ihrer künstlerischen Auswertung ab.
Das Motorische halte ich in bestimmten Fällen für unerjäßlich zum angemessenen
Erfassen ästhetischer oder künstlerischer Gegenständlichkeit und zweitens zur Ge-
fühls- bzw. Affektverstärkung; damit ist aber wohl im wesentlichen seine Bedeutung
umschrieben. Doch auch hier hat Müller-Freienfels unsere Erkenntnis durch glück-
liche Beobachtungen und Deutungen bereichert (z. B. durch die Ausführungen über
Ableitungs- und Umsetzungsbewegungen). Wie denn überhaupt seine Psychologie
rückt, in den von geisterhaftem Licht durchstrahlten Räumen Jean Paulscher «Sphären-
harmonien« sich bewegend: so das Anfangsthema und das »Arioso dolente« der
Sonate op. 110, die ein für den Klassizismus des späten Beethoven geradezu typi-
sches Werk ist. Diese Vergeistigung ist so restlos und erdentrückt, daß sie, um sich
nicht ganz im Wesenlosen zu verlieren, nur in den einfachsten, »typischsten« Formen
ausgedrückt werden kann. Eine geistige Brücke führt von dieser Welt zu Kokosch-
kas Streben nach einem neuen Idealstil. Dvorak sagt von der Frau des letzten
Blattes: »Sie lauscht Worten oder Tönen, und unter der Einwirkung dieser von
außen in sie einströmenden Geisteswelt verliert sich alles Persönliche und wird durch
einen Idealtypus ersetzt, in dem überpersönlich geistige Gewalten, des Daseins
größtes Wunder und das Erhebendste, was es den Menschen bietet, in objektiver
Allgemeingültigkeit verkörpert wurden.«
Wien. Otto Benesch.
Richard Müll er-Freienfels, Psychologie der Kunst; Band I: Allgemeine
Grundlegung und Psychologie des Kunstgenießens. Zweite, vollständig um-
gearbeitete und vermehrte Auflage. Mit neun Tafeln. Verlag von B. G. Teub-
ner; Leipzig u. Berlin 1922. VIII u. 248 S.
Die erste Auflage dieses Werkes hat Richard Baerwald im achten Jahrgange
eingehend besprochen. Er rühmte mit Recht die frische und höchst unbekümmerte
Art der Darstellung, die doch nicht den Eindruck der Oberflächlichkeit erweckt, da
ihr Verfasser über eine gute Beherrschung des gesamten psychologischen und ästhe-
tischen Stoffes verfügt und außerdem über eine ungewöhnliche Gabe der Synthese.
Jene Vorzüge sind auch dieser Umarbeitung treu geblieben, die »auf ungefähr gleichen
Fundamenten einen im wesentlichen neuen Bau« errichtet. Die im letzten Jahrzehnt
erschienene Literatur wird — ohne pedantische oder unfruchtbare Polemik — aus-
giebig berücksichtigt; und die Klarheit der Synthese hat zweifellos noch gewonnen.
Ich bekenne gern (und habe das auch schon in meinen Büchern getan), daß ich
diesem Werke zahlreiche Anregungen und reiche Belehrung schulde. Die Ent-
schlossenheit, mit der hier die Methoden der differentiellen Psychologie auf künst-
lerische Gebiete übertragen werden, und die starke Begabung für diese Forschungs-
richtung haben sich als sehr ergiebig bewiesen. Diese Quelle ist gewiß noch nicht
erschöpft; die neue Fassung wird ihre Wirksamkeit erheblich steigern. Dem großen
Wurf dieser Arbeit kann ich also freudig zustimmen, wenn ich auch manchen Lehren
schroff widersprechen muß. Gern hätte ich es gesehen, wenn verschiedentlich die
Analysen weiter gefördert worden wären. Der Verfasser liebt rasche und flotte
Skizzierung. Sie verwischt manche Problematik. Seine Typologie wird mehr aus-
gebreitet als vertieft. Auch bedauere ich es, daß der vierte Abschnitt — die mo-
torischen Faktoren des Kunstgenießens — nicht einer gründlicheren Umbildung unter-
zogen wurde. Das Motorische scheint mir nicht die große Rolle zu spielen, die
ihm Müller-Freienfels zuweist. Schon die inneren Sprachformen täuschen bisweilen
Motorisches vor, wo die eigentlichen Sachen nichts derartiges zeigen. Aber selbst
die Tatbestände zugegeben, weiche ich doch in ihrer künstlerischen Auswertung ab.
Das Motorische halte ich in bestimmten Fällen für unerjäßlich zum angemessenen
Erfassen ästhetischer oder künstlerischer Gegenständlichkeit und zweitens zur Ge-
fühls- bzw. Affektverstärkung; damit ist aber wohl im wesentlichen seine Bedeutung
umschrieben. Doch auch hier hat Müller-Freienfels unsere Erkenntnis durch glück-
liche Beobachtungen und Deutungen bereichert (z. B. durch die Ausführungen über
Ableitungs- und Umsetzungsbewegungen). Wie denn überhaupt seine Psychologie