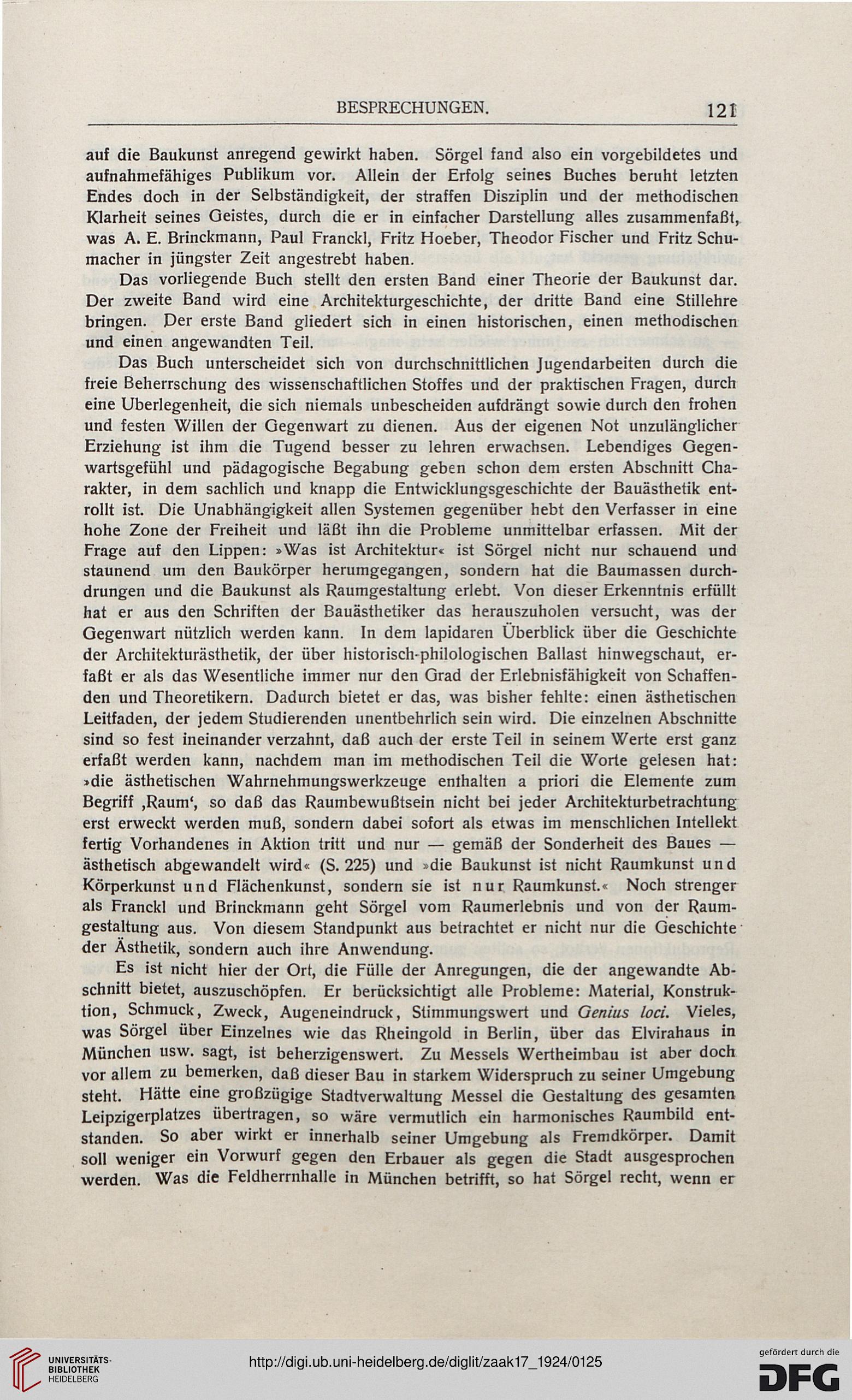BESPRECHUNGEN. 121
auf die Baukunst anregend gewirkt haben. Sörgel fand also ein vorgebildetes und
aufnahmefähiges Publikum vor. Allein der Erfolg seines Buches beruht letzten
Endes doch in der Selbständigkeit, der straffen Disziplin und der methodischen
Klarheit seines Geistes, durch die er in einfacher Darstellung alles zusammenfaßt,
was A. E. Brinckmann, Paul Franckl, Fritz Hoeber, Theodor Fischer und Fritz Schu-
macher in jüngster Zeit angestrebt haben.
Das vorliegende Buch stellt den ersten Band einer Theorie der Baukunst dar.
Der zweite Band wird eine Architekturgeschichte, der dritte Band eine Stillehre
bringen. Der erste Band gliedert sich in einen historischen, einen methodischen
und einen angewandten Teil.
Das Buch unterscheidet sich von durchschnittlichen Jugendarbeiten durch die
freie Beherrschung des wissenschaftlichen Stoffes und der praktischen Fragen, durch
eine Überlegenheit, die sich niemals unbescheiden aufdrängt sowie durch den frohen
und festen Willen der Gegenwart zu dienen. Aus der eigenen Not unzulänglicher
Erziehung ist ihm die Tugend besser zu lehren erwachsen. Lebendiges Gegen-
wartsgefühl und pädagogische Begabung geben schon dem ersten Abschnitt Cha-
rakter, in dem sachlich und knapp die Entwicklungsgeschichte der Bauästhetik ent-
rollt ist. Die Unabhängigkeit allen Systemen gegenüber hebt den Verfasser in eine
hohe Zone der Freiheit und läßt ihn die Probleme unmittelbar erfassen. Mit der
Frage auf den Lippen: »Was ist Architektur« ist Sörgel nicht nur schauend und
staunend um den Baukörper herumgegangen, sondern hat die Baumassen durch-
drungen und die Baukunst als Raumgestaltung erlebt. Von dieser Erkenntnis erfüllt
hat er aus den Schriften der Bauästhetiker das herauszuholen versucht, was der
Gegenwart nützlich werden kann. In dem lapidaren Überblick über die Geschichte
der Architekturästhetik, der über historisch-philologischen Ballast hinwegschaut, er-
faßt er als das Wesentliche immer nur den Grad der Erlebnisfähigkeit von Schaffen-
den und Theoretikern. Dadurch bietet er das, was bisher fehlte: einen ästhetischen
Leitfaden, der jedem Studierenden unentbehrlich sein wird. Die einzelnen Abschnitte
sind so fest ineinander verzahnt, daß auch der erste Teil in seinem Werte erst ganz
erfaßt werden kann, nachdem man im methodischen Teil die Worte gelesen hat:
>die ästhetischen Wahrnehmungswerkzeuge enthalten a priori die Elemente zum
Begriff ,Raum', so daß das Raumbewußtsein nicht bei jeder Architekturbetrachtung
erst erweckt werden muß, sondern dabei sofort als etwas im menschlichen Intellekt
fertig Vorhandenes in Aktion tritt und nur — gemäß der Sonderheit des Baues —
ästhetisch abgewandelt wird« (S. 225) und »die Baukunst ist nicht Raumkunst und
Körperkunst und Flächenkunst, sondern sie ist nur Raumkunst.« Noch strenger
als Franckl und Brinckmann geht Sörgel vom Raumerlebnis und von der Raum-
gestaltung aus. Von diesem Standpunkt aus betrachtet er nicht nur die Geschichte
der Ästhetik, sondern auch ihre Anwendung.
Es ist nicht hier der Ort, die Fülle der Anregungen, die der angewandte Ab-
schnitt bietet, auszuschöpfen. Er berücksichtigt alle Probleme: Material, Konstruk-
tion, Schmuck, Zweck, Augeneindruck, Slimmungswert und Genius loci. Vieles,
was Sörgel über Einzelnes wie das Rheingold in Berlin, über das Elvirahaus in
München usw. sagt, ist beherzigenswert. Zu Messeis Wertheimbau ist aber doch
vor allem zu bemerken, daß dieser Bau in starkem Widerspruch zu seiner Umgebung
steht. Hätte eine großzügige Stadtverwaltung Messel die Gestaltung des gesamten
Leipzigerplatzes übertragen, so wäre vermutlich ein harmonisches Raumbild ent-
standen. So aber wirkt er innerhalb seiner Umgebung als Fremdkörper. Damit
soll weniger ein Vorwurf gegen den Erbauer als gegen die Stadt ausgesprochen
werden. Was die Feldherrnhalle in München betrifft, so hat Sörgel recht, wenn er
auf die Baukunst anregend gewirkt haben. Sörgel fand also ein vorgebildetes und
aufnahmefähiges Publikum vor. Allein der Erfolg seines Buches beruht letzten
Endes doch in der Selbständigkeit, der straffen Disziplin und der methodischen
Klarheit seines Geistes, durch die er in einfacher Darstellung alles zusammenfaßt,
was A. E. Brinckmann, Paul Franckl, Fritz Hoeber, Theodor Fischer und Fritz Schu-
macher in jüngster Zeit angestrebt haben.
Das vorliegende Buch stellt den ersten Band einer Theorie der Baukunst dar.
Der zweite Band wird eine Architekturgeschichte, der dritte Band eine Stillehre
bringen. Der erste Band gliedert sich in einen historischen, einen methodischen
und einen angewandten Teil.
Das Buch unterscheidet sich von durchschnittlichen Jugendarbeiten durch die
freie Beherrschung des wissenschaftlichen Stoffes und der praktischen Fragen, durch
eine Überlegenheit, die sich niemals unbescheiden aufdrängt sowie durch den frohen
und festen Willen der Gegenwart zu dienen. Aus der eigenen Not unzulänglicher
Erziehung ist ihm die Tugend besser zu lehren erwachsen. Lebendiges Gegen-
wartsgefühl und pädagogische Begabung geben schon dem ersten Abschnitt Cha-
rakter, in dem sachlich und knapp die Entwicklungsgeschichte der Bauästhetik ent-
rollt ist. Die Unabhängigkeit allen Systemen gegenüber hebt den Verfasser in eine
hohe Zone der Freiheit und läßt ihn die Probleme unmittelbar erfassen. Mit der
Frage auf den Lippen: »Was ist Architektur« ist Sörgel nicht nur schauend und
staunend um den Baukörper herumgegangen, sondern hat die Baumassen durch-
drungen und die Baukunst als Raumgestaltung erlebt. Von dieser Erkenntnis erfüllt
hat er aus den Schriften der Bauästhetiker das herauszuholen versucht, was der
Gegenwart nützlich werden kann. In dem lapidaren Überblick über die Geschichte
der Architekturästhetik, der über historisch-philologischen Ballast hinwegschaut, er-
faßt er als das Wesentliche immer nur den Grad der Erlebnisfähigkeit von Schaffen-
den und Theoretikern. Dadurch bietet er das, was bisher fehlte: einen ästhetischen
Leitfaden, der jedem Studierenden unentbehrlich sein wird. Die einzelnen Abschnitte
sind so fest ineinander verzahnt, daß auch der erste Teil in seinem Werte erst ganz
erfaßt werden kann, nachdem man im methodischen Teil die Worte gelesen hat:
>die ästhetischen Wahrnehmungswerkzeuge enthalten a priori die Elemente zum
Begriff ,Raum', so daß das Raumbewußtsein nicht bei jeder Architekturbetrachtung
erst erweckt werden muß, sondern dabei sofort als etwas im menschlichen Intellekt
fertig Vorhandenes in Aktion tritt und nur — gemäß der Sonderheit des Baues —
ästhetisch abgewandelt wird« (S. 225) und »die Baukunst ist nicht Raumkunst und
Körperkunst und Flächenkunst, sondern sie ist nur Raumkunst.« Noch strenger
als Franckl und Brinckmann geht Sörgel vom Raumerlebnis und von der Raum-
gestaltung aus. Von diesem Standpunkt aus betrachtet er nicht nur die Geschichte
der Ästhetik, sondern auch ihre Anwendung.
Es ist nicht hier der Ort, die Fülle der Anregungen, die der angewandte Ab-
schnitt bietet, auszuschöpfen. Er berücksichtigt alle Probleme: Material, Konstruk-
tion, Schmuck, Zweck, Augeneindruck, Slimmungswert und Genius loci. Vieles,
was Sörgel über Einzelnes wie das Rheingold in Berlin, über das Elvirahaus in
München usw. sagt, ist beherzigenswert. Zu Messeis Wertheimbau ist aber doch
vor allem zu bemerken, daß dieser Bau in starkem Widerspruch zu seiner Umgebung
steht. Hätte eine großzügige Stadtverwaltung Messel die Gestaltung des gesamten
Leipzigerplatzes übertragen, so wäre vermutlich ein harmonisches Raumbild ent-
standen. So aber wirkt er innerhalb seiner Umgebung als Fremdkörper. Damit
soll weniger ein Vorwurf gegen den Erbauer als gegen die Stadt ausgesprochen
werden. Was die Feldherrnhalle in München betrifft, so hat Sörgel recht, wenn er