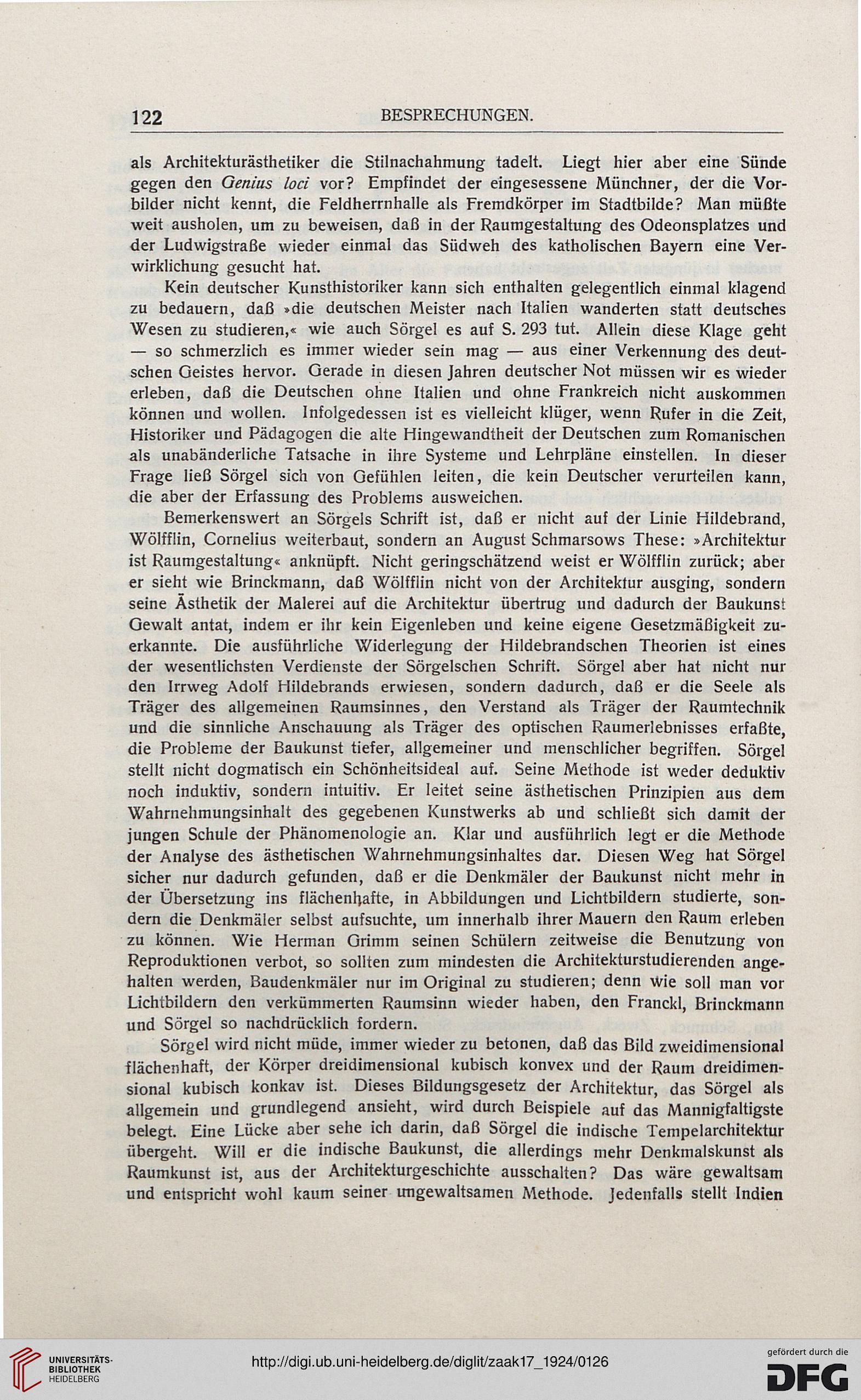122 BESPRECHUNGEN.
als Architekturästhetiker die Stilnachahmung tadelt. Liegt hier aber eine Sünde
gegen den Genius loci vor? Empfindet der eingesessene Münchner, der die Vor-
bilder nicht kennt, die Feldherrnhalle als Fremdkörper im Stadtbilde? Man müßte
weit ausholen, um zu beweisen, daß in der Raumgestaltung des Odeonsplatzes und
der Ludwigstraße wieder einmal das Südweh des katholischen Bayern eine Ver-
wirklichung gesucht hat.
Kein deutscher Kunsthistoriker kann sich enthalten gelegentlich einmal klagend
zu bedauern, daß »die deutschen Meister nach Italien wanderten statt deutsches
Wesen zu studieren,« wie auch Sörgel es auf S. 293 tut. Allein diese Klage geht
— so schmerzlich es immer wieder sein mag — aus einer Verkennung des deut-
schen Geistes hervor. Gerade in diesen Jahren deutscher Not müssen wir es wieder
erleben, daß die Deutschen ohne Italien und ohne Frankreich nicht auskommen
können und wollen. Infolgedessen ist es vielleicht klüger, wenn Rufer in die Zeit,
Historiker und Pädagogen die alte Hingewandtheit der Deutschen zum Romanischen
als unabänderliche Tatsache in ihre Systeme und Lehrpläne einstellen. In dieser
Frage ließ Sörgel sich von Gefühlen leiten, die kein Deutscher verurteilen kann,
die aber der Erfassung des Problems ausweichen.
Bemerkenswert an Sörgels Schrift ist, daß er nicht auf der Linie Hildebrand,
Wölfflin, Cornelius weiterbaut, sondern an August Schmarsows These: »Architektur
ist Raumgestaltung« anknüpft. Nicht geringschätzend weist er Wölfflin zurück; aber
er sieht wie Brinckmann, daß Wölfflin nicht von der Architektur ausging, sondern
seine Ästhetik der Malerei auf die Architektur übertrug und dadurch der Baukunst
Gewalt antat, indem er ihr kein Eigenleben und keine eigene Gesetzmäßigkeit zu-
erkannte. Die ausführliche Widerlegung der Hildebrandschen Theorien ist eines
der wesentlichsten Verdienste der Sörgelschen Schrift. Sörgel aber hat nicht nur
den Irrweg Adolf Hildebrands erwiesen, sondern dadurch, daß er die Seele als
Träger des allgemeinen Raumsinnes, den Verstand als Träger der Raumtechnik
und die sinnliche Anschauung als Träger des optischen Raumerlebnisses erfaßte,
die Probleme der Baukunst tiefer, allgemeiner und menschlicher begriffen. Sörgel
stellt nicht dogmatisch ein Schönheitsideal auf. Seine Methode ist weder deduktiv
noch induktiv, sondern intuitiv. Er leitet seine ästhetischen Prinzipien aus dem
Wahrnehmungsinhalt des gegebenen Kunstwerks ab und schließt sich damit der
jungen Schule der Phänomenologie an. Klar und ausführlich legt er die Methode
der Analyse des ästhetischen Wahrnehmungsinhaltes dar. Diesen Weg hat Sörgel
sicher nur dadurch gefunden, daß er die Denkmäler der Baukunst nicht mehr in
der Übersetzung ins flächenhafte, in Abbildungen und Lichtbildern studierte, son-
dern die Denkmäler selbst aufsuchte, um innerhalb ihrer Mauern den Raum erleben
zu können. Wie Herman Grimm seinen Schülern zeitweise die Benutzung von
Reproduktionen verbot, so sollten zum mindesten die Architekturstudierenden ange-
halten werden, Baudenkmäler nur im Original zu studieren; denn Wie soll man vor
Lichtbildern den verkümmerten Raumsinn wieder haben, den Franckl, Brinckmann
und Sörgel so nachdrücklich fordern.
Sörgel wird nicht müde, immer wieder zu betonen, daß das Bild zweidimensional
flächenhaft, der Körper dreidimensional kubisch konvex und der Raum dreidimen-
sional kubisch konkav ist. Dieses Bildungsgesetz der Architektur, das Sörgel als
allgemein und grundlegend ansieht, wird durch Beispiele auf das Mannigfaltigste
belegt. Eine Lücke aber sehe ich darin, daß Sörgel die indische Tempelarchitektur
übergeht. Will er die indische Baukunst, die allerdings mehr Denkmalskunst als
Raumkunst ist, aus der Architekturgeschichte ausschalten? Das wäre gewaltsam
und entspricht wohl kaum seiner imgewaltsamen Methode. Jedenfalls stellt Indien
als Architekturästhetiker die Stilnachahmung tadelt. Liegt hier aber eine Sünde
gegen den Genius loci vor? Empfindet der eingesessene Münchner, der die Vor-
bilder nicht kennt, die Feldherrnhalle als Fremdkörper im Stadtbilde? Man müßte
weit ausholen, um zu beweisen, daß in der Raumgestaltung des Odeonsplatzes und
der Ludwigstraße wieder einmal das Südweh des katholischen Bayern eine Ver-
wirklichung gesucht hat.
Kein deutscher Kunsthistoriker kann sich enthalten gelegentlich einmal klagend
zu bedauern, daß »die deutschen Meister nach Italien wanderten statt deutsches
Wesen zu studieren,« wie auch Sörgel es auf S. 293 tut. Allein diese Klage geht
— so schmerzlich es immer wieder sein mag — aus einer Verkennung des deut-
schen Geistes hervor. Gerade in diesen Jahren deutscher Not müssen wir es wieder
erleben, daß die Deutschen ohne Italien und ohne Frankreich nicht auskommen
können und wollen. Infolgedessen ist es vielleicht klüger, wenn Rufer in die Zeit,
Historiker und Pädagogen die alte Hingewandtheit der Deutschen zum Romanischen
als unabänderliche Tatsache in ihre Systeme und Lehrpläne einstellen. In dieser
Frage ließ Sörgel sich von Gefühlen leiten, die kein Deutscher verurteilen kann,
die aber der Erfassung des Problems ausweichen.
Bemerkenswert an Sörgels Schrift ist, daß er nicht auf der Linie Hildebrand,
Wölfflin, Cornelius weiterbaut, sondern an August Schmarsows These: »Architektur
ist Raumgestaltung« anknüpft. Nicht geringschätzend weist er Wölfflin zurück; aber
er sieht wie Brinckmann, daß Wölfflin nicht von der Architektur ausging, sondern
seine Ästhetik der Malerei auf die Architektur übertrug und dadurch der Baukunst
Gewalt antat, indem er ihr kein Eigenleben und keine eigene Gesetzmäßigkeit zu-
erkannte. Die ausführliche Widerlegung der Hildebrandschen Theorien ist eines
der wesentlichsten Verdienste der Sörgelschen Schrift. Sörgel aber hat nicht nur
den Irrweg Adolf Hildebrands erwiesen, sondern dadurch, daß er die Seele als
Träger des allgemeinen Raumsinnes, den Verstand als Träger der Raumtechnik
und die sinnliche Anschauung als Träger des optischen Raumerlebnisses erfaßte,
die Probleme der Baukunst tiefer, allgemeiner und menschlicher begriffen. Sörgel
stellt nicht dogmatisch ein Schönheitsideal auf. Seine Methode ist weder deduktiv
noch induktiv, sondern intuitiv. Er leitet seine ästhetischen Prinzipien aus dem
Wahrnehmungsinhalt des gegebenen Kunstwerks ab und schließt sich damit der
jungen Schule der Phänomenologie an. Klar und ausführlich legt er die Methode
der Analyse des ästhetischen Wahrnehmungsinhaltes dar. Diesen Weg hat Sörgel
sicher nur dadurch gefunden, daß er die Denkmäler der Baukunst nicht mehr in
der Übersetzung ins flächenhafte, in Abbildungen und Lichtbildern studierte, son-
dern die Denkmäler selbst aufsuchte, um innerhalb ihrer Mauern den Raum erleben
zu können. Wie Herman Grimm seinen Schülern zeitweise die Benutzung von
Reproduktionen verbot, so sollten zum mindesten die Architekturstudierenden ange-
halten werden, Baudenkmäler nur im Original zu studieren; denn Wie soll man vor
Lichtbildern den verkümmerten Raumsinn wieder haben, den Franckl, Brinckmann
und Sörgel so nachdrücklich fordern.
Sörgel wird nicht müde, immer wieder zu betonen, daß das Bild zweidimensional
flächenhaft, der Körper dreidimensional kubisch konvex und der Raum dreidimen-
sional kubisch konkav ist. Dieses Bildungsgesetz der Architektur, das Sörgel als
allgemein und grundlegend ansieht, wird durch Beispiele auf das Mannigfaltigste
belegt. Eine Lücke aber sehe ich darin, daß Sörgel die indische Tempelarchitektur
übergeht. Will er die indische Baukunst, die allerdings mehr Denkmalskunst als
Raumkunst ist, aus der Architekturgeschichte ausschalten? Das wäre gewaltsam
und entspricht wohl kaum seiner imgewaltsamen Methode. Jedenfalls stellt Indien