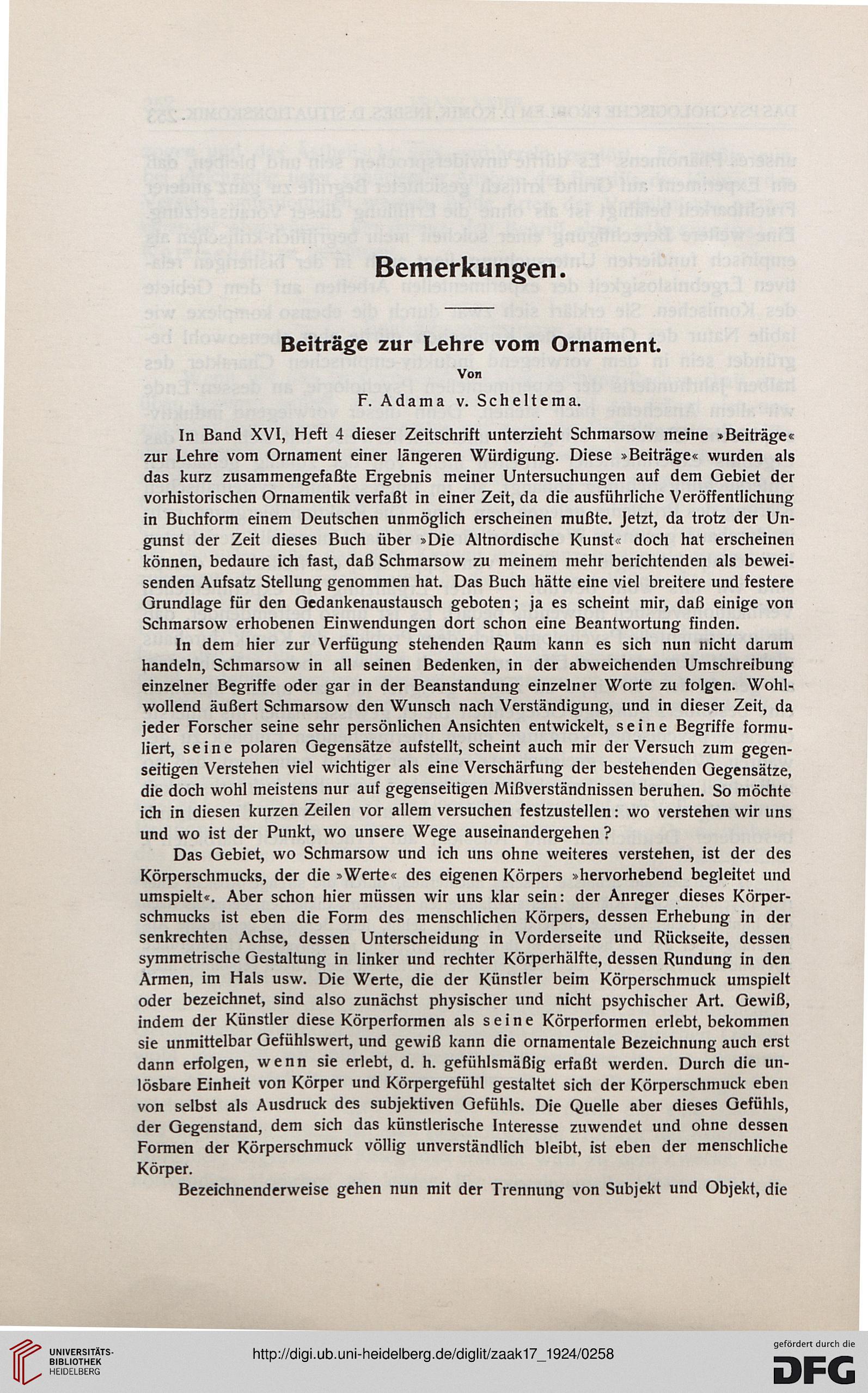Bemerkungen.
Beiträge zur Lehre vom Ornament.
Von
F. Adama v. Scheiterna.
In Band XVI, Heft 4 dieser Zeitschrift unterzieht Schmarsow meine »Beiträge«
zur Lehre vom Ornament einer längeren Würdigung. Diese »Beiträge« wurden als
das kurz zusammengefaßte Ergebnis meiner Untersuchungen auf dem Gebiet der
vorhistorischen Ornamentik verfaßt in einer Zeit, da die ausführliche Veröffentlichung
in Buchform einem Deutschen unmöglich erscheinen mußte. Jetzt, da trotz der Un-
gunst der Zeit dieses Buch über »Die Altnordische Kunst« doch hat erscheinen
können, bedaure ich fast, daß Schmarsow zu meinem mehr berichtenden als bewei-
senden Aufsatz Stellung genommen hat. Das Buch hätte eine viel breitere und festere
Grundlage für den Gedankenaustausch geboten; ja es scheint mir, daß einige von
Schmarsow erhobenen Einwendungen dort schon eine Beantwortung finden.
In dem hier zur Verfügung stehenden Raum kann es sich nun nicht darum
handeln, Schmarsow in all seinen Bedenken, in der abweichenden Umschreibung
einzelner Begriffe oder gar in der Beanstandung einzelner Worte zu folgen. Wohl-
wollend äußert Schmarsow den Wunsch nach Verständigung, und in dieser Zeit, da
jeder Forscher seine sehr persönlichen Ansichten entwickelt, seine Begriffe formu-
liert, seine polaren Gegensätze aufstellt, scheint auch mir der Versuch zum gegen-
seitigen Verstehen viel wichtiger als eine Verschärfung der bestehenden Gegensätze,
die doch wohl meistens nur auf gegenseitigen Mißverständnissen beruhen. So möchte
ich in diesen kurzen Zeilen vor allem versuchen festzustellen: wo verstehen wir uns
und wo ist der Punkt, wo unsere Wege auseinandergehen?
Das Gebiet, wo Schmarsow und ich uns ohne weiteres verstehen, ist der des
Körperschmucks, der die »Werte« des eigenen Körpers »hervorhebend begleitet und
umspielt«. Aber schon hier müssen wir uns klar sein: der Anreger dieses Körper-
schmucks ist eben die Form des menschlichen Körpers, dessen Erhebung in der
senkrechten Achse, dessen Unterscheidung in Vorderseite und Rückseite, dessen
symmetrische Gestaltung in linker und rechter Körperhälfte, dessen Rundung in den
Armen, im Hals usw. Die Werte, die der Künstler beim Körperschmuck umspielt
oder bezeichnet, sind also zunächst physischer und nicht psychischer Art. Gewiß,
indem der Künstler diese Körperformen als seine Körperformen erlebt, bekommen
sie unmittelbar Gefühlswert, und gewiß kann die ornamentale Bezeichnung auch erst
dann erfolgen, wenn sie erlebt, d. h. gefühlsmäßig erfaßt werden. Durch die un-
lösbare Einheit von Körper und Körpergefühl gestaltet sich der Körperschmuck eben
von selbst als Ausdruck des subjektiven Gefühls. Die Quelle aber dieses Gefühls,
der Gegenstand, dem sich das künstlerische Interesse zuwendet und ohne dessen
Formen der Körperschmuck völlig unverständlich bleibt, ist eben der menschliche
Körper.
Bezeichnenderweise gehen nun mit der Trennung von Subjekt und Objekt, die
Beiträge zur Lehre vom Ornament.
Von
F. Adama v. Scheiterna.
In Band XVI, Heft 4 dieser Zeitschrift unterzieht Schmarsow meine »Beiträge«
zur Lehre vom Ornament einer längeren Würdigung. Diese »Beiträge« wurden als
das kurz zusammengefaßte Ergebnis meiner Untersuchungen auf dem Gebiet der
vorhistorischen Ornamentik verfaßt in einer Zeit, da die ausführliche Veröffentlichung
in Buchform einem Deutschen unmöglich erscheinen mußte. Jetzt, da trotz der Un-
gunst der Zeit dieses Buch über »Die Altnordische Kunst« doch hat erscheinen
können, bedaure ich fast, daß Schmarsow zu meinem mehr berichtenden als bewei-
senden Aufsatz Stellung genommen hat. Das Buch hätte eine viel breitere und festere
Grundlage für den Gedankenaustausch geboten; ja es scheint mir, daß einige von
Schmarsow erhobenen Einwendungen dort schon eine Beantwortung finden.
In dem hier zur Verfügung stehenden Raum kann es sich nun nicht darum
handeln, Schmarsow in all seinen Bedenken, in der abweichenden Umschreibung
einzelner Begriffe oder gar in der Beanstandung einzelner Worte zu folgen. Wohl-
wollend äußert Schmarsow den Wunsch nach Verständigung, und in dieser Zeit, da
jeder Forscher seine sehr persönlichen Ansichten entwickelt, seine Begriffe formu-
liert, seine polaren Gegensätze aufstellt, scheint auch mir der Versuch zum gegen-
seitigen Verstehen viel wichtiger als eine Verschärfung der bestehenden Gegensätze,
die doch wohl meistens nur auf gegenseitigen Mißverständnissen beruhen. So möchte
ich in diesen kurzen Zeilen vor allem versuchen festzustellen: wo verstehen wir uns
und wo ist der Punkt, wo unsere Wege auseinandergehen?
Das Gebiet, wo Schmarsow und ich uns ohne weiteres verstehen, ist der des
Körperschmucks, der die »Werte« des eigenen Körpers »hervorhebend begleitet und
umspielt«. Aber schon hier müssen wir uns klar sein: der Anreger dieses Körper-
schmucks ist eben die Form des menschlichen Körpers, dessen Erhebung in der
senkrechten Achse, dessen Unterscheidung in Vorderseite und Rückseite, dessen
symmetrische Gestaltung in linker und rechter Körperhälfte, dessen Rundung in den
Armen, im Hals usw. Die Werte, die der Künstler beim Körperschmuck umspielt
oder bezeichnet, sind also zunächst physischer und nicht psychischer Art. Gewiß,
indem der Künstler diese Körperformen als seine Körperformen erlebt, bekommen
sie unmittelbar Gefühlswert, und gewiß kann die ornamentale Bezeichnung auch erst
dann erfolgen, wenn sie erlebt, d. h. gefühlsmäßig erfaßt werden. Durch die un-
lösbare Einheit von Körper und Körpergefühl gestaltet sich der Körperschmuck eben
von selbst als Ausdruck des subjektiven Gefühls. Die Quelle aber dieses Gefühls,
der Gegenstand, dem sich das künstlerische Interesse zuwendet und ohne dessen
Formen der Körperschmuck völlig unverständlich bleibt, ist eben der menschliche
Körper.
Bezeichnenderweise gehen nun mit der Trennung von Subjekt und Objekt, die