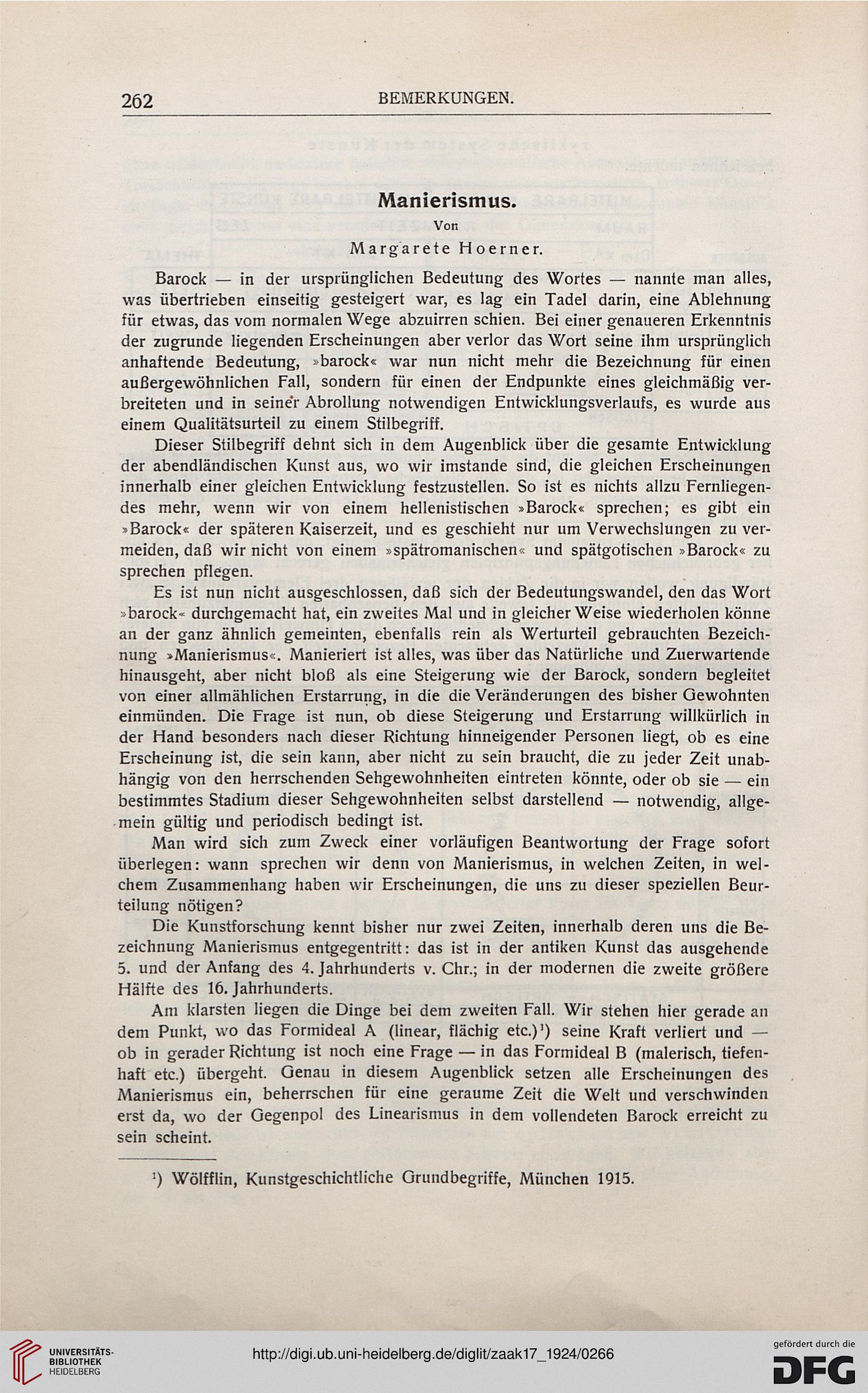262 BEMERKUNGEN.
Manierismus.
Von
Margarete Hoerner.
Barock — in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes — nannte man alles,
was übertrieben einseitig gesteigert war, es lag ein Tadel darin, eine Ablehnung
für etwas, das vom normalen Wege abzuirren schien. Bei einer genaueren Erkenntnis
der zugrunde liegenden Erscheinungen aber verlor das Wort seine ihm ursprünglich
anhaftende Bedeutung, »barock« war nun nicht mehr die Bezeichnung für einen
außergewöhnlichen Fall, sondern für einen der Endpunkte eines gleichmäßig ver-
breiteten und in seine'r Abrollung notwendigen Entwicklungsverlaufs, es wurde aus
einem Qualitätsurteil zu einem Stilbegriff.
Dieser Stilbegriff dehnt sich in dem Augenblick über die gesamte Entwicklung
der abendländischen Kunst aus, wo wir imstande sind, die gleichen Erscheinungen
innerhalb einer gleichen Entwicklung festzustellen. So ist es nichts allzu Fernliegen-
des mehr, wenn wir von einem hellenistischen »Barock« sprechen; es gibt ein
»Barock« der späteren Kaiserzeit, und es geschieht nur um Verwechslungen zu ver-
meiden, daß wir nicht von einem »spätromanischen« und spätgotischen »Barock« zu
sprechen pflegen.
Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß sich der Bedeutungswandel, den das Wort
»barock« durchgemacht hat, ein zweites Mal und in gleicherweise wiederholen könne
an der ganz ähnlich gemeinten, ebenfalls rein als Werturteil gebrauchten Bezeich-
nung »Manierismus«;. Manieriert ist alles, was über das Natürliche und Zuerwartende
hinausgeht, aber nicht bloß als eine Steigerung wie der Barock, sondern begleitet
von einer allmählichen Erstarrung, in die die Veränderungen des bisher Gewohnten
einmünden. Die Frage ist nun, ob diese Steigerung und Erstarrung willkürlich in
der Hand besonders nach dieser Richtung hinneigender Personen liegt, ob es eine
Erscheinung ist, die sein kann, aber nicht zu sein braucht, die zu jeder Zeit unab-
hängig von den herrschenden Sehgewohnheiten eintreten könnte, oder ob sie — ein
bestimmtes Stadium dieser Sehgewohnheiten selbst darstellend — notwendig, allge-
mein gültig und periodisch bedingt ist.
Man wird sich zum Zweck einer vorläufigen Beantwortung der Frage sofort
überlegen: wann sprechen wir denn von Manierismus, in welchen Zeiten, in wel-
chem Zusammenhang haben wir Erscheinungen, die uns zu dieser speziellen Beur-
teilung nötigen?
Die Kunstforschung kennt bisher nur zwei Zeiten, innerhalb deren uns die Be-
zeichnung Manierismus entgegentritt: das ist in der antiken Kunst das ausgehende
5. und der Anfang des 4. Jahrhunderts v. Chr.; in der modernen die zweite größere
Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Am klarsten liegen die Dinge bei dem zweiten Fall. Wir stehen hier gerade an
dem Punkt, wo das Formideal A (linear, flächig etc.)') seine Kraft verliert und —
ob in gerader Richtung ist noch eine Frage — in das Formideal B (malerisch, tiefen-
haft etc.) übergeht. Genau in diesem Augenblick setzen alle Erscheinungen des
Manierismus ein, beherrschen für eine geraume Zeit die Welt und verschwinden
erst da, wo der Gegenpol des Linearismus in dem vollendeten Barock erreicht zu
sein scheint.
') Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, München 1915.
Manierismus.
Von
Margarete Hoerner.
Barock — in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes — nannte man alles,
was übertrieben einseitig gesteigert war, es lag ein Tadel darin, eine Ablehnung
für etwas, das vom normalen Wege abzuirren schien. Bei einer genaueren Erkenntnis
der zugrunde liegenden Erscheinungen aber verlor das Wort seine ihm ursprünglich
anhaftende Bedeutung, »barock« war nun nicht mehr die Bezeichnung für einen
außergewöhnlichen Fall, sondern für einen der Endpunkte eines gleichmäßig ver-
breiteten und in seine'r Abrollung notwendigen Entwicklungsverlaufs, es wurde aus
einem Qualitätsurteil zu einem Stilbegriff.
Dieser Stilbegriff dehnt sich in dem Augenblick über die gesamte Entwicklung
der abendländischen Kunst aus, wo wir imstande sind, die gleichen Erscheinungen
innerhalb einer gleichen Entwicklung festzustellen. So ist es nichts allzu Fernliegen-
des mehr, wenn wir von einem hellenistischen »Barock« sprechen; es gibt ein
»Barock« der späteren Kaiserzeit, und es geschieht nur um Verwechslungen zu ver-
meiden, daß wir nicht von einem »spätromanischen« und spätgotischen »Barock« zu
sprechen pflegen.
Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß sich der Bedeutungswandel, den das Wort
»barock« durchgemacht hat, ein zweites Mal und in gleicherweise wiederholen könne
an der ganz ähnlich gemeinten, ebenfalls rein als Werturteil gebrauchten Bezeich-
nung »Manierismus«;. Manieriert ist alles, was über das Natürliche und Zuerwartende
hinausgeht, aber nicht bloß als eine Steigerung wie der Barock, sondern begleitet
von einer allmählichen Erstarrung, in die die Veränderungen des bisher Gewohnten
einmünden. Die Frage ist nun, ob diese Steigerung und Erstarrung willkürlich in
der Hand besonders nach dieser Richtung hinneigender Personen liegt, ob es eine
Erscheinung ist, die sein kann, aber nicht zu sein braucht, die zu jeder Zeit unab-
hängig von den herrschenden Sehgewohnheiten eintreten könnte, oder ob sie — ein
bestimmtes Stadium dieser Sehgewohnheiten selbst darstellend — notwendig, allge-
mein gültig und periodisch bedingt ist.
Man wird sich zum Zweck einer vorläufigen Beantwortung der Frage sofort
überlegen: wann sprechen wir denn von Manierismus, in welchen Zeiten, in wel-
chem Zusammenhang haben wir Erscheinungen, die uns zu dieser speziellen Beur-
teilung nötigen?
Die Kunstforschung kennt bisher nur zwei Zeiten, innerhalb deren uns die Be-
zeichnung Manierismus entgegentritt: das ist in der antiken Kunst das ausgehende
5. und der Anfang des 4. Jahrhunderts v. Chr.; in der modernen die zweite größere
Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Am klarsten liegen die Dinge bei dem zweiten Fall. Wir stehen hier gerade an
dem Punkt, wo das Formideal A (linear, flächig etc.)') seine Kraft verliert und —
ob in gerader Richtung ist noch eine Frage — in das Formideal B (malerisch, tiefen-
haft etc.) übergeht. Genau in diesem Augenblick setzen alle Erscheinungen des
Manierismus ein, beherrschen für eine geraume Zeit die Welt und verschwinden
erst da, wo der Gegenpol des Linearismus in dem vollendeten Barock erreicht zu
sein scheint.
') Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, München 1915.