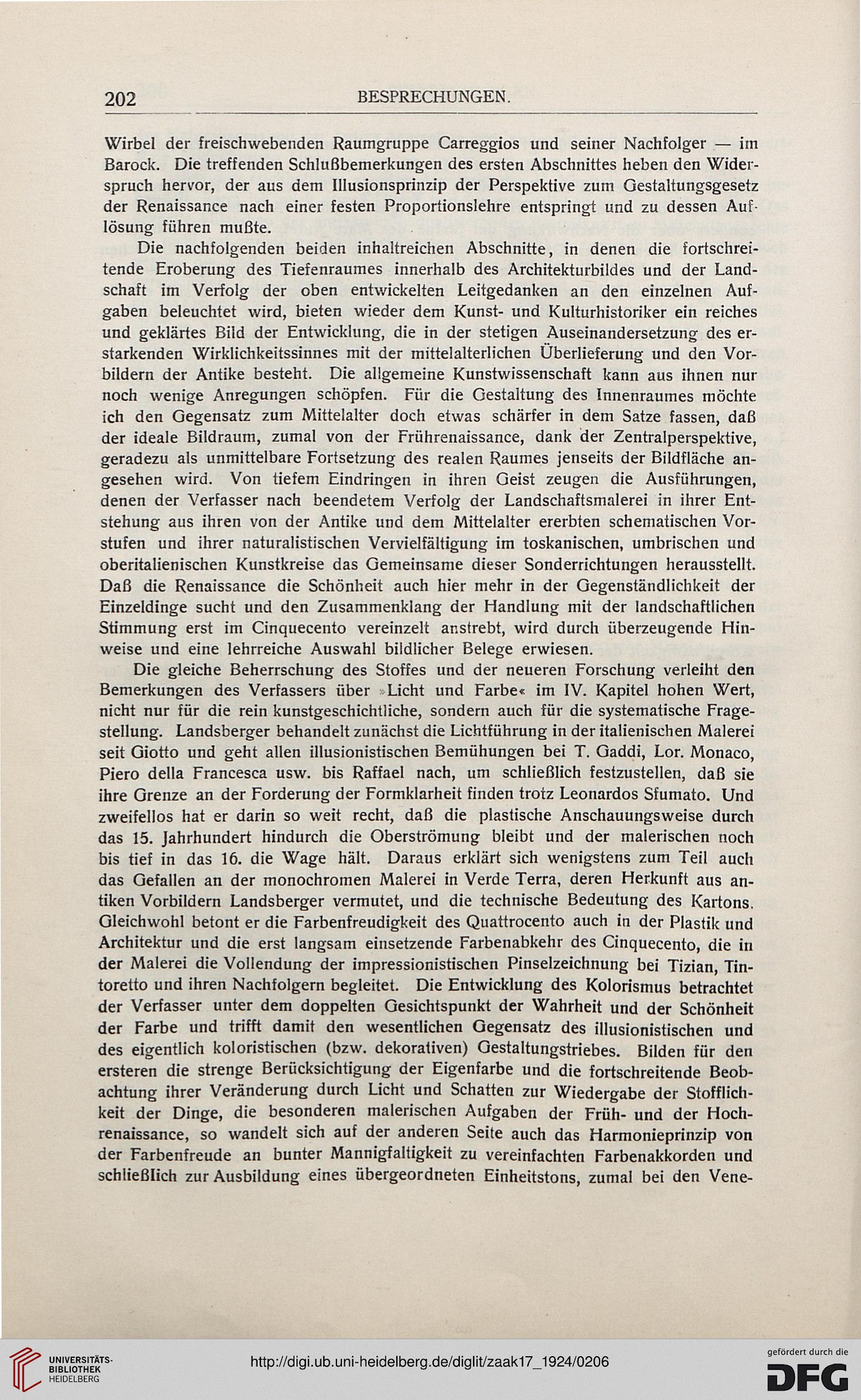202 BESPRECHUNGEN.
Wirbel der freischwebenden Raumgruppe Carreggios und seiner Nachfolger — im
Barock. Die treffenden Schlußbemerkungen des ersten Abschnittes heben den Wider-
spruch hervor, der aus dem Illusionsprinzip der Perspektive zum Oestaltungsgesetz
der Renaissance nach einer festen Proportionslehre entspringt und zu dessen Auf-
lösung führen mußte.
Die nachfolgenden beiden inhaltreichen Abschnitte, in denen die fortschrei-
tende Eroberung des Tiefenraumes innerhalb des Architekturbildes und der Land-
schaft im Verfolg der oben entwickelten Leitgedanken an den einzelnen Auf-
gaben beleuchtet wird, bieten wieder dem Kunst- und Kulturhistoriker ein reiches
und geklärtes Bild der Entwicklung, die in der stetigen Auseinandersetzung des er-
starkenden Wirklichkeitssinnes mit der mittelalterlichen Überlieferung und den Vor-
bildern der Antike besteht. Die allgemeine Kunstwissenschaft kann aus ihnen nur
noch wenige Anregungen schöpfen. Für die Gestaltung des Innenraumes möchte
ich den Gegensatz zum Mittelalter doch etwas schärfer in dem Satze fassen, daß
der ideale Bildraum, zumal von der Frührenaissance, dank der Zentralperspektive,
geradezu als unmittelbare Fortsetzung des realen Raumes jenseits der Bildfläche an-
gesehen wird. Von tiefem Eindringen in ihren Geist zeugen die Ausführungen,
denen der Verfasser nach beendetem Verfolg der Landschaftsmalerei in ihrer Ent-
stehung aus ihren von der Antike und dem Mittelalter ererbten schematischen Vor-
stufen und ihrer naturalistischen Vervielfältigung im toskanischen, umbrischen und
oberitalienischen Kunstkreise das Gemeinsame dieser Sonderrichtungen herausstellt.
Daß die Renaissance die Schönheit auch hier mehr in der Gegenständlichkeit der
Einzeldinge sucht und den Zusammenklang der Handlung mit der landschaftlichen
Stimmung erst im Cinquecento vereinzelt anstrebt, wird durch überzeugende Hin-
weise und eine lehrreiche Auswahl bildlicher Belege erwiesen.
Die gleiche Beherrschung des Stoffes und der neueren Forschung verleiht den
Bemerkungen des Verfassers über Licht und Farbe« im IV. Kapitel hohen Wert,
nicht nur für die rein kunstgeschichtliche, sondern auch für die systematische Frage-
stellung. Landsberger behandelt zunächst die Lichtführung in der italienischen Malerei
seit Giotto und geht allen illusionistischen Bemühungen bei T. Gaddi, Lor. Monaco,
Piero della Francesca usw. bis Raffael nach, um schließlich festzustellen, daß sie
ihre Grenze an der Forderung der Formklarheit finden trotz Leonardos Sfumato. Und
zweifellos hat er darin so weit recht, daß die plastische Anschauungsweise durch
das 15. Jahrhundert hindurch die Oberströmung bleibt und der malerischen noch
bis tief in das 16. die Wage hält. Daraus erklärt sich wenigstens zum Teil auch
das Gefallen an der monochromen Malerei in Verde Terra, deren Herkunft aus an-
tiken Vorbildern Landsberger vermutet, und die technische Bedeutung des Kartons.
Gleichwohl betont er die Farbenfreudigkeit des Quattrocento auch in der Plastik und
Architektur und die erst langsam einsetzende Farbenabkehr des Cinquecento, die in
der Malerei die Vollendung der impressionistischen Pinselzeichnung bei Tizian, Tin-
toretto und ihren Nachfolgern begleitet. Die Entwicklung des Kolorismus betrachtet
der Verfasser unter dem doppelten Gesichtspunkt der Wahrheit und der Schönheit
der Farbe und trifft damit den wesentlichen Gegensatz des illusionistischen und
des eigentlich koloristischen (bzw. dekorativen) Gestaltungstriebes. Bilden für den
ersteren die strenge Berücksichtigung der Eigenfarbe und die fortschreitende Beob-
achtung ihrer Veränderung durch Licht und Schatten zur Wiedergabe der Stofflich-
keit der Dinge, die besonderen malerischen Aufgaben der Früh- und der Hoch-
renaissance, so wandelt sich auf der anderen Seite auch das Harmonieprinzip von
der Farbenfreude an bunter Mannigfaltigkeit zu vereinfachten Farbenakkorden und
schließlich zur Ausbildung eines übergeordneten Einheitstons, zumal bei den Vene-
Wirbel der freischwebenden Raumgruppe Carreggios und seiner Nachfolger — im
Barock. Die treffenden Schlußbemerkungen des ersten Abschnittes heben den Wider-
spruch hervor, der aus dem Illusionsprinzip der Perspektive zum Oestaltungsgesetz
der Renaissance nach einer festen Proportionslehre entspringt und zu dessen Auf-
lösung führen mußte.
Die nachfolgenden beiden inhaltreichen Abschnitte, in denen die fortschrei-
tende Eroberung des Tiefenraumes innerhalb des Architekturbildes und der Land-
schaft im Verfolg der oben entwickelten Leitgedanken an den einzelnen Auf-
gaben beleuchtet wird, bieten wieder dem Kunst- und Kulturhistoriker ein reiches
und geklärtes Bild der Entwicklung, die in der stetigen Auseinandersetzung des er-
starkenden Wirklichkeitssinnes mit der mittelalterlichen Überlieferung und den Vor-
bildern der Antike besteht. Die allgemeine Kunstwissenschaft kann aus ihnen nur
noch wenige Anregungen schöpfen. Für die Gestaltung des Innenraumes möchte
ich den Gegensatz zum Mittelalter doch etwas schärfer in dem Satze fassen, daß
der ideale Bildraum, zumal von der Frührenaissance, dank der Zentralperspektive,
geradezu als unmittelbare Fortsetzung des realen Raumes jenseits der Bildfläche an-
gesehen wird. Von tiefem Eindringen in ihren Geist zeugen die Ausführungen,
denen der Verfasser nach beendetem Verfolg der Landschaftsmalerei in ihrer Ent-
stehung aus ihren von der Antike und dem Mittelalter ererbten schematischen Vor-
stufen und ihrer naturalistischen Vervielfältigung im toskanischen, umbrischen und
oberitalienischen Kunstkreise das Gemeinsame dieser Sonderrichtungen herausstellt.
Daß die Renaissance die Schönheit auch hier mehr in der Gegenständlichkeit der
Einzeldinge sucht und den Zusammenklang der Handlung mit der landschaftlichen
Stimmung erst im Cinquecento vereinzelt anstrebt, wird durch überzeugende Hin-
weise und eine lehrreiche Auswahl bildlicher Belege erwiesen.
Die gleiche Beherrschung des Stoffes und der neueren Forschung verleiht den
Bemerkungen des Verfassers über Licht und Farbe« im IV. Kapitel hohen Wert,
nicht nur für die rein kunstgeschichtliche, sondern auch für die systematische Frage-
stellung. Landsberger behandelt zunächst die Lichtführung in der italienischen Malerei
seit Giotto und geht allen illusionistischen Bemühungen bei T. Gaddi, Lor. Monaco,
Piero della Francesca usw. bis Raffael nach, um schließlich festzustellen, daß sie
ihre Grenze an der Forderung der Formklarheit finden trotz Leonardos Sfumato. Und
zweifellos hat er darin so weit recht, daß die plastische Anschauungsweise durch
das 15. Jahrhundert hindurch die Oberströmung bleibt und der malerischen noch
bis tief in das 16. die Wage hält. Daraus erklärt sich wenigstens zum Teil auch
das Gefallen an der monochromen Malerei in Verde Terra, deren Herkunft aus an-
tiken Vorbildern Landsberger vermutet, und die technische Bedeutung des Kartons.
Gleichwohl betont er die Farbenfreudigkeit des Quattrocento auch in der Plastik und
Architektur und die erst langsam einsetzende Farbenabkehr des Cinquecento, die in
der Malerei die Vollendung der impressionistischen Pinselzeichnung bei Tizian, Tin-
toretto und ihren Nachfolgern begleitet. Die Entwicklung des Kolorismus betrachtet
der Verfasser unter dem doppelten Gesichtspunkt der Wahrheit und der Schönheit
der Farbe und trifft damit den wesentlichen Gegensatz des illusionistischen und
des eigentlich koloristischen (bzw. dekorativen) Gestaltungstriebes. Bilden für den
ersteren die strenge Berücksichtigung der Eigenfarbe und die fortschreitende Beob-
achtung ihrer Veränderung durch Licht und Schatten zur Wiedergabe der Stofflich-
keit der Dinge, die besonderen malerischen Aufgaben der Früh- und der Hoch-
renaissance, so wandelt sich auf der anderen Seite auch das Harmonieprinzip von
der Farbenfreude an bunter Mannigfaltigkeit zu vereinfachten Farbenakkorden und
schließlich zur Ausbildung eines übergeordneten Einheitstons, zumal bei den Vene-