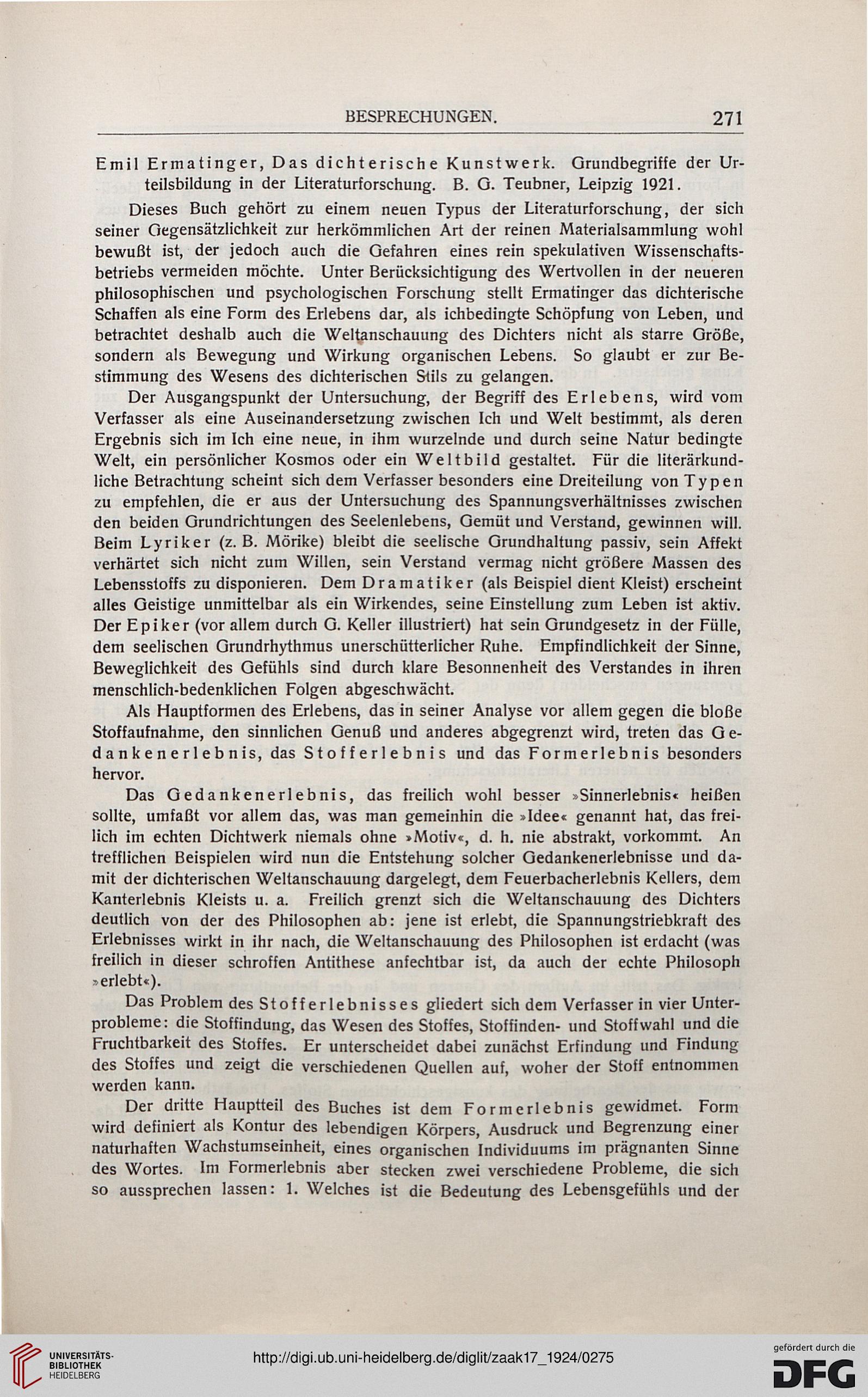BESPRECHUNGEN. 271
Emil Ermatinger, Das dichterische Kunstwerk. Grundbegriffe der Ur-
teilsbildung in der Literaturforschung. B. G. Teubner, Leipzig 1921.
Dieses Buch gehört zu einem neuen Typus der Literaturforschung, der sich
seiner Gegensätzlichkeit zur herkömmlichen Art der reinen Materialsammlung wohl
bewußt ist, der jedoch auch die Gefahren eines rein spekulativen Wissenschafts-
betriebs vermeiden möchte. Unter Berücksichtigung des Wertvollen in der neueren
philosophischen und psychologischen Forschung stellt Ermatinger das dichterische
Schaffen als eine Form des Erlebens dar, als ichbedingte Schöpfung von Leben, und
betrachtet deshalb auch die Weltanschauung des Dichters nicht als starre Größe,
sondern als Bewegung und Wirkung organischen Lebens. So glaubt er zur Be-
stimmung des Wesens des dichterischen Stils zu gelangen.
Der Ausgangspunkt der Untersuchung, der Begriff des Erlebens, wird vom
Verfasser als eine Auseinandersetzung zwischen Ich und Welt bestimmt, als deren
Ergebnis sich im Ich eine neue, in ihm wurzelnde und durch seine Natur bedingte
Welt, ein persönlicher Kosmos oder ein Weltbild gestaltet. Für die literärkund-
liche Betrachtung scheint sich dem Verfasser besonders eine Dreiteilung von Typen
zu empfehlen, die er aus der Untersuchung des Spannungsverhältnisses zwischen
den beiden Grundrichtungen des Seelenlebens, Gemüt und Verstand, gewinnen will.
Beim Lyriker (z.B. Mörike) bleibt die seelische Grundhaltung passiv, sein Affekt
verhärtet sich nicht zum Willen, sein Verstand vermag nicht größere Massen des
Lebensstoffs zu disponieren. Dem Dramatiker (als Beispiel dient Kleist) erscheint
alles Geistige unmittelbar als ein Wirkendes, seine Einstellung zum Leben ist aktiv.
Der Epiker (vor allem durch G. Keller illustriert) hat sein Grundgesetz in der Fülle,
dem seelischen Grundrhythmus unerschütterlicher Ruhe. Empfindlichkeit der Sinne,
Beweglichkeit des Gefühls sind durch klare Besonnenheit des Verstandes in ihren
menschlich-bedenklichen Folgen abgeschwächt.
Als Hauptformen des Erlebens, das in seiner Analyse vor allem gegen die bloße
Stoffaufnahme, den sinnlichen Genuß und anderes abgegrenzt wird, treten das G e-
d an k e n e rl eb nis, das S t o f f erl e bn i s und das Formerlebnis besonders
hervor.
Das Gedankenerlebnis, das freilich wohl besser »Sinnerlebnis« heißen
sollte, umfaßt vor allem das, was man gemeinhin die »Idee« genannt hat, das frei-
lich im echten Dichtwerk niemals ohne »Motiv«, d. h. nie abstrakt, vorkommt. An
trefflichen Beispielen wird nun die Entstehung solcher Gedankenerlebnisse und da-
mit der dichterischen Weltanschauung dargelegt, dem Feuerbacherlebnis Kellers, dem
Kanterlebnis Kleists u. a. Freilich grenzt sich die Weltanschauung des Dichters
deutlich von der des Philosophen ab: jene ist erlebt, die Spannungstriebkraft des
Erlebnisses wirkt in ihr nach, die Weltanschauung des Philosophen ist erdacht (was
freilich in dieser schroffen Antithese anfechtbar ist, da auch der echte Philosoph
»erlebt«).
Das Problem des Stoff erlebnisses gliedert sich dem Verfasser in vier Unter-
probleme: die Stoffindung, das Wesen des Stoffes, Stoffinden- und Stoff wähl und die
Fruchtbarkeit des Stoffes. Er unterscheidet dabei zunächst Erfindung und Findung
des Stoffes und zeigt die verschiedenen Quellen auf, woher der Stoff entnommen
werden kann.
Der dritte Hauptteil des Buches ist dem Formerlebnis gewidmet. Form
wird definiert als Kontur des lebendigen Körpers, Ausdruck und Begrenzung einer
naturhaften Wachstumseinheit, eines organischen Individuums im prägnanten Sinne
des Wortes. Im Formerlebnis aber stecken zwei verschiedene Probleme, die sich
so aussprechen lassen: 1. Welches ist die Bedeutung des Lebensgefühls und der
Emil Ermatinger, Das dichterische Kunstwerk. Grundbegriffe der Ur-
teilsbildung in der Literaturforschung. B. G. Teubner, Leipzig 1921.
Dieses Buch gehört zu einem neuen Typus der Literaturforschung, der sich
seiner Gegensätzlichkeit zur herkömmlichen Art der reinen Materialsammlung wohl
bewußt ist, der jedoch auch die Gefahren eines rein spekulativen Wissenschafts-
betriebs vermeiden möchte. Unter Berücksichtigung des Wertvollen in der neueren
philosophischen und psychologischen Forschung stellt Ermatinger das dichterische
Schaffen als eine Form des Erlebens dar, als ichbedingte Schöpfung von Leben, und
betrachtet deshalb auch die Weltanschauung des Dichters nicht als starre Größe,
sondern als Bewegung und Wirkung organischen Lebens. So glaubt er zur Be-
stimmung des Wesens des dichterischen Stils zu gelangen.
Der Ausgangspunkt der Untersuchung, der Begriff des Erlebens, wird vom
Verfasser als eine Auseinandersetzung zwischen Ich und Welt bestimmt, als deren
Ergebnis sich im Ich eine neue, in ihm wurzelnde und durch seine Natur bedingte
Welt, ein persönlicher Kosmos oder ein Weltbild gestaltet. Für die literärkund-
liche Betrachtung scheint sich dem Verfasser besonders eine Dreiteilung von Typen
zu empfehlen, die er aus der Untersuchung des Spannungsverhältnisses zwischen
den beiden Grundrichtungen des Seelenlebens, Gemüt und Verstand, gewinnen will.
Beim Lyriker (z.B. Mörike) bleibt die seelische Grundhaltung passiv, sein Affekt
verhärtet sich nicht zum Willen, sein Verstand vermag nicht größere Massen des
Lebensstoffs zu disponieren. Dem Dramatiker (als Beispiel dient Kleist) erscheint
alles Geistige unmittelbar als ein Wirkendes, seine Einstellung zum Leben ist aktiv.
Der Epiker (vor allem durch G. Keller illustriert) hat sein Grundgesetz in der Fülle,
dem seelischen Grundrhythmus unerschütterlicher Ruhe. Empfindlichkeit der Sinne,
Beweglichkeit des Gefühls sind durch klare Besonnenheit des Verstandes in ihren
menschlich-bedenklichen Folgen abgeschwächt.
Als Hauptformen des Erlebens, das in seiner Analyse vor allem gegen die bloße
Stoffaufnahme, den sinnlichen Genuß und anderes abgegrenzt wird, treten das G e-
d an k e n e rl eb nis, das S t o f f erl e bn i s und das Formerlebnis besonders
hervor.
Das Gedankenerlebnis, das freilich wohl besser »Sinnerlebnis« heißen
sollte, umfaßt vor allem das, was man gemeinhin die »Idee« genannt hat, das frei-
lich im echten Dichtwerk niemals ohne »Motiv«, d. h. nie abstrakt, vorkommt. An
trefflichen Beispielen wird nun die Entstehung solcher Gedankenerlebnisse und da-
mit der dichterischen Weltanschauung dargelegt, dem Feuerbacherlebnis Kellers, dem
Kanterlebnis Kleists u. a. Freilich grenzt sich die Weltanschauung des Dichters
deutlich von der des Philosophen ab: jene ist erlebt, die Spannungstriebkraft des
Erlebnisses wirkt in ihr nach, die Weltanschauung des Philosophen ist erdacht (was
freilich in dieser schroffen Antithese anfechtbar ist, da auch der echte Philosoph
»erlebt«).
Das Problem des Stoff erlebnisses gliedert sich dem Verfasser in vier Unter-
probleme: die Stoffindung, das Wesen des Stoffes, Stoffinden- und Stoff wähl und die
Fruchtbarkeit des Stoffes. Er unterscheidet dabei zunächst Erfindung und Findung
des Stoffes und zeigt die verschiedenen Quellen auf, woher der Stoff entnommen
werden kann.
Der dritte Hauptteil des Buches ist dem Formerlebnis gewidmet. Form
wird definiert als Kontur des lebendigen Körpers, Ausdruck und Begrenzung einer
naturhaften Wachstumseinheit, eines organischen Individuums im prägnanten Sinne
des Wortes. Im Formerlebnis aber stecken zwei verschiedene Probleme, die sich
so aussprechen lassen: 1. Welches ist die Bedeutung des Lebensgefühls und der