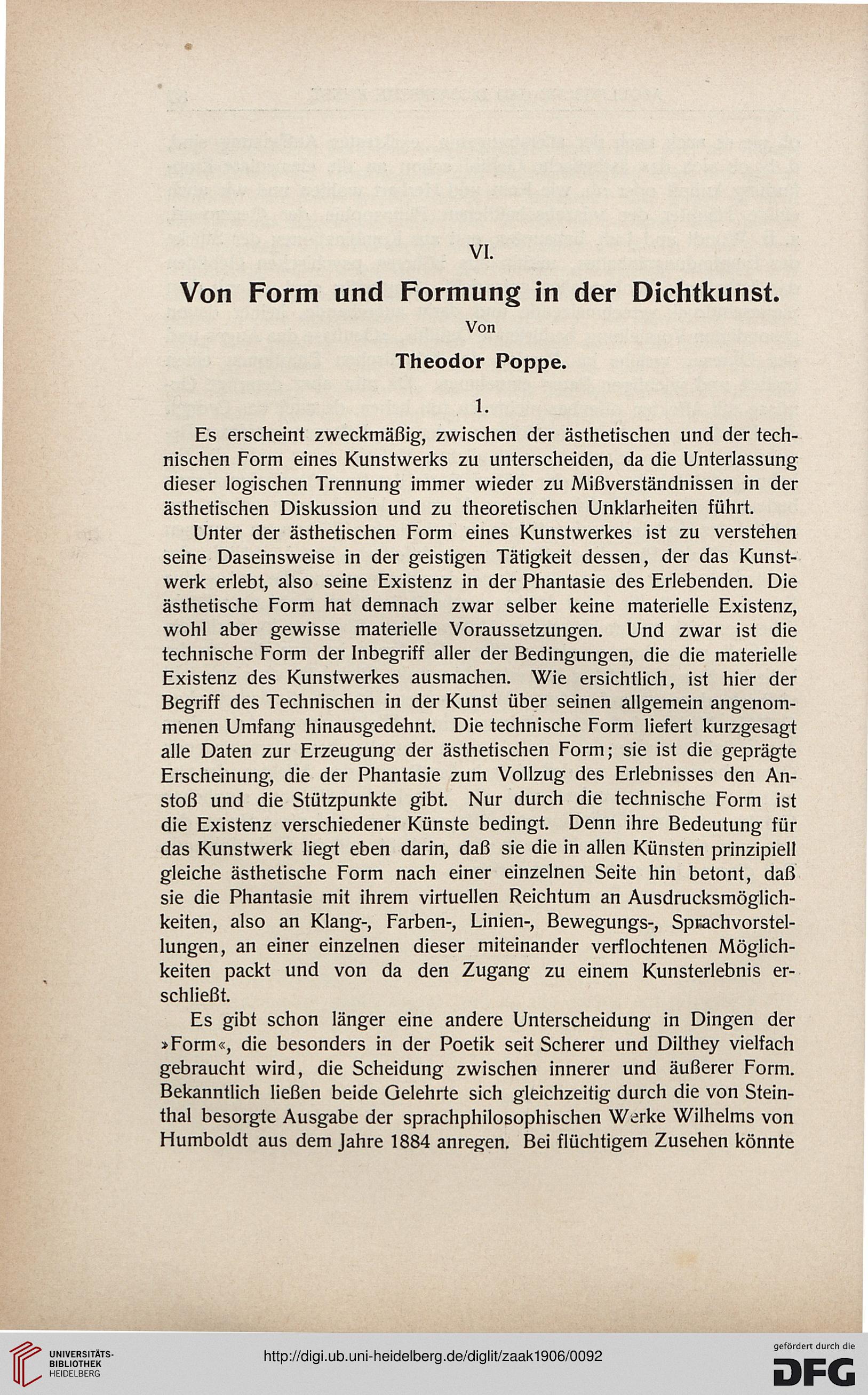VI.
Von Form und Formung in der Dichtkunst.
Von
Theodor Poppe.
1.
Es erscheint zweckmäßig, zwischen der ästhetischen und der tech-
nischen Form eines Kunstwerks zu unterscheiden, da die Unterlassung
dieser logischen Trennung immer wieder zu Mißverständnissen in der
ästhetischen Diskussion und zu theoretischen Unklarheiten führt.
Unter der ästhetischen Form eines Kunstwerkes ist zu verstehen
seine Daseinsweise in der geistigen Tätigkeit dessen, der das Kunst-
werk erlebt, also seine Existenz in der Phantasie des Erlebenden. Die
ästhetische Form hat demnach zwar selber keine materielle Existenz,
wohl aber gewisse materielle Voraussetzungen. Und zwar ist die
technische Form der Inbegriff aller der Bedingungen, die die materielle
Existenz des Kunstwerkes ausmachen. Wie ersichtlich, ist hier der
Begriff des Technischen in der Kunst über seinen allgemein angenom-
menen Umfang hinausgedehnt. Die technische Form liefert kurzgesagt
alle Daten zur Erzeugung der ästhetischen Form; sie ist die geprägte
Erscheinung, die der Phantasie zum Vollzug des Erlebnisses den An-
stoß und die Stützpunkte gibt. Nur durch die technische Form ist
die Existenz verschiedener Künste bedingt. Denn ihre Bedeutung für
das Kunstwerk liegt eben darin, daß sie die in allen Künsten prinzipiell
gleiche ästhetische Form nach einer einzelnen Seite hin betont, daß
sie die Phantasie mit ihrem virtuellen Reichtum an Ausdrucksmöglich-
keiten, also an Klang-, Farben-, Linien-, Bewegungs-, Spiachvorstel-
lungen, an einer einzelnen dieser miteinander verflochtenen Möglich-
keiten packt und von da den Zugang zu einem Kunsterlebnis er-
schließt.
Es gibt schon länger eine andere Unterscheidung in Dingen der
>Form«, die besonders in der Poetik seit Scherer und Dilthey vielfach
gebraucht wird, die Scheidung zwischen innerer und äußerer Form.
Bekanntlich ließen beide Gelehrte sich gleichzeitig durch die von Stein-
thal besorgte Ausgabe der sprachphilosophischen Werke Wilhelms von
Humboldt aus dem Jahre 1884 anregen. Bei flüchtigem Zusehen könnte
Von Form und Formung in der Dichtkunst.
Von
Theodor Poppe.
1.
Es erscheint zweckmäßig, zwischen der ästhetischen und der tech-
nischen Form eines Kunstwerks zu unterscheiden, da die Unterlassung
dieser logischen Trennung immer wieder zu Mißverständnissen in der
ästhetischen Diskussion und zu theoretischen Unklarheiten führt.
Unter der ästhetischen Form eines Kunstwerkes ist zu verstehen
seine Daseinsweise in der geistigen Tätigkeit dessen, der das Kunst-
werk erlebt, also seine Existenz in der Phantasie des Erlebenden. Die
ästhetische Form hat demnach zwar selber keine materielle Existenz,
wohl aber gewisse materielle Voraussetzungen. Und zwar ist die
technische Form der Inbegriff aller der Bedingungen, die die materielle
Existenz des Kunstwerkes ausmachen. Wie ersichtlich, ist hier der
Begriff des Technischen in der Kunst über seinen allgemein angenom-
menen Umfang hinausgedehnt. Die technische Form liefert kurzgesagt
alle Daten zur Erzeugung der ästhetischen Form; sie ist die geprägte
Erscheinung, die der Phantasie zum Vollzug des Erlebnisses den An-
stoß und die Stützpunkte gibt. Nur durch die technische Form ist
die Existenz verschiedener Künste bedingt. Denn ihre Bedeutung für
das Kunstwerk liegt eben darin, daß sie die in allen Künsten prinzipiell
gleiche ästhetische Form nach einer einzelnen Seite hin betont, daß
sie die Phantasie mit ihrem virtuellen Reichtum an Ausdrucksmöglich-
keiten, also an Klang-, Farben-, Linien-, Bewegungs-, Spiachvorstel-
lungen, an einer einzelnen dieser miteinander verflochtenen Möglich-
keiten packt und von da den Zugang zu einem Kunsterlebnis er-
schließt.
Es gibt schon länger eine andere Unterscheidung in Dingen der
>Form«, die besonders in der Poetik seit Scherer und Dilthey vielfach
gebraucht wird, die Scheidung zwischen innerer und äußerer Form.
Bekanntlich ließen beide Gelehrte sich gleichzeitig durch die von Stein-
thal besorgte Ausgabe der sprachphilosophischen Werke Wilhelms von
Humboldt aus dem Jahre 1884 anregen. Bei flüchtigem Zusehen könnte