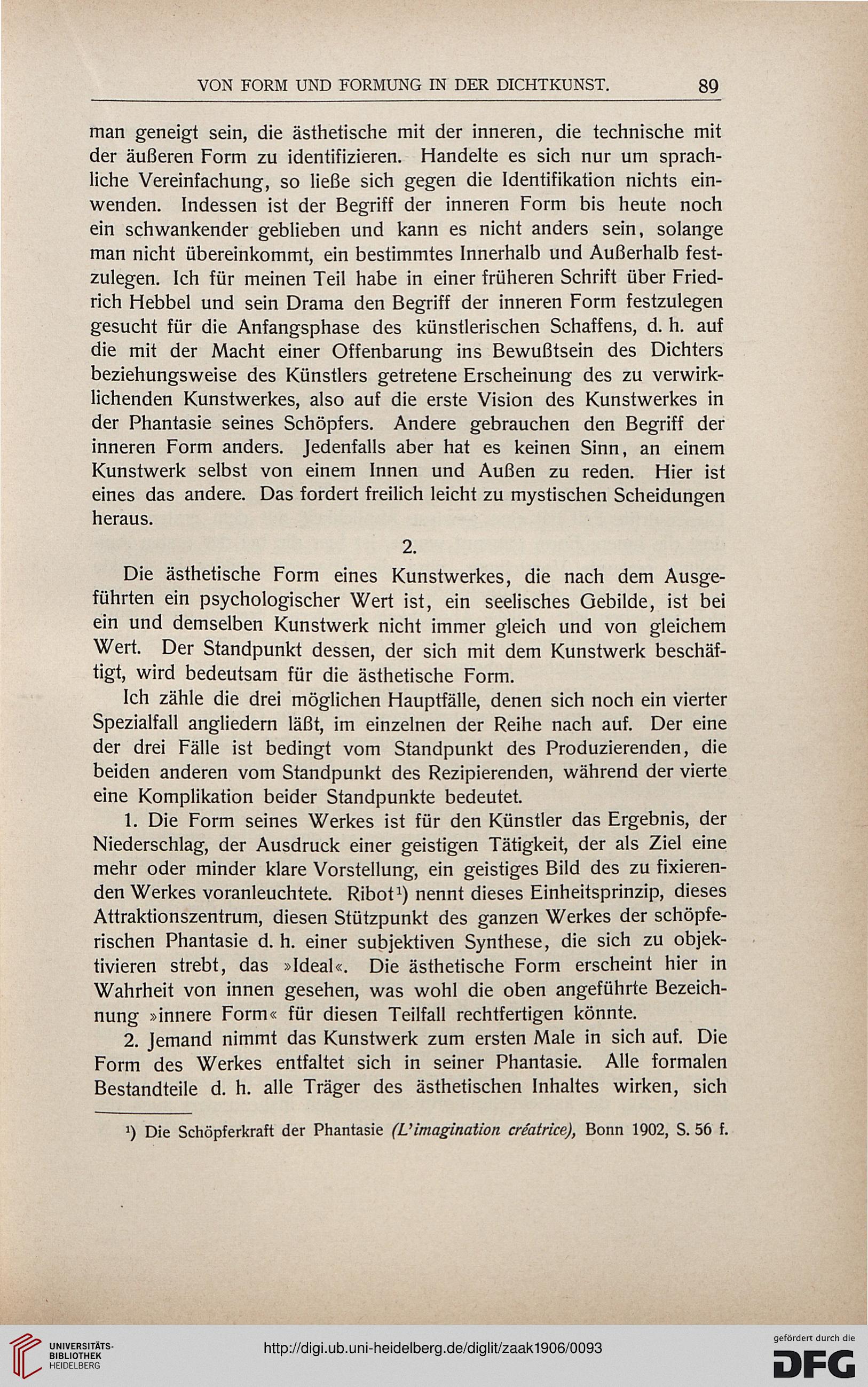VON FORM UND FORMUNG IN DER DICHTKUNST. 89
man geneigt sein, die ästhetische mit der inneren, die technische mit
der äußeren Form zu identifizieren. Handelte es sich nur um sprach-
liche Vereinfachung, so ließe sich gegen die Identifikation nichts ein-
wenden. Indessen ist der Begriff der inneren Form bis heute noch
ein schwankender geblieben und kann es nicht anders sein, solange
man nicht übereinkommt, ein bestimmtes Innerhalb und Außerhalb fest-
zulegen. Ich für meinen Teil habe in einer früheren Schrift über Fried-
rich Hebbel und sein Drama den Begriff der inneren Form festzulegen
gesucht für die Anfangsphase des künstlerischen Schaffens, d. h. auf
die mit der Macht einer Offenbarung ins Bewußtsein des Dichters
beziehungsweise des Künstlers getretene Erscheinung des zu verwirk-
lichenden Kunstwerkes, also auf die erste Vision des Kunstwerkes in
der Phantasie seines Schöpfers. Andere gebrauchen den Begriff der
inneren Form anders. Jedenfalls aber hat es keinen Sinn, an einem
Kunstwerk selbst von einem Innen und Außen zu reden. Hier ist
eines das andere. Das fordert freilich leicht zu mystischen Scheidungen
heraus.
2.
Die ästhetische Form eines Kunstwerkes, die nach dem Ausge-
führten ein psychologischer Wert ist, ein seelisches Gebilde, ist bei
ein und demselben Kunstwerk nicht immer gleich und von gleichem
Wert. Der Standpunkt dessen, der sich mit dem Kunstwerk beschäf-
tigt, wird bedeutsam für die ästhetische Form.
Ich zähle die drei möglichen Hauptfälle, denen sich noch ein vierter
Spezialfall angliedern läßt, im einzelnen der Reihe nach auf. Der eine
der drei Fälle ist bedingt vom Standpunkt des Produzierenden, die
beiden anderen vom Standpunkt des Rezipierenden, während der vierte
eine Komplikation beider Standpunkte bedeutet.
1. Die Form seines Werkes ist für den Künstler das Ergebnis, der
Niederschlag, der Ausdruck einer geistigen Tätigkeit, der als Ziel eine
mehr oder minder klare Vorstellung, ein geistiges Bild des zu fixieren-
den Werkes voranleuchtete. Ribot1) nennt dieses Einheitsprinzip, dieses
Attraktionszentrum, diesen Stützpunkt des ganzen Werkes der schöpfe-
rischen Phantasie d. h. einer subjektiven Synthese, die sich zu objek-
tivieren strebt, das »Ideal«. Die ästhetische Form erscheint hier in
Wahrheit von innen gesehen, was wohl die oben angeführte Bezeich-
nung »innere Form« für diesen Teilfall rechtfertigen könnte.
2. Jemand nimmt das Kunstwerk zum ersten Male in sich auf. Die
Form des Werkes entfaltet sich in seiner Phantasie. Alle formalen
Bestandteile d. h. alle Träger des ästhetischen Inhaltes wirken, sich
J) Die Schöpferkraft der Phantasie (VImagination creatrice), Bonn 1902, S. 56 f.
man geneigt sein, die ästhetische mit der inneren, die technische mit
der äußeren Form zu identifizieren. Handelte es sich nur um sprach-
liche Vereinfachung, so ließe sich gegen die Identifikation nichts ein-
wenden. Indessen ist der Begriff der inneren Form bis heute noch
ein schwankender geblieben und kann es nicht anders sein, solange
man nicht übereinkommt, ein bestimmtes Innerhalb und Außerhalb fest-
zulegen. Ich für meinen Teil habe in einer früheren Schrift über Fried-
rich Hebbel und sein Drama den Begriff der inneren Form festzulegen
gesucht für die Anfangsphase des künstlerischen Schaffens, d. h. auf
die mit der Macht einer Offenbarung ins Bewußtsein des Dichters
beziehungsweise des Künstlers getretene Erscheinung des zu verwirk-
lichenden Kunstwerkes, also auf die erste Vision des Kunstwerkes in
der Phantasie seines Schöpfers. Andere gebrauchen den Begriff der
inneren Form anders. Jedenfalls aber hat es keinen Sinn, an einem
Kunstwerk selbst von einem Innen und Außen zu reden. Hier ist
eines das andere. Das fordert freilich leicht zu mystischen Scheidungen
heraus.
2.
Die ästhetische Form eines Kunstwerkes, die nach dem Ausge-
führten ein psychologischer Wert ist, ein seelisches Gebilde, ist bei
ein und demselben Kunstwerk nicht immer gleich und von gleichem
Wert. Der Standpunkt dessen, der sich mit dem Kunstwerk beschäf-
tigt, wird bedeutsam für die ästhetische Form.
Ich zähle die drei möglichen Hauptfälle, denen sich noch ein vierter
Spezialfall angliedern läßt, im einzelnen der Reihe nach auf. Der eine
der drei Fälle ist bedingt vom Standpunkt des Produzierenden, die
beiden anderen vom Standpunkt des Rezipierenden, während der vierte
eine Komplikation beider Standpunkte bedeutet.
1. Die Form seines Werkes ist für den Künstler das Ergebnis, der
Niederschlag, der Ausdruck einer geistigen Tätigkeit, der als Ziel eine
mehr oder minder klare Vorstellung, ein geistiges Bild des zu fixieren-
den Werkes voranleuchtete. Ribot1) nennt dieses Einheitsprinzip, dieses
Attraktionszentrum, diesen Stützpunkt des ganzen Werkes der schöpfe-
rischen Phantasie d. h. einer subjektiven Synthese, die sich zu objek-
tivieren strebt, das »Ideal«. Die ästhetische Form erscheint hier in
Wahrheit von innen gesehen, was wohl die oben angeführte Bezeich-
nung »innere Form« für diesen Teilfall rechtfertigen könnte.
2. Jemand nimmt das Kunstwerk zum ersten Male in sich auf. Die
Form des Werkes entfaltet sich in seiner Phantasie. Alle formalen
Bestandteile d. h. alle Träger des ästhetischen Inhaltes wirken, sich
J) Die Schöpferkraft der Phantasie (VImagination creatrice), Bonn 1902, S. 56 f.