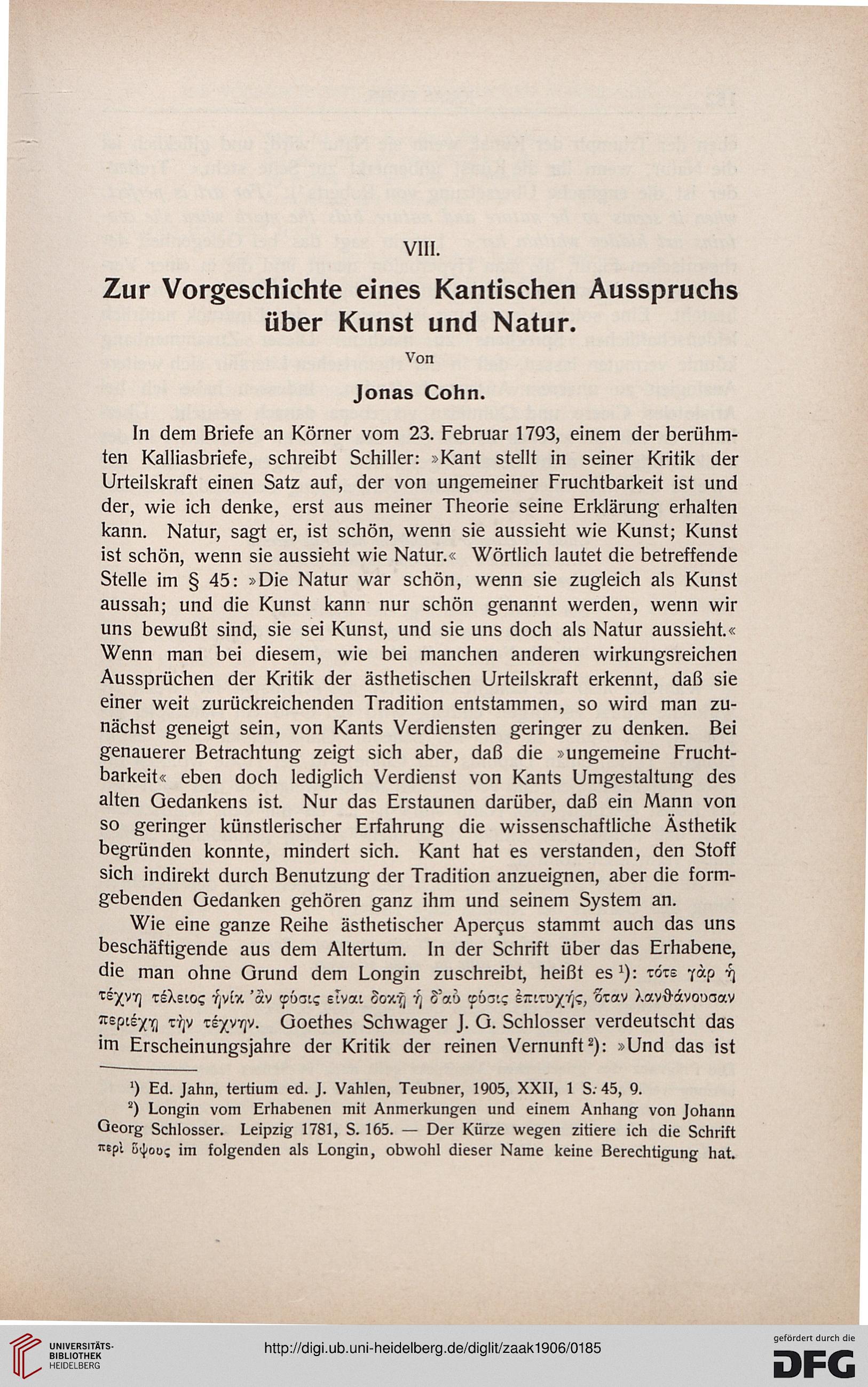VIII.
Zur Vorgeschichte eines Kantischen Ausspruchs
über Kunst und Natur.
Von
Jonas Cohn.
In dem Briefe an Körner vom 23. Februar 1793, einem der berühm-
ten Kalliasbriefe, schreibt Schiller: »Kant stellt in seiner Kritik der
Urteilskraft einen Satz auf, der von ungemeiner Fruchtbarkeit ist und
der, wie ich denke, erst aus meiner Theorie seine Erklärung erhalten
kann. Natur, sagt er, ist schön, wenn sie aussieht wie Kunst; Kunst
ist schön, wenn sie aussieht wie Natur.« Wörtlich lautet die betreffende
Stelle im § 45: »Die Natur war schön, wenn sie zugleich als Kunst
aussah; und die Kunst kann nur schön genannt werden, wenn wir
uns bewußt sind, sie sei Kunst, und sie uns doch als Natur aussieht.«
Wenn man bei diesem, wie bei manchen anderen wirkungsreichen
Aussprüchen der Kritik der ästhetischen Urteilskraft erkennt, daß sie
einer weit zurückreichenden Tradition entstammen, so wird man zu-
nächst geneigt sein, von Kants Verdiensten geringer zu denken. Bei
genauerer Betrachtung zeigt sich aber, daß die »ungemeine Frucht-
barkeit« eben doch lediglich Verdienst von Kants Umgestaltung des
alten Gedankens ist. Nur das Erstaunen darüber, daß ein Mann von
so geringer künstlerischer Erfahrung die wissenschaftliche Ästhetik
begründen konnte, mindert sich. Kant hat es verstanden, den Stoff
sich indirekt durch Benutzung der Tradition anzueignen, aber die form-
gebenden Gedanken gehören ganz ihm und seinem System an.
Wie eine ganze Reihe ästhetischer Apercus stammt auch das uns
beschäftigende aus dem Altertum. In der Schrift über das Erhabene,
die man ohne Grund dem Longin zuschreibt, heißt es1): töte y&P rj
T^XVY1 TeXeio? rjvix 'av <pöat? eivat öox^ -q S'ao füan; i-iTupj?, frcav Xav&ävooaav
jreptE)(-fl iTjv TiyvTjv. Goethes Schwager J. G. Schlosser verdeutscht das
im Erscheinungsjahre der Kritik der reinen Vernunft2): »Und das ist
1) Ed. Jahn, tertium ed. J. Vahlen, Teubner, 1905, XXII, 1 S. 45, 9.
2) Longin vom Erhabenen mit Anmerkungen und einem Anhang von Johann
Georg Schlosser. Leipzig 1781, S. 165. — Der Kürze wegen zitiere ich die Schrift
««pl BiJiod; im folgenden als Longin, obwohl dieser Name keine Berechtigung hat.
Zur Vorgeschichte eines Kantischen Ausspruchs
über Kunst und Natur.
Von
Jonas Cohn.
In dem Briefe an Körner vom 23. Februar 1793, einem der berühm-
ten Kalliasbriefe, schreibt Schiller: »Kant stellt in seiner Kritik der
Urteilskraft einen Satz auf, der von ungemeiner Fruchtbarkeit ist und
der, wie ich denke, erst aus meiner Theorie seine Erklärung erhalten
kann. Natur, sagt er, ist schön, wenn sie aussieht wie Kunst; Kunst
ist schön, wenn sie aussieht wie Natur.« Wörtlich lautet die betreffende
Stelle im § 45: »Die Natur war schön, wenn sie zugleich als Kunst
aussah; und die Kunst kann nur schön genannt werden, wenn wir
uns bewußt sind, sie sei Kunst, und sie uns doch als Natur aussieht.«
Wenn man bei diesem, wie bei manchen anderen wirkungsreichen
Aussprüchen der Kritik der ästhetischen Urteilskraft erkennt, daß sie
einer weit zurückreichenden Tradition entstammen, so wird man zu-
nächst geneigt sein, von Kants Verdiensten geringer zu denken. Bei
genauerer Betrachtung zeigt sich aber, daß die »ungemeine Frucht-
barkeit« eben doch lediglich Verdienst von Kants Umgestaltung des
alten Gedankens ist. Nur das Erstaunen darüber, daß ein Mann von
so geringer künstlerischer Erfahrung die wissenschaftliche Ästhetik
begründen konnte, mindert sich. Kant hat es verstanden, den Stoff
sich indirekt durch Benutzung der Tradition anzueignen, aber die form-
gebenden Gedanken gehören ganz ihm und seinem System an.
Wie eine ganze Reihe ästhetischer Apercus stammt auch das uns
beschäftigende aus dem Altertum. In der Schrift über das Erhabene,
die man ohne Grund dem Longin zuschreibt, heißt es1): töte y&P rj
T^XVY1 TeXeio? rjvix 'av <pöat? eivat öox^ -q S'ao füan; i-iTupj?, frcav Xav&ävooaav
jreptE)(-fl iTjv TiyvTjv. Goethes Schwager J. G. Schlosser verdeutscht das
im Erscheinungsjahre der Kritik der reinen Vernunft2): »Und das ist
1) Ed. Jahn, tertium ed. J. Vahlen, Teubner, 1905, XXII, 1 S. 45, 9.
2) Longin vom Erhabenen mit Anmerkungen und einem Anhang von Johann
Georg Schlosser. Leipzig 1781, S. 165. — Der Kürze wegen zitiere ich die Schrift
««pl BiJiod; im folgenden als Longin, obwohl dieser Name keine Berechtigung hat.