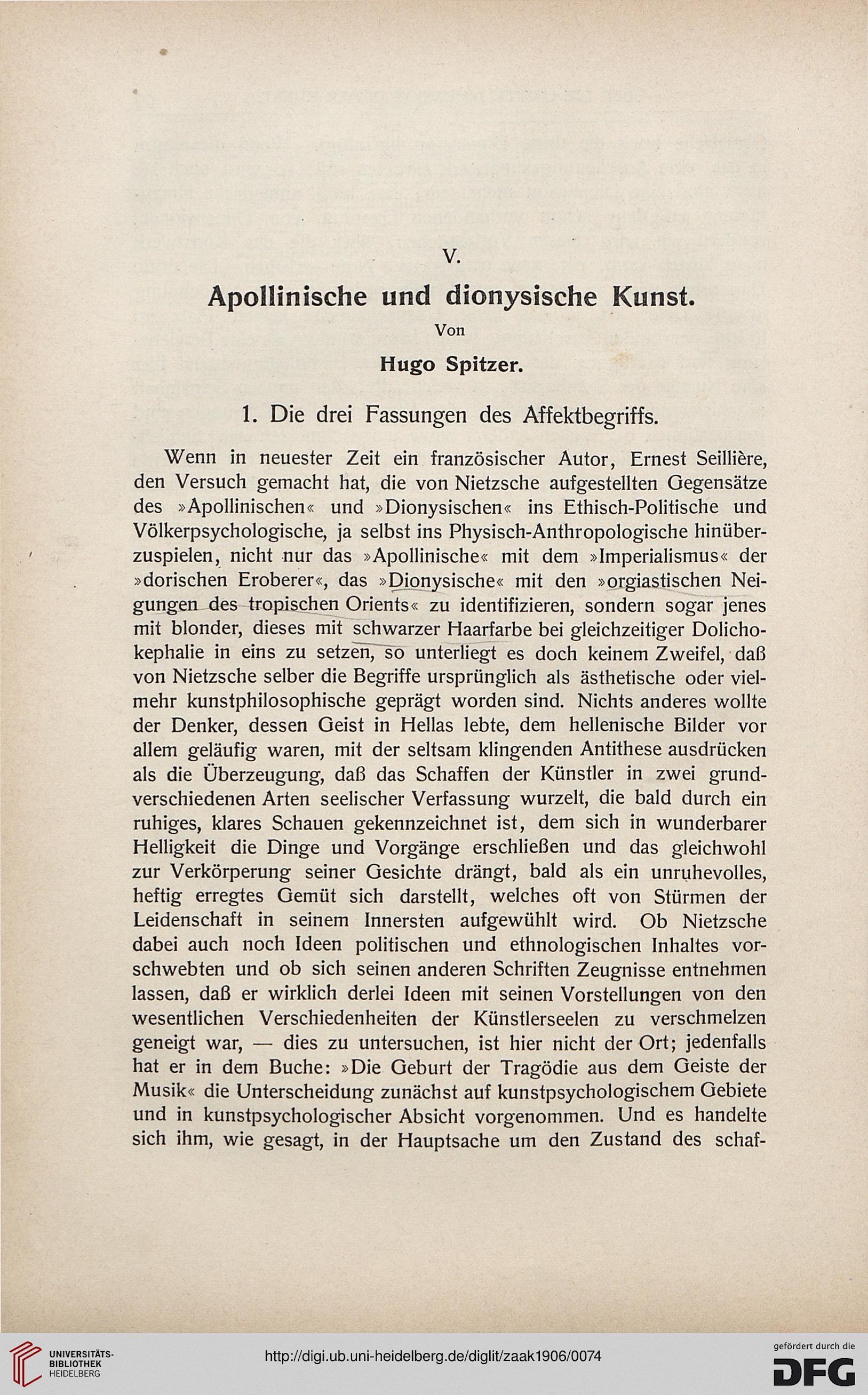V.
Apollinische und dionysische Kunst.
Von
Hugo Spitzer.
1. Die drei Fassungen des Affektbegriffs.
Wenn in neuester Zeit ein französischer Autor, Ernest Seiliiere,
den Versuch gemacht hat, die von Nietzsche aufgestellten Gegensätze
des »Apollinischen« und »Dionysischen« ins Ethisch-Politische und
Völkerpsychologische, ja selbst ins Physisch-Anthropologische hinüber-
zuspielen, nicht nur das »Apollinische« mit dem »Imperialismus« der
»dorischen Eroberer«, das »Dionysische« mit den »orgiastisehen Nei-
gungen des tropischen Orients« zu identifizieren, sondern sogar jenes
mit blonder, dieses mit schwarzer Haarfarbe bei gleichzeitiger Dolicho-
kephalie in eins zu setzen,~sö unterliegt es doch keinem Zweifel, daß
von Nietzsche selber die Begriffe ursprünglich als ästhetische oder viel-
mehr kunstphilosophische geprägt worden sind. Nichts anderes wollte
der Denker, dessen Geist in Hellas lebte, dem hellenische Bilder vor
allem geläufig waren, mit der seltsam klingenden Antithese ausdrücken
als die Überzeugung, daß das Schaffen der Künstler in zwei grund-
verschiedenen Arten seelischer Verfassung wurzelt, die bald durch ein
ruhiges, klares Schauen gekennzeichnet ist, dem sich in wunderbarer
Helligkeit die Dinge und Vorgänge erschließen und das gleichwohl
zur Verkörperung seiner Gesichte drängt, bald als ein unruhevolles,
heftig erregtes Gemüt sich darstellt, welches oft von Stürmen der
Leidenschaft in seinem Innersten aufgewühlt wird. Ob Nietzsche
dabei auch noch Ideen politischen und ethnologischen Inhaltes vor-
schwebten und ob sich seinen anderen Schriften Zeugnisse entnehmen
lassen, daß er wirklich derlei Ideen mit seinen Vorstellungen von den
wesentlichen Verschiedenheiten der Künstlerseelen zu verschmelzen
geneigt war, — dies zu untersuchen, ist hier nicht der Ort; jedenfalls
hat er in dem Buche: »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der
Musik« die Unterscheidung zunächst auf kunstpsychologischem Gebiete
und in kunstpsychologischer Absicht vorgenommen. Und es handelte
sich ihm, wie gesagt, in der Hauptsache um den Zustand des schaf-
Apollinische und dionysische Kunst.
Von
Hugo Spitzer.
1. Die drei Fassungen des Affektbegriffs.
Wenn in neuester Zeit ein französischer Autor, Ernest Seiliiere,
den Versuch gemacht hat, die von Nietzsche aufgestellten Gegensätze
des »Apollinischen« und »Dionysischen« ins Ethisch-Politische und
Völkerpsychologische, ja selbst ins Physisch-Anthropologische hinüber-
zuspielen, nicht nur das »Apollinische« mit dem »Imperialismus« der
»dorischen Eroberer«, das »Dionysische« mit den »orgiastisehen Nei-
gungen des tropischen Orients« zu identifizieren, sondern sogar jenes
mit blonder, dieses mit schwarzer Haarfarbe bei gleichzeitiger Dolicho-
kephalie in eins zu setzen,~sö unterliegt es doch keinem Zweifel, daß
von Nietzsche selber die Begriffe ursprünglich als ästhetische oder viel-
mehr kunstphilosophische geprägt worden sind. Nichts anderes wollte
der Denker, dessen Geist in Hellas lebte, dem hellenische Bilder vor
allem geläufig waren, mit der seltsam klingenden Antithese ausdrücken
als die Überzeugung, daß das Schaffen der Künstler in zwei grund-
verschiedenen Arten seelischer Verfassung wurzelt, die bald durch ein
ruhiges, klares Schauen gekennzeichnet ist, dem sich in wunderbarer
Helligkeit die Dinge und Vorgänge erschließen und das gleichwohl
zur Verkörperung seiner Gesichte drängt, bald als ein unruhevolles,
heftig erregtes Gemüt sich darstellt, welches oft von Stürmen der
Leidenschaft in seinem Innersten aufgewühlt wird. Ob Nietzsche
dabei auch noch Ideen politischen und ethnologischen Inhaltes vor-
schwebten und ob sich seinen anderen Schriften Zeugnisse entnehmen
lassen, daß er wirklich derlei Ideen mit seinen Vorstellungen von den
wesentlichen Verschiedenheiten der Künstlerseelen zu verschmelzen
geneigt war, — dies zu untersuchen, ist hier nicht der Ort; jedenfalls
hat er in dem Buche: »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der
Musik« die Unterscheidung zunächst auf kunstpsychologischem Gebiete
und in kunstpsychologischer Absicht vorgenommen. Und es handelte
sich ihm, wie gesagt, in der Hauptsache um den Zustand des schaf-