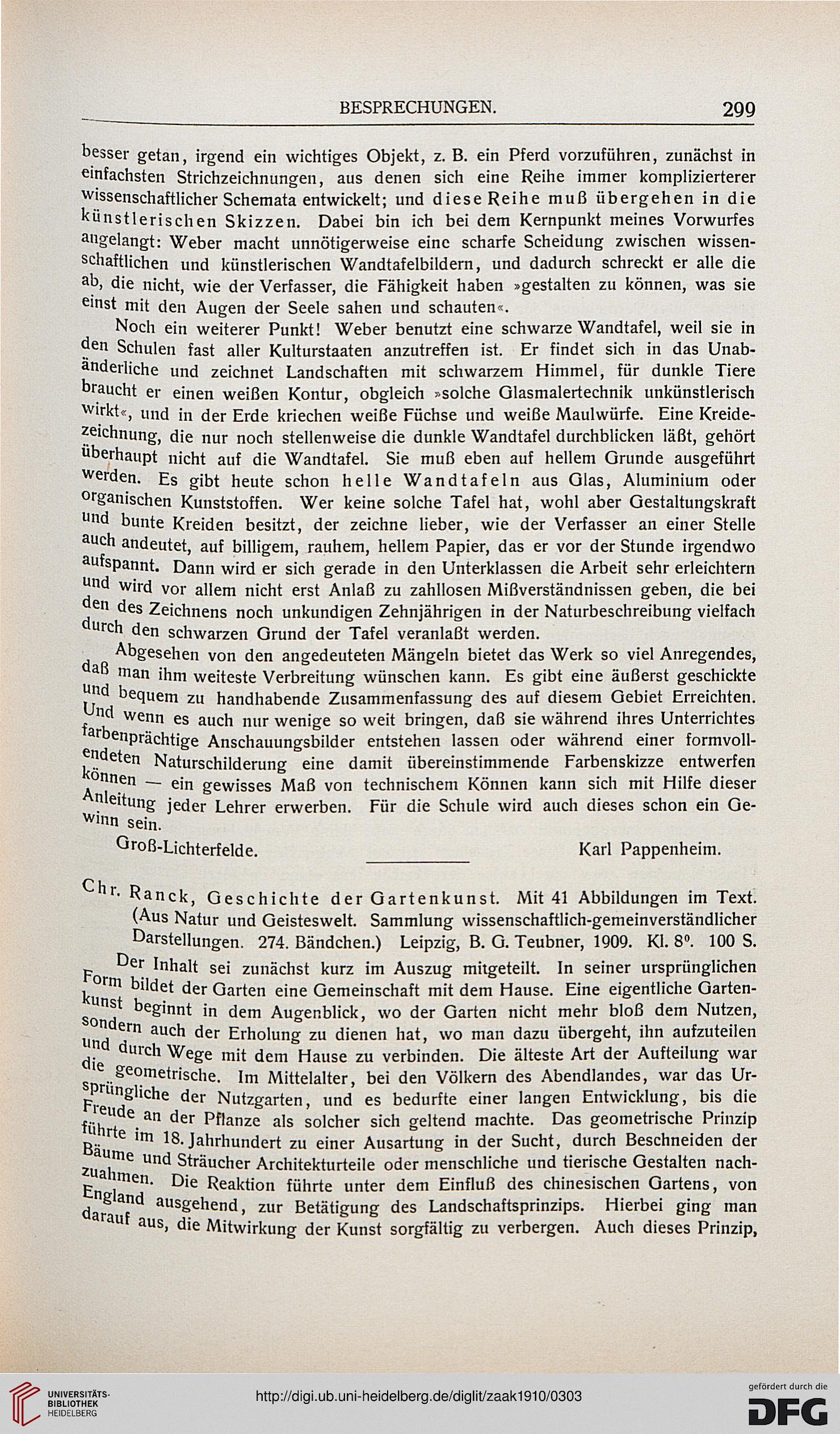BESPRECHUNGEN. 299
besser getan, irgend ein wichtiges Objekt, z. B. ein Pferd vorzuführen, zunächst in
einfachsten Strichzeichnungen, aus denen sich eine Reihe immer komplizierterer
wissenschaftlicher Schemata entwickelt; und diese Reihe muß übergehen in die
künstlerischen Skizzen. Dabei bin ich bei dem Kernpunkt meines Vorwurfes
angelangt: Weber macht unnötigerweise eine scharfe Scheidung zwischen wissen-
schaftlichen und künstlerischen Wandtafelbildern, und dadurch schreckt er alle die
ap, die nicht, wie der Verfasser, die Fähigkeit haben »gestalten zu können, was sie
einst mit den Augen der Seele sahen und schauten«.
Noch ein weiterer Punkt! Weber benutzt eine schwarze Wandtafel, weil sie in
uen Schulen fast aller Kulturstaaten anzutreffen ist. Er findet sich in das Unab-
änderliche und zeichnet Landschaften mit schwarzem Himmel, für dunkle Tiere
braucht er einen weißen Kontur, obgleich »solche Glasmalertechnik unkünstlerisch
wirkt«, und in der Erde kriechen weiße Füchse und weiße Maulwürfe. Eine Kreide-
zeichnung, die nur noch stellenweise die dunkle Wandtafel durchblicken läßt, gehört
überhaupt nicht auf die Wandtafel. Sie muß eben auf hellem Grunde ausgeführt
erden. Es gibt heute schon helle Wandtafeln aus Glas, Aluminium oder
organischen Kunststoffen. Wer keine solche Tafel hat, wohl aber Gestaltungskraft
«u bunte Kreiden besitzt, der zeichne lieber, wie der Verfasser an einer Stelle
n andeutet, auf billigem, rauhem, hellem Papier, das er vor der Stunde irgendwo
■spannt. Dann wird er sich gerade in den Unterklassen die Arbeit sehr erleichtern
W wird vor allem nicht erst Anlaß zu zahllosen Mißverständnissen geben, die bei
n des Zeichnens noch unkundigen Zehnjährigen in der Naturbeschreibung vielfach
lrcn den schwarzen Grund der Tafel veranlaßt werden.
Abgesehen von den angedeuteten Mängeln bietet das Werk so viel Anregendes,
man ihm weiteste Verbreitung wünschen kann. Es gibt eine äußerst geschickte
1 bequem zu handhabende Zusammenfassung des auf diesem Gebiet Erreichten.
lcl wenn es auch nur wenige so weit bringen, daß sie während ihres Unterrichtes
"Prächtige Anschauungsbilder entstehen lassen oder während einer formvoll-
, .. ten Naturschilderung eine damit übereinstimmende Farbenskizze entwerfen
nen — ejn gewisses Maß von technischem Können kann sich mit Hilfe dieser
eitung jeder Lehrer erwerben. Für die Schule wird auch dieses schon ein Ge-
winn sein.
Qroß-Lichterfelde. ____________ Karl Pappenheini.
• Ranck, Geschichte der Gartenkunst. Mit 41 Abbildungen im Text.
(Aus Natur und Geisteswelt. Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher
Darstellungen. 274. Bändchen.) Leipzig, B. G. Teubner, 1909. Kl. 8°. 100 S.
p 6r Inna't sei zunächst kurz im Auszug mitgeteilt. In seiner ursprünglichen
ku t 'det der Garten eine Gemeinschaft mit dem Hause. Eine eigentliche Garten-
So ri ginnt in dem Augenblick, wo der Garten nicht mehr bloß dem Nutzen,
in rl ri™ aUCh der Ernc,lung zu dienen hat, wo man dazu übergeht, ihn aufzuteilen
durch Wege mit dem Hause zu verbinden. Die älteste Art der Aufteilung war
SJ) „geometrische. Im Mittelalter, bei den Völkern des Abendlandes, war das Ur-
ungliche der Nutzgarten, und es bedurfte einer langen Entwicklung, bis die
fül rt 6- an der Pf,anzc a,s solcher sich geltend machte. Das geometrische Prinzip
e im 18. Jahrhundert zu einer Ausartung in der Sucht, durch Beschneiden der
zu i"16 Und Straucr|er Architekturteile oder menschliche und tierische Gestalten nach-
En i"16"' ^ie Reaktion führte unter dem Einfluß des chinesischen Gartens, von
dar f ausgellend, zur Betätigung des Landschaftsprinzips. Hierbei ging man
aus, die Mitwirkung der Kunst sorgfältig zu verbergen. Auch dieses Prinzip,
besser getan, irgend ein wichtiges Objekt, z. B. ein Pferd vorzuführen, zunächst in
einfachsten Strichzeichnungen, aus denen sich eine Reihe immer komplizierterer
wissenschaftlicher Schemata entwickelt; und diese Reihe muß übergehen in die
künstlerischen Skizzen. Dabei bin ich bei dem Kernpunkt meines Vorwurfes
angelangt: Weber macht unnötigerweise eine scharfe Scheidung zwischen wissen-
schaftlichen und künstlerischen Wandtafelbildern, und dadurch schreckt er alle die
ap, die nicht, wie der Verfasser, die Fähigkeit haben »gestalten zu können, was sie
einst mit den Augen der Seele sahen und schauten«.
Noch ein weiterer Punkt! Weber benutzt eine schwarze Wandtafel, weil sie in
uen Schulen fast aller Kulturstaaten anzutreffen ist. Er findet sich in das Unab-
änderliche und zeichnet Landschaften mit schwarzem Himmel, für dunkle Tiere
braucht er einen weißen Kontur, obgleich »solche Glasmalertechnik unkünstlerisch
wirkt«, und in der Erde kriechen weiße Füchse und weiße Maulwürfe. Eine Kreide-
zeichnung, die nur noch stellenweise die dunkle Wandtafel durchblicken läßt, gehört
überhaupt nicht auf die Wandtafel. Sie muß eben auf hellem Grunde ausgeführt
erden. Es gibt heute schon helle Wandtafeln aus Glas, Aluminium oder
organischen Kunststoffen. Wer keine solche Tafel hat, wohl aber Gestaltungskraft
«u bunte Kreiden besitzt, der zeichne lieber, wie der Verfasser an einer Stelle
n andeutet, auf billigem, rauhem, hellem Papier, das er vor der Stunde irgendwo
■spannt. Dann wird er sich gerade in den Unterklassen die Arbeit sehr erleichtern
W wird vor allem nicht erst Anlaß zu zahllosen Mißverständnissen geben, die bei
n des Zeichnens noch unkundigen Zehnjährigen in der Naturbeschreibung vielfach
lrcn den schwarzen Grund der Tafel veranlaßt werden.
Abgesehen von den angedeuteten Mängeln bietet das Werk so viel Anregendes,
man ihm weiteste Verbreitung wünschen kann. Es gibt eine äußerst geschickte
1 bequem zu handhabende Zusammenfassung des auf diesem Gebiet Erreichten.
lcl wenn es auch nur wenige so weit bringen, daß sie während ihres Unterrichtes
"Prächtige Anschauungsbilder entstehen lassen oder während einer formvoll-
, .. ten Naturschilderung eine damit übereinstimmende Farbenskizze entwerfen
nen — ejn gewisses Maß von technischem Können kann sich mit Hilfe dieser
eitung jeder Lehrer erwerben. Für die Schule wird auch dieses schon ein Ge-
winn sein.
Qroß-Lichterfelde. ____________ Karl Pappenheini.
• Ranck, Geschichte der Gartenkunst. Mit 41 Abbildungen im Text.
(Aus Natur und Geisteswelt. Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher
Darstellungen. 274. Bändchen.) Leipzig, B. G. Teubner, 1909. Kl. 8°. 100 S.
p 6r Inna't sei zunächst kurz im Auszug mitgeteilt. In seiner ursprünglichen
ku t 'det der Garten eine Gemeinschaft mit dem Hause. Eine eigentliche Garten-
So ri ginnt in dem Augenblick, wo der Garten nicht mehr bloß dem Nutzen,
in rl ri™ aUCh der Ernc,lung zu dienen hat, wo man dazu übergeht, ihn aufzuteilen
durch Wege mit dem Hause zu verbinden. Die älteste Art der Aufteilung war
SJ) „geometrische. Im Mittelalter, bei den Völkern des Abendlandes, war das Ur-
ungliche der Nutzgarten, und es bedurfte einer langen Entwicklung, bis die
fül rt 6- an der Pf,anzc a,s solcher sich geltend machte. Das geometrische Prinzip
e im 18. Jahrhundert zu einer Ausartung in der Sucht, durch Beschneiden der
zu i"16 Und Straucr|er Architekturteile oder menschliche und tierische Gestalten nach-
En i"16"' ^ie Reaktion führte unter dem Einfluß des chinesischen Gartens, von
dar f ausgellend, zur Betätigung des Landschaftsprinzips. Hierbei ging man
aus, die Mitwirkung der Kunst sorgfältig zu verbergen. Auch dieses Prinzip,