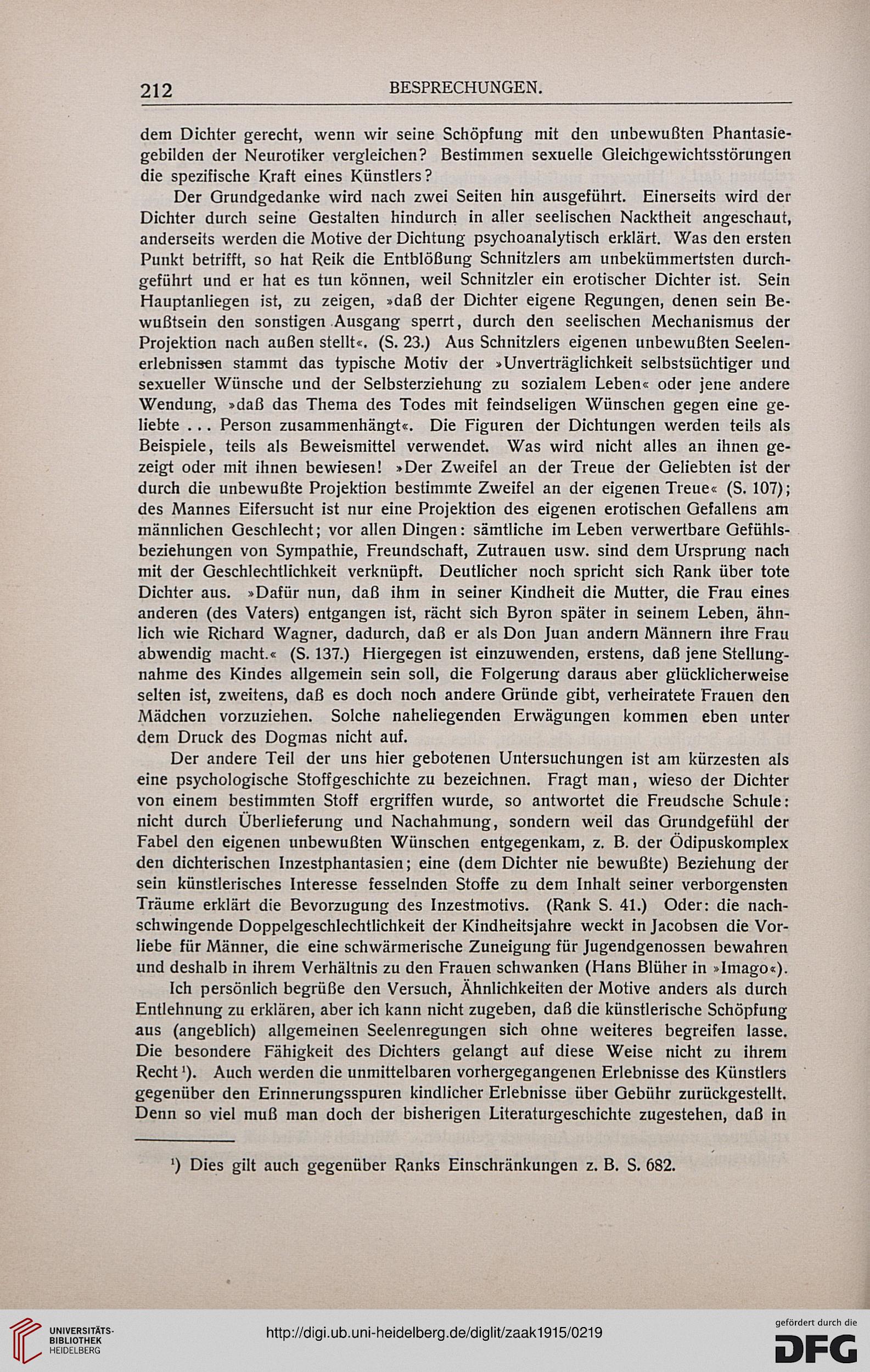212 BESPRECHUNGEN.
dem Dichter gerecht, wenn wir seine Schöpfung mit den unbewußten Phantasie-
gebilden der Neurotiker vergleichen? Bestimmen sexuelle Gleichgewichtsstörungen
die spezifische Kraft eines Künstlers?
Der Grundgedanke wird nach zwei Seiten hin ausgeführt. Einerseits wird der
Dichter durch seine Gestalten hindurch in aller seelischen Nacktheit angeschaut,
anderseits werden die Motive der Dichtung psychoanalytisch erklärt. Was den ersten
Punkt betrifft, so hat Reik die Entblößung Schnitzlers am unbekümmertsten durch-
geführt und er hat es tun können, weil Schnitzler ein erotischer Dichter ist. Sein
Hauptanliegen ist, zu zeigen, »daß der Dichter eigene Regungen, denen sein Be-
wußtsein den sonstigen Ausgang sperrt, durch den seelischen Mechanismus der
Projektion nach außen stellt«. (S. 23.) Aus Schnitzlers eigenen unbewußten Seelen-
erlebnissen stammt das typische Motiv der »Unverträglichkeit selbstsüchtiger und
sexueller Wünsche und der Selbsterziehung zu sozialem Leben« oder jene andere
Wendung, »daß das Thema des Todes mit feindseligen Wünschen gegen eine ge-
liebte . .. Person zusammenhängt«. Die Figuren der Dichtungen werden teils als
Beispiele, teils als Beweismittel verwendet. Was wird nicht alles an ihnen ge-
zeigt oder mit ihnen bewiesen! »Der Zweifel an der Treue der Geliebten ist der
durch die unbewußte Projektion bestimmte Zweifel an der eigenen Treue« (S. 107);
des Mannes Eifersucht ist nur eine Projektion des eigenen erotischen Gefallens am
männlichen Geschlecht; vor allen Dingen: sämtliche im Leben verwertbare Gefühls-
beziehungen von Sympathie, Freundschaft, Zutrauen usw. sind dem Ursprung nach
mit der Geschlechtlichkeit verknüpft. Deutlicher noch spricht sich Rank über tote
Dichter aus. »Dafür nun, daß ihm in seiner Kindheit die Mutter, die Frau eines
anderen (des Vaters) entgangen ist, rächt sich Byron später in seinem Leben, ähn-
lich wie Richard Wagner, dadurch, daß er als Don Juan andern Männern ihre Frau
abwendig macht.« (S. 137.) Hiergegen ist einzuwenden, erstens, daß jene Stellung-
nahme des Kindes allgemein sein soll, die Folgerung daraus aber glücklicherweise
selten ist, zweitens, daß es doch noch andere Gründe gibt, verheiratete Frauen den
Mädchen vorzuziehen. Solche naheliegenden Erwägungen kommen eben unter
dem Druck des Dogmas nicht auf.
Der andere Teil der uns hier gebotenen Untersuchungen ist am kürzesten als
eine psychologische Stoffgeschichte zu bezeichnen. Fragt man, wieso der Dichter
von einem bestimmten Stoff ergriffen wurde, so antwortet die Freudsche Schule:
nicht durch Überlieferung und Nachahmung, sondern weil das Grundgefühl der
Fabel den eigenen unbewußten Wünschen entgegenkam, z. B. der Ödipuskomplex
den dichterischen Inzestphantasien; eine (dem Dichter nie bewußte) Beziehung der
sein künstlerisches Interesse fesselnden Stoffe zu dem Inhalt seiner verborgensten
Träume erklärt die Bevorzugung des Inzestmotivs. (Rank S. 41.) Oder: die nach-
schwingende Doppelgeschlechtlichkeit der Kindheitsjahre weckt in Jacobsen die Vor-
liebe für Männer, die eine schwärmerische Zuneigung für Jugendgenossen bewahren
und deshalb in ihrem Verhältnis zu den Frauen schwanken (Hans Blüher in »Imago«).
Ich persönlich begrüße den Versuch, Ähnlichkeiten der Motive anders als durch
Entlehnung zu erklären, aber ich kann nicht zugeben, daß die künstlerische Schöpfung
aus (angeblich) allgemeinen Seelenregungen sich ohne weiteres begreifen lasse.
Die besondere Fähigkeit des Dichters gelangt auf diese Weise nicht zu ihrem
Recht'). Auch werden die unmittelbaren vorhergegangenen Erlebnisse des Künstlers
gegenüber den Erinnerungsspuren kindlicher Erlebnisse über Gebühr zurückgestellt.
Denn so viel muß man doch der bisherigen Literaturgeschichte zugestehen, daß in
') Dies gilt auch gegenüber Ranks Einschränkungen z. B. S. 682.
dem Dichter gerecht, wenn wir seine Schöpfung mit den unbewußten Phantasie-
gebilden der Neurotiker vergleichen? Bestimmen sexuelle Gleichgewichtsstörungen
die spezifische Kraft eines Künstlers?
Der Grundgedanke wird nach zwei Seiten hin ausgeführt. Einerseits wird der
Dichter durch seine Gestalten hindurch in aller seelischen Nacktheit angeschaut,
anderseits werden die Motive der Dichtung psychoanalytisch erklärt. Was den ersten
Punkt betrifft, so hat Reik die Entblößung Schnitzlers am unbekümmertsten durch-
geführt und er hat es tun können, weil Schnitzler ein erotischer Dichter ist. Sein
Hauptanliegen ist, zu zeigen, »daß der Dichter eigene Regungen, denen sein Be-
wußtsein den sonstigen Ausgang sperrt, durch den seelischen Mechanismus der
Projektion nach außen stellt«. (S. 23.) Aus Schnitzlers eigenen unbewußten Seelen-
erlebnissen stammt das typische Motiv der »Unverträglichkeit selbstsüchtiger und
sexueller Wünsche und der Selbsterziehung zu sozialem Leben« oder jene andere
Wendung, »daß das Thema des Todes mit feindseligen Wünschen gegen eine ge-
liebte . .. Person zusammenhängt«. Die Figuren der Dichtungen werden teils als
Beispiele, teils als Beweismittel verwendet. Was wird nicht alles an ihnen ge-
zeigt oder mit ihnen bewiesen! »Der Zweifel an der Treue der Geliebten ist der
durch die unbewußte Projektion bestimmte Zweifel an der eigenen Treue« (S. 107);
des Mannes Eifersucht ist nur eine Projektion des eigenen erotischen Gefallens am
männlichen Geschlecht; vor allen Dingen: sämtliche im Leben verwertbare Gefühls-
beziehungen von Sympathie, Freundschaft, Zutrauen usw. sind dem Ursprung nach
mit der Geschlechtlichkeit verknüpft. Deutlicher noch spricht sich Rank über tote
Dichter aus. »Dafür nun, daß ihm in seiner Kindheit die Mutter, die Frau eines
anderen (des Vaters) entgangen ist, rächt sich Byron später in seinem Leben, ähn-
lich wie Richard Wagner, dadurch, daß er als Don Juan andern Männern ihre Frau
abwendig macht.« (S. 137.) Hiergegen ist einzuwenden, erstens, daß jene Stellung-
nahme des Kindes allgemein sein soll, die Folgerung daraus aber glücklicherweise
selten ist, zweitens, daß es doch noch andere Gründe gibt, verheiratete Frauen den
Mädchen vorzuziehen. Solche naheliegenden Erwägungen kommen eben unter
dem Druck des Dogmas nicht auf.
Der andere Teil der uns hier gebotenen Untersuchungen ist am kürzesten als
eine psychologische Stoffgeschichte zu bezeichnen. Fragt man, wieso der Dichter
von einem bestimmten Stoff ergriffen wurde, so antwortet die Freudsche Schule:
nicht durch Überlieferung und Nachahmung, sondern weil das Grundgefühl der
Fabel den eigenen unbewußten Wünschen entgegenkam, z. B. der Ödipuskomplex
den dichterischen Inzestphantasien; eine (dem Dichter nie bewußte) Beziehung der
sein künstlerisches Interesse fesselnden Stoffe zu dem Inhalt seiner verborgensten
Träume erklärt die Bevorzugung des Inzestmotivs. (Rank S. 41.) Oder: die nach-
schwingende Doppelgeschlechtlichkeit der Kindheitsjahre weckt in Jacobsen die Vor-
liebe für Männer, die eine schwärmerische Zuneigung für Jugendgenossen bewahren
und deshalb in ihrem Verhältnis zu den Frauen schwanken (Hans Blüher in »Imago«).
Ich persönlich begrüße den Versuch, Ähnlichkeiten der Motive anders als durch
Entlehnung zu erklären, aber ich kann nicht zugeben, daß die künstlerische Schöpfung
aus (angeblich) allgemeinen Seelenregungen sich ohne weiteres begreifen lasse.
Die besondere Fähigkeit des Dichters gelangt auf diese Weise nicht zu ihrem
Recht'). Auch werden die unmittelbaren vorhergegangenen Erlebnisse des Künstlers
gegenüber den Erinnerungsspuren kindlicher Erlebnisse über Gebühr zurückgestellt.
Denn so viel muß man doch der bisherigen Literaturgeschichte zugestehen, daß in
') Dies gilt auch gegenüber Ranks Einschränkungen z. B. S. 682.