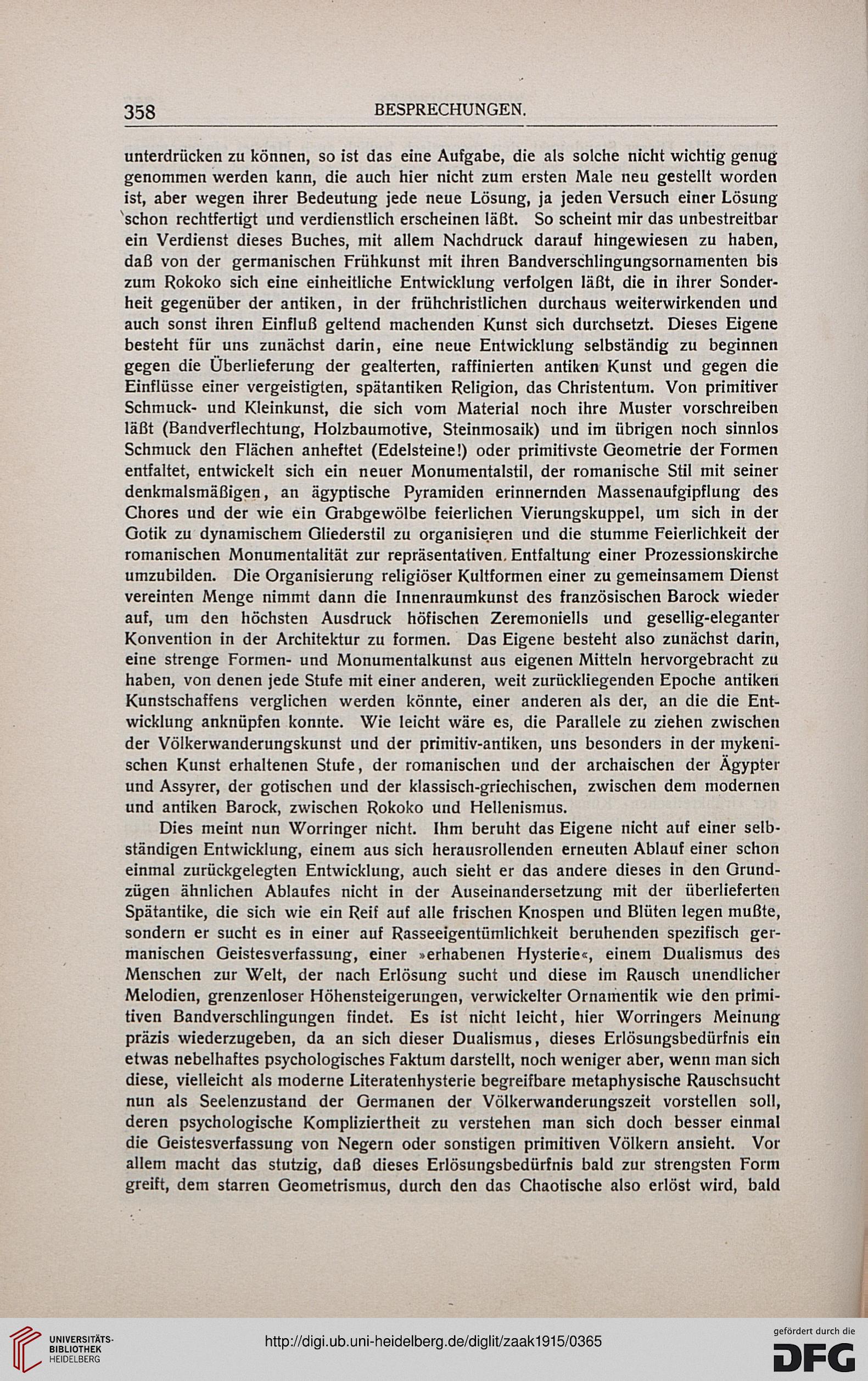358 BESPRECHUNGEN.
unterdrücken zu können, so ist das eine Aufgabe, die als solche nicht wichtig genug
genommen werden kann, die auch hier nicht zum ersten Male neu gestellt worden
ist, aber wegen ihrer Bedeutung jede neue Lösung, ja jeden Versuch einer Lösung
"schon rechtfertigt und verdienstlich erscheinen läßt. So scheint mir das unbestreitbar
ein Verdienst dieses Buches, mit allem Nachdruck darauf hingewiesen zu haben,
daß von der germanischen Frühkunst mit ihren Bandverschlingungsornamenten bis
zum Rokoko sich eine einheitliche Entwicklung verfolgen läßt, die in ihrer Sonder-
heit gegenüber der antiken, in der frühchristlichen durchaus weiterwirkenden und
auch sonst ihren Einfluß geltend machenden Kunst sich durchsetzt. Dieses Eigene
besteht für uns zunächst darin, eine neue Entwicklung selbständig zu beginnen
gegen die Überlieferung der gealterten, raffinierten antiken Kunst und gegen die
Einflüsse einer vergeistigten, spätantiken Religion, das Christentum. Von primitiver
Schmuck- und Kleinkunst, die sich vom Material noch ihre Muster vorschreiben
läßt (Bandverflechtung, Holzbaumotive, Steinmosaik) und im übrigen noch sinnlos
Schmuck den Flächen anheftet (Edelsteine!) oder primitivste Geometrie der Formen
entfaltet, entwickelt sich ein neuer Monumentalstil, der romanische Stil mit seiner
denkmalsmäßigen, an ägyptische Pyramiden erinnernden Massenaufgipflung des
Chores und der wie ein Grabgewölbe feierlichen Vierungskuppel, um sich in der
Gotik zu dynamischem Gliederstil zu organisieren und die stumme Feierlichkeit der
romanischen Monumentalität zur repräsentativen, Entfaltung einer Prozessionskirche
umzubilden. Die Organisierung religiöser Kultformen einer zu gemeinsamem Dienst
vereinten Menge nimmt dann die Innenraumkunst des französischen Barock wieder
auf, um den höchsten Ausdruck höfischen Zeremoniells und gesellig-eleganter
Konvention in der Architektur zu formen. Das Eigene besteht also zunächst darin,
eine strenge Formen- und Monumentalkunst aus eigenen Mitteln hervorgebracht zu
haben, von denen jede Stufe mit einer anderen, weit zurückliegenden Epoche antiken
Kunstschaffens verglichen werden könnte, einer anderen als der, an die die Ent-
wicklung anknüpfen konnte. Wie leicht wäre es, die Parallele zu ziehen zwischen
der Völkerwanderungskunst und der primitiv-antiken, uns besonders in der mykeni-
schen Kunst erhaltenen Stufe, der romanischen und der archaischen der Ägypter
und Assyrer, der gotischen und der klassisch-griechischen, zwischen dem modernen
und antiken Barock, zwischen Rokoko und Hellenismus.
Dies meint nun Worringer nicht. Ihm beruht das Eigene nicht auf einer selb-
ständigen Entwicklung, einem aus sich herausrollenden erneuten Ablauf einer schon
einmal zurückgelegten Entwicklung, auch sieht er das andere dieses in den Grund-
zügen ähnlichen Ablaufes nicht in der Auseinandersetzung mit der überlieferten
Spätantike, die sich wie ein Reif auf alle frischen Knospen und Blüten legen mußte,
sondern er sucht es in einer auf Rasseeigentümlichkeit beruhenden spezifisch ger-
manischen Geistesverfassung, einer »erhabenen Hysterie«, einem Dualismus des
Menschen zur Welt, der nach Erlösung sucht und diese im Rausch unendlicher
Melodien, grenzenloser Höhensteigerungen, verwickelter Ornamentik wie den primi-
tiven Bandverschlingungen findet. Es ist nicht leicht, hier Worringers Meinung
präzis wiederzugeben, da an sich dieser Dualismus, dieses Erlösungsbedürfnis ein
etwas nebelhaftes psychologisches Faktum darstellt, noch weniger aber, wenn man sich
diese, vielleicht als moderne Literatenhysterie begreifbare metaphysische Rauschsucht
nun als Seelenzustand der Germanen der Völkerwanderungszeit vorstellen soll,
deren psychologische Kompliziertheit zu verstehen man sich doch besser einmal
die Geistesverfassung von Negern oder sonstigen primitiven Völkern ansieht. Vor
allem macht das stutzig, daß dieses Erlösungsbedürfnis bald zur strengsten Form
greift, dem starren Geometrismus, durch den das Chaotische also erlöst wird, bald
unterdrücken zu können, so ist das eine Aufgabe, die als solche nicht wichtig genug
genommen werden kann, die auch hier nicht zum ersten Male neu gestellt worden
ist, aber wegen ihrer Bedeutung jede neue Lösung, ja jeden Versuch einer Lösung
"schon rechtfertigt und verdienstlich erscheinen läßt. So scheint mir das unbestreitbar
ein Verdienst dieses Buches, mit allem Nachdruck darauf hingewiesen zu haben,
daß von der germanischen Frühkunst mit ihren Bandverschlingungsornamenten bis
zum Rokoko sich eine einheitliche Entwicklung verfolgen läßt, die in ihrer Sonder-
heit gegenüber der antiken, in der frühchristlichen durchaus weiterwirkenden und
auch sonst ihren Einfluß geltend machenden Kunst sich durchsetzt. Dieses Eigene
besteht für uns zunächst darin, eine neue Entwicklung selbständig zu beginnen
gegen die Überlieferung der gealterten, raffinierten antiken Kunst und gegen die
Einflüsse einer vergeistigten, spätantiken Religion, das Christentum. Von primitiver
Schmuck- und Kleinkunst, die sich vom Material noch ihre Muster vorschreiben
läßt (Bandverflechtung, Holzbaumotive, Steinmosaik) und im übrigen noch sinnlos
Schmuck den Flächen anheftet (Edelsteine!) oder primitivste Geometrie der Formen
entfaltet, entwickelt sich ein neuer Monumentalstil, der romanische Stil mit seiner
denkmalsmäßigen, an ägyptische Pyramiden erinnernden Massenaufgipflung des
Chores und der wie ein Grabgewölbe feierlichen Vierungskuppel, um sich in der
Gotik zu dynamischem Gliederstil zu organisieren und die stumme Feierlichkeit der
romanischen Monumentalität zur repräsentativen, Entfaltung einer Prozessionskirche
umzubilden. Die Organisierung religiöser Kultformen einer zu gemeinsamem Dienst
vereinten Menge nimmt dann die Innenraumkunst des französischen Barock wieder
auf, um den höchsten Ausdruck höfischen Zeremoniells und gesellig-eleganter
Konvention in der Architektur zu formen. Das Eigene besteht also zunächst darin,
eine strenge Formen- und Monumentalkunst aus eigenen Mitteln hervorgebracht zu
haben, von denen jede Stufe mit einer anderen, weit zurückliegenden Epoche antiken
Kunstschaffens verglichen werden könnte, einer anderen als der, an die die Ent-
wicklung anknüpfen konnte. Wie leicht wäre es, die Parallele zu ziehen zwischen
der Völkerwanderungskunst und der primitiv-antiken, uns besonders in der mykeni-
schen Kunst erhaltenen Stufe, der romanischen und der archaischen der Ägypter
und Assyrer, der gotischen und der klassisch-griechischen, zwischen dem modernen
und antiken Barock, zwischen Rokoko und Hellenismus.
Dies meint nun Worringer nicht. Ihm beruht das Eigene nicht auf einer selb-
ständigen Entwicklung, einem aus sich herausrollenden erneuten Ablauf einer schon
einmal zurückgelegten Entwicklung, auch sieht er das andere dieses in den Grund-
zügen ähnlichen Ablaufes nicht in der Auseinandersetzung mit der überlieferten
Spätantike, die sich wie ein Reif auf alle frischen Knospen und Blüten legen mußte,
sondern er sucht es in einer auf Rasseeigentümlichkeit beruhenden spezifisch ger-
manischen Geistesverfassung, einer »erhabenen Hysterie«, einem Dualismus des
Menschen zur Welt, der nach Erlösung sucht und diese im Rausch unendlicher
Melodien, grenzenloser Höhensteigerungen, verwickelter Ornamentik wie den primi-
tiven Bandverschlingungen findet. Es ist nicht leicht, hier Worringers Meinung
präzis wiederzugeben, da an sich dieser Dualismus, dieses Erlösungsbedürfnis ein
etwas nebelhaftes psychologisches Faktum darstellt, noch weniger aber, wenn man sich
diese, vielleicht als moderne Literatenhysterie begreifbare metaphysische Rauschsucht
nun als Seelenzustand der Germanen der Völkerwanderungszeit vorstellen soll,
deren psychologische Kompliziertheit zu verstehen man sich doch besser einmal
die Geistesverfassung von Negern oder sonstigen primitiven Völkern ansieht. Vor
allem macht das stutzig, daß dieses Erlösungsbedürfnis bald zur strengsten Form
greift, dem starren Geometrismus, durch den das Chaotische also erlöst wird, bald