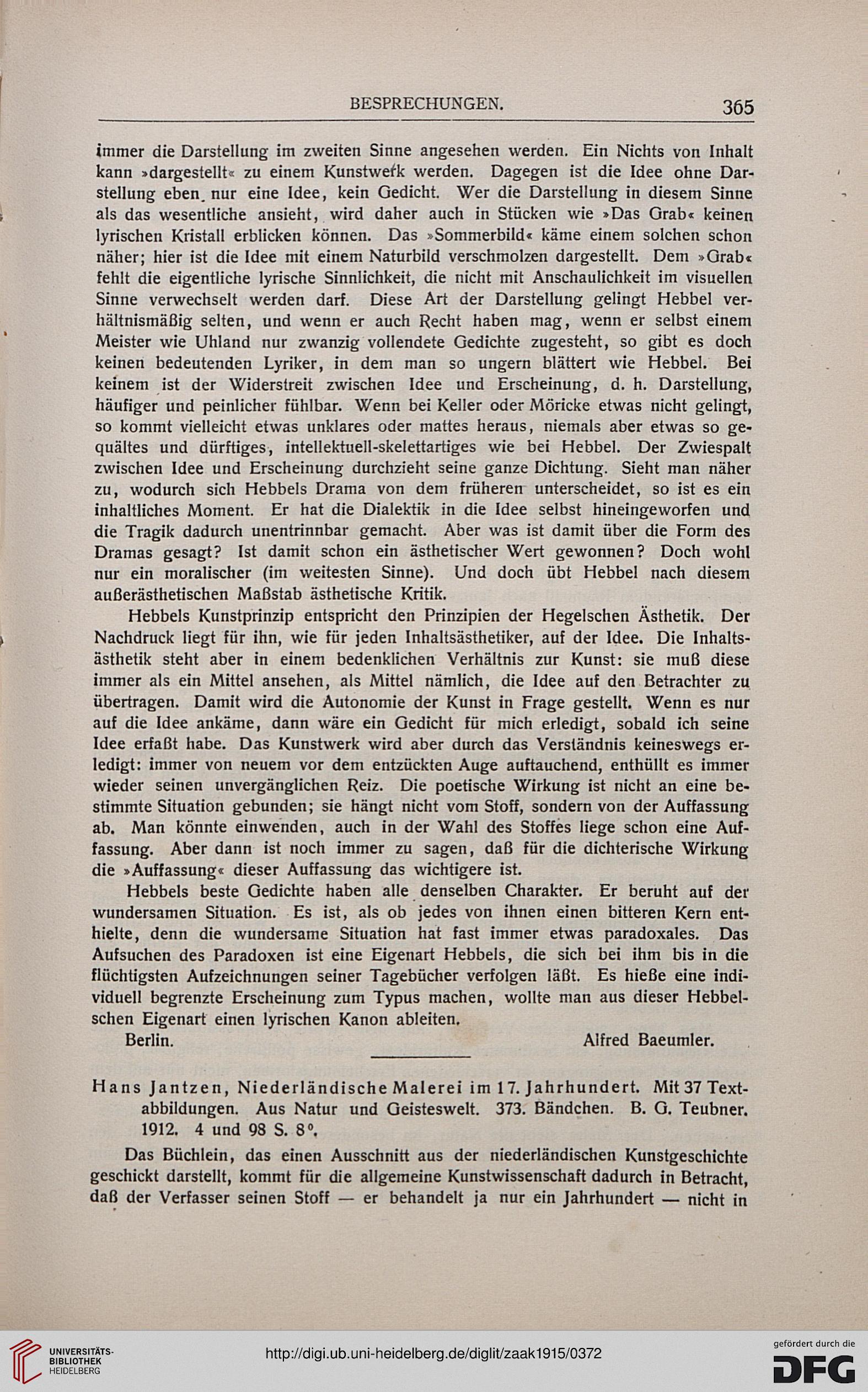BESPRECHUNGEN. 355
immer die Darstellung im zweiten Sinne angesehen werden. Ein Nichts von Inhalt
kann »dargestellt« zu einem Kunstwerk werden. Dagegen ist die Idee ohne Dar-
stellung eben, nur eine Idee, kein Gedicht. Wer die Darstellung in diesem Sinne
als das wesentliche ansieht, wird daher auch in Stücken wie »Das Grab« keinen
lyrischen Kristall erblicken können. Das »Sommerbild« käme einem solchen schon
näher; hier ist die Idee mit einem Naturbild verschmolzen dargestellt. Dem »Grab«
fehlt die eigentliche lyrische Sinnlichkeit, die nicht mit Anschaulichkeit im visuellen
Sinne verwechselt werden darf. Diese Art der Darstellung gelingt Hebbel ver-
hältnismäßig selten, und wenn er auch Recht haben mag, wenn er selbst einem
Meister wie Uhland nur zwanzig vollendete Gedichte zugesteht, so gibt es doch
keinen bedeutenden Lyriker, in dem man so ungern blättert wie Hebbel. Bei
keinem ist der Widerstreit zwischen Idee und Erscheinung, d. h. Darstellung,
häufiger und peinlicher fühlbar. Wenn bei Keller oder Möricke etwas nicht gelingt,
so kommt vielleicht etwas unklares oder mattes heraus, niemals aber etwas so ge-
quältes und dürftiges, intellektuell-skelettartiges wie bei Hebbel. Der Zwiespalt
zwischen Idee und Erscheinung durchzieht seine ganze Dichtung. Sieht man näher
zu, wodurch sich Hebbels Drama von dem früheren unterscheidet, so ist es ein
inhaltliches Moment. Er hat die Dialektik in die Idee selbst hineingeworfen und
die Tragik dadurch unentrinnbar gemacht. Aber was ist damit über die Form des
Dramas gesagt? Ist damit schon ein ästhetischer Wert gewonnen? Doch wohl
nur ein moralischer (im weitesten Sinne). Und doch übt Hebbel nach diesem
außerästhetischen Maßstab ästhetische Kritik.
Hebbels Kunstprinzip entspricht den Prinzipien der Hegeischen Ästhetik. Der
Nachdruck liegt für ihn, wie für jeden Inhaltsästhetiker, auf der Idee. Die Inhalts-
ästhetik steht aber in einem bedenklichen Verhältnis zur Kunst: sie muß diese
immer als ein Mittel ansehen, als Mittel nämlich, die Idee auf den Betrachter zu
übertragen. Damit wird die Autonomie der Kunst in Frage gestellt. Wenn es nur
auf die Idee ankäme, dann wäre ein Gedicht für mich erledigt, sobald ich seine
Idee erfaßt habe. Das Kunstwerk wird aber durch das Verständnis keineswegs er-
ledigt: immer von neuem vor dem entzückten Auge auftauchend, enthüllt es immer
wieder seinen unvergänglichen Reiz. Die poetische Wirkung ist nicht an eine be-
stimmte Situation gebunden; sie hängt nicht vom Stoff, sondern von der Auffassung
ab. Man könnte einwenden, auch in der Wahl des Stoffes liege schon eine Auf-
fassung. Aber dann ist noch immer zu sagen, daß für die dichterische Wirkung
die »Auffassung« dieser Auffassung das wichtigere ist.
Hebbels beste Gedichte haben alle denselben Charakter. Er beruht auf der
wundersamen Situation. Es ist, als ob jedes von ihnen einen bitteren Kern ent-
hielte, denn die wundersame Situation hat fast immer etwas paradoxales. Das
Aufsuchen des Paradoxen ist eine Eigenart Hebbels, die sich bei ihm bis in die
flüchtigsten Aufzeichnungen seiner Tagebücher verfolgen läßt. Es hieße eine indi-
viduell begrenzte Erscheinung zum Typus machen, wollte man aus dieser Hebbel-
schen Eigenart einen lyrischen Kanon ableiten.
Berlin. Alfred Baeumler.
Hans Jantzen, Niederländische Malerei im 17. Jahrhundert. Mit 37 Text-
abbildungen. Aus Natur und Geisteswelt. 373. Bändchen. B. G. Teubner.
1912. 4 und 98 S. 8°.
Das Büchlein, das einen Ausschnitt aus der niederländischen Kunstgeschichte
geschickt darstellt, kommt für die allgemeine Kunstwissenschaft dadurch in Betracht,
daß der Verfasser seinen Stoff — er behandelt ja nur ein Jahrhundert — nicht in
immer die Darstellung im zweiten Sinne angesehen werden. Ein Nichts von Inhalt
kann »dargestellt« zu einem Kunstwerk werden. Dagegen ist die Idee ohne Dar-
stellung eben, nur eine Idee, kein Gedicht. Wer die Darstellung in diesem Sinne
als das wesentliche ansieht, wird daher auch in Stücken wie »Das Grab« keinen
lyrischen Kristall erblicken können. Das »Sommerbild« käme einem solchen schon
näher; hier ist die Idee mit einem Naturbild verschmolzen dargestellt. Dem »Grab«
fehlt die eigentliche lyrische Sinnlichkeit, die nicht mit Anschaulichkeit im visuellen
Sinne verwechselt werden darf. Diese Art der Darstellung gelingt Hebbel ver-
hältnismäßig selten, und wenn er auch Recht haben mag, wenn er selbst einem
Meister wie Uhland nur zwanzig vollendete Gedichte zugesteht, so gibt es doch
keinen bedeutenden Lyriker, in dem man so ungern blättert wie Hebbel. Bei
keinem ist der Widerstreit zwischen Idee und Erscheinung, d. h. Darstellung,
häufiger und peinlicher fühlbar. Wenn bei Keller oder Möricke etwas nicht gelingt,
so kommt vielleicht etwas unklares oder mattes heraus, niemals aber etwas so ge-
quältes und dürftiges, intellektuell-skelettartiges wie bei Hebbel. Der Zwiespalt
zwischen Idee und Erscheinung durchzieht seine ganze Dichtung. Sieht man näher
zu, wodurch sich Hebbels Drama von dem früheren unterscheidet, so ist es ein
inhaltliches Moment. Er hat die Dialektik in die Idee selbst hineingeworfen und
die Tragik dadurch unentrinnbar gemacht. Aber was ist damit über die Form des
Dramas gesagt? Ist damit schon ein ästhetischer Wert gewonnen? Doch wohl
nur ein moralischer (im weitesten Sinne). Und doch übt Hebbel nach diesem
außerästhetischen Maßstab ästhetische Kritik.
Hebbels Kunstprinzip entspricht den Prinzipien der Hegeischen Ästhetik. Der
Nachdruck liegt für ihn, wie für jeden Inhaltsästhetiker, auf der Idee. Die Inhalts-
ästhetik steht aber in einem bedenklichen Verhältnis zur Kunst: sie muß diese
immer als ein Mittel ansehen, als Mittel nämlich, die Idee auf den Betrachter zu
übertragen. Damit wird die Autonomie der Kunst in Frage gestellt. Wenn es nur
auf die Idee ankäme, dann wäre ein Gedicht für mich erledigt, sobald ich seine
Idee erfaßt habe. Das Kunstwerk wird aber durch das Verständnis keineswegs er-
ledigt: immer von neuem vor dem entzückten Auge auftauchend, enthüllt es immer
wieder seinen unvergänglichen Reiz. Die poetische Wirkung ist nicht an eine be-
stimmte Situation gebunden; sie hängt nicht vom Stoff, sondern von der Auffassung
ab. Man könnte einwenden, auch in der Wahl des Stoffes liege schon eine Auf-
fassung. Aber dann ist noch immer zu sagen, daß für die dichterische Wirkung
die »Auffassung« dieser Auffassung das wichtigere ist.
Hebbels beste Gedichte haben alle denselben Charakter. Er beruht auf der
wundersamen Situation. Es ist, als ob jedes von ihnen einen bitteren Kern ent-
hielte, denn die wundersame Situation hat fast immer etwas paradoxales. Das
Aufsuchen des Paradoxen ist eine Eigenart Hebbels, die sich bei ihm bis in die
flüchtigsten Aufzeichnungen seiner Tagebücher verfolgen läßt. Es hieße eine indi-
viduell begrenzte Erscheinung zum Typus machen, wollte man aus dieser Hebbel-
schen Eigenart einen lyrischen Kanon ableiten.
Berlin. Alfred Baeumler.
Hans Jantzen, Niederländische Malerei im 17. Jahrhundert. Mit 37 Text-
abbildungen. Aus Natur und Geisteswelt. 373. Bändchen. B. G. Teubner.
1912. 4 und 98 S. 8°.
Das Büchlein, das einen Ausschnitt aus der niederländischen Kunstgeschichte
geschickt darstellt, kommt für die allgemeine Kunstwissenschaft dadurch in Betracht,
daß der Verfasser seinen Stoff — er behandelt ja nur ein Jahrhundert — nicht in