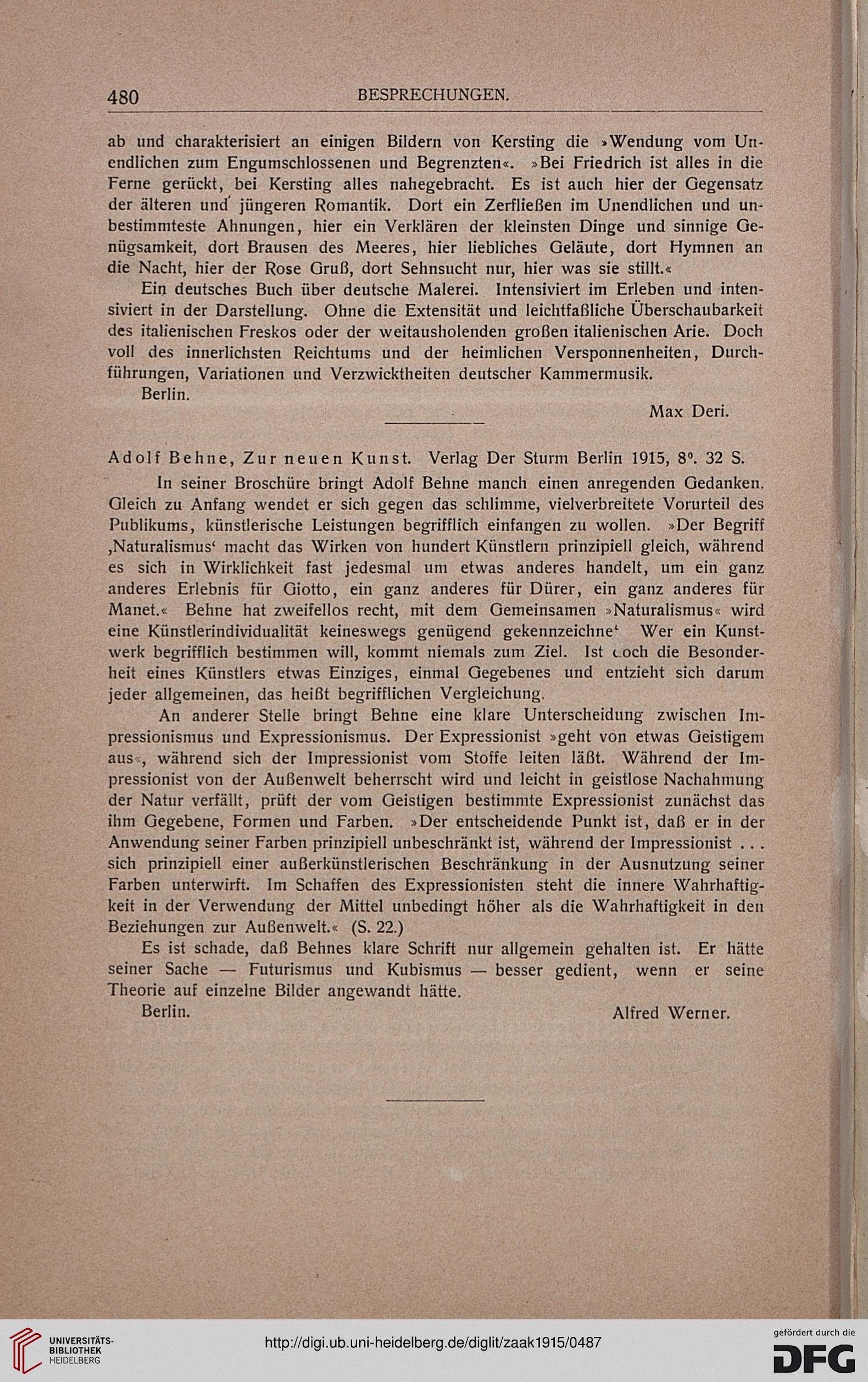480 BESPRECHUNGEN.
ab und charakterisiert an einigen Bildern von Kersting die »Wendung vom Un-
endlichen zum Engumschlossenen und Begrenzten«. »Bei Friedrich ist alles in die
Ferne gerückt, bei Kersting alles nahegebracht. Es ist auch hier der Gegensatz
der älteren und' jüngeren Romantik. Dort ein Zerfließen im Unendlichen und un-
bestimmteste Ahnungen, hier ein Verklären der kleinsten Dinge und sinnige Ge-
nügsamkeit, dort Brausen des Meeres, hier liebliches Geläute, dort Hymnen an
die Nacht, hier der Rose Gruß, dort Sehnsucht nur, hier was sie stillt.«
Ein deutsches Buch über deutsche Malerei. Intensiviert im Erleben und inten-
siviert in der Darstellung. Ohne die Extensität und leichtfaßliche Überschaubarkeit
des italienischen Freskos oder der weitausholenden großen italienischen Arie. Doch
voll des innerlichsten Reichtums und der heimlichen Versponnenheiten, Durch-
führungen, Variationen und Verzwicktheiten deutscher Kammermusik.
Berlin.
Max Deri.
Adolf Behne, Zur neuen Kunst. Verlag Der Sturm Berlin 1915, 8°. 32 S.
In seiner Broschüre bringt Adolf Behne manch einen anregenden Gedanken.
Gleich zu Anfang wendet er sich gegen das schlimme, vielverbreitete Vorurteil des
Publikums, künstlerische Leistungen begrifflich einfangen zu wollen. »Der Begriff
,Naturalismus' macht das Wirken von hundert Künstlern prinzipiell gleich, während
es sich in Wirklichkeit fast jedesmal um etwas anderes handelt, um ein ganz
anderes Erlebnis für Giotto, ein ganz anderes für Dürer, ein ganz anderes für
Manet.« Behne hat zweifellos recht, mit dem Gemeinsamen »Naturalismus« wird
eine Künstlerindividualität keineswegs genügend gekennzeichne' Wer ein Kunst-
werk begrifflich bestimmen will, kommt niemals zum Ziel. Ist loch die Besonder-
heit eines Künstlers etwas Einziges, einmal Gegebenes und entzieht sich darum
jeder allgemeinen, das heißt begrifflichen Vergleichung.
An anderer Stelle bringt Behne eine klare Unterscheidung zwischen Im-
pressionismus und Expressionismus. Der Expressionist »geht von etwas Geistigem
aus, während sich der Impressionist vom Stoffe leiten läßt. Während der Im-
pressionist von der Außenwelt beherrscht wird und leicht in geistlose Nachahmung
der Natur verfällt, prüft der vom Geistigen bestimmte Expressionist zunächst das
ihm Gegebene, Formen und Farben. »Der entscheidende Punkt ist, daß er in der
Anwendung seiner Farben prinzipiell unbeschränkt ist, während der Impressionist .. .
sich prinzipiell einer außerkünstlerischen Beschränkung in der Ausnutzung seiner
Farben unterwirft. Im Schaffen des Expressionisten steht die innere Wahrhaftig-
keit in der Verwendung der Mittel unbedingt höher als die Wahrhaftigkeit in den
Beziehungen zur Außenwelt.« (S. 22.)
Es ist schade, daß Behnes klare Schrift nur allgemein gehalten ist. Er hätte
seiner Sache — Futurismus und Kubismus — besser gedient, wenn er seine
Theorie auf einzelne Bilder angewandt hätte.
Berlin. Alfred Werner.
ab und charakterisiert an einigen Bildern von Kersting die »Wendung vom Un-
endlichen zum Engumschlossenen und Begrenzten«. »Bei Friedrich ist alles in die
Ferne gerückt, bei Kersting alles nahegebracht. Es ist auch hier der Gegensatz
der älteren und' jüngeren Romantik. Dort ein Zerfließen im Unendlichen und un-
bestimmteste Ahnungen, hier ein Verklären der kleinsten Dinge und sinnige Ge-
nügsamkeit, dort Brausen des Meeres, hier liebliches Geläute, dort Hymnen an
die Nacht, hier der Rose Gruß, dort Sehnsucht nur, hier was sie stillt.«
Ein deutsches Buch über deutsche Malerei. Intensiviert im Erleben und inten-
siviert in der Darstellung. Ohne die Extensität und leichtfaßliche Überschaubarkeit
des italienischen Freskos oder der weitausholenden großen italienischen Arie. Doch
voll des innerlichsten Reichtums und der heimlichen Versponnenheiten, Durch-
führungen, Variationen und Verzwicktheiten deutscher Kammermusik.
Berlin.
Max Deri.
Adolf Behne, Zur neuen Kunst. Verlag Der Sturm Berlin 1915, 8°. 32 S.
In seiner Broschüre bringt Adolf Behne manch einen anregenden Gedanken.
Gleich zu Anfang wendet er sich gegen das schlimme, vielverbreitete Vorurteil des
Publikums, künstlerische Leistungen begrifflich einfangen zu wollen. »Der Begriff
,Naturalismus' macht das Wirken von hundert Künstlern prinzipiell gleich, während
es sich in Wirklichkeit fast jedesmal um etwas anderes handelt, um ein ganz
anderes Erlebnis für Giotto, ein ganz anderes für Dürer, ein ganz anderes für
Manet.« Behne hat zweifellos recht, mit dem Gemeinsamen »Naturalismus« wird
eine Künstlerindividualität keineswegs genügend gekennzeichne' Wer ein Kunst-
werk begrifflich bestimmen will, kommt niemals zum Ziel. Ist loch die Besonder-
heit eines Künstlers etwas Einziges, einmal Gegebenes und entzieht sich darum
jeder allgemeinen, das heißt begrifflichen Vergleichung.
An anderer Stelle bringt Behne eine klare Unterscheidung zwischen Im-
pressionismus und Expressionismus. Der Expressionist »geht von etwas Geistigem
aus, während sich der Impressionist vom Stoffe leiten läßt. Während der Im-
pressionist von der Außenwelt beherrscht wird und leicht in geistlose Nachahmung
der Natur verfällt, prüft der vom Geistigen bestimmte Expressionist zunächst das
ihm Gegebene, Formen und Farben. »Der entscheidende Punkt ist, daß er in der
Anwendung seiner Farben prinzipiell unbeschränkt ist, während der Impressionist .. .
sich prinzipiell einer außerkünstlerischen Beschränkung in der Ausnutzung seiner
Farben unterwirft. Im Schaffen des Expressionisten steht die innere Wahrhaftig-
keit in der Verwendung der Mittel unbedingt höher als die Wahrhaftigkeit in den
Beziehungen zur Außenwelt.« (S. 22.)
Es ist schade, daß Behnes klare Schrift nur allgemein gehalten ist. Er hätte
seiner Sache — Futurismus und Kubismus — besser gedient, wenn er seine
Theorie auf einzelne Bilder angewandt hätte.
Berlin. Alfred Werner.