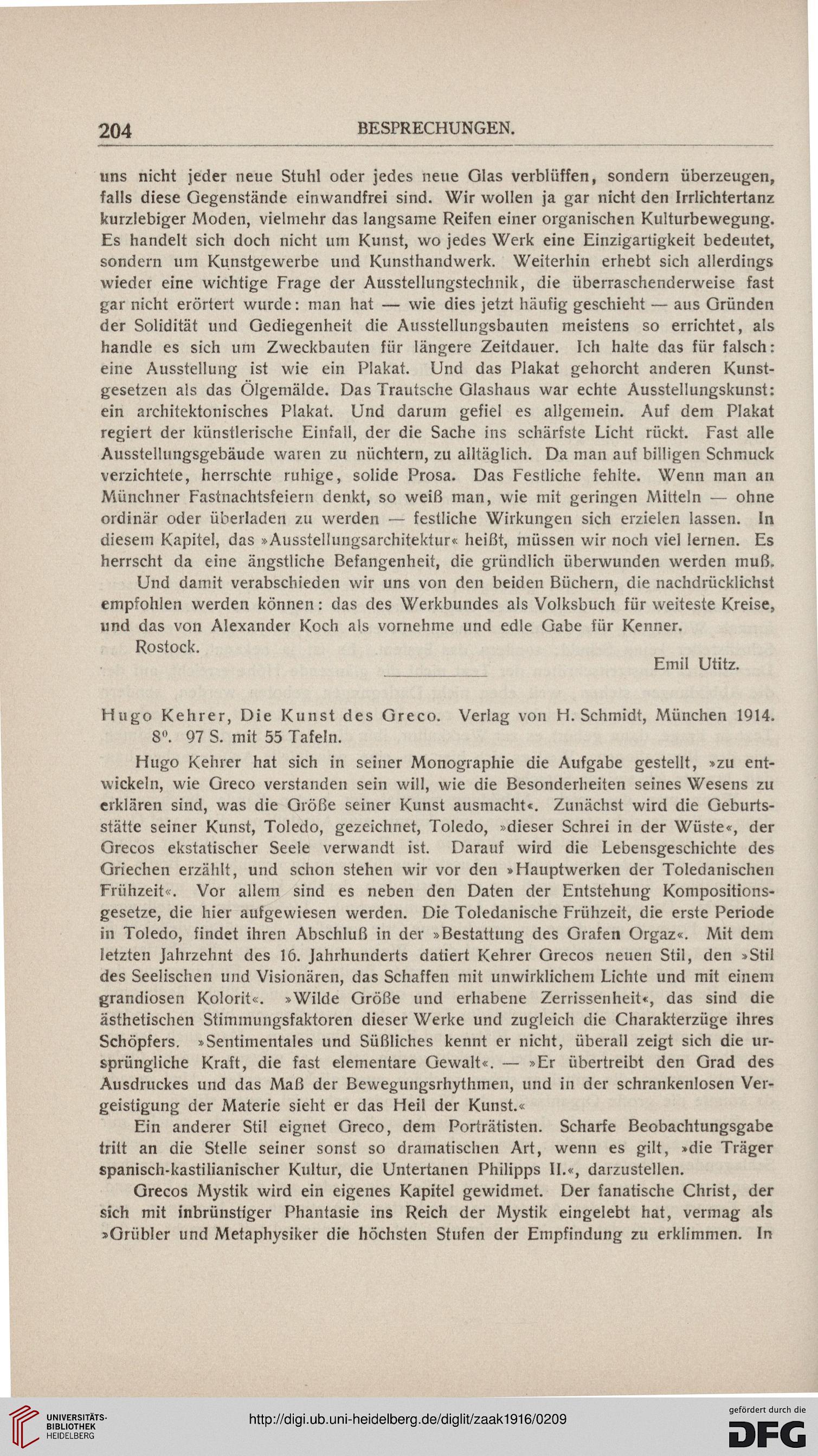204 BESPRECHUNGEN.
uns nicht jeder neue Stuhl oder jedes neue Olas verblüffen, sondern überzeugen,
falls diese Gegenstände einwandfrei sind. Wir wollen ja gar nicht den Irrlichtertanz
kurzlebiger Moden, vielmehr das langsame Reifen einer organischen Kulturbewegung.
Es handelt sich doch nicht um Kunst, wo jedes Werk eine Einzigartigkeit bedeutet,
sondern um Kunstgewerbe und Kunsthandwerk. Weiterhin erhebt sich allerdings
wieder eine wichtige Frage der Ausstellungstechnik, die überraschenderweise fast
gar nicht erörtert wurde: man hat — wie dies jetzt häufig geschieht — aus Gründen
der Solidität und Gediegenheit die Ausstellungsbauten meistens so errichtet, als
handle es sich um Zweckbauten für längere Zeitdauer. Ich halte das für falsch:
eine Ausstellung ist wie ein Plakat. Und das Plakat gehorcht anderen Kunst-
gesetzen als das Ölgemälde. Das Trautsche Glashaus war echte Ausstellungskunst:
ein architektonisches Plakat. Und darum gefiel es allgemein. Auf dem Plakat
regiert der künstlerische Einfall, der die Sache ins schärfste Licht rückt. Fast alle
Ausstellungsgebäude waren zu nüchtern, zu alltäglich. Da man auf billigen Schmuck
verzichtete, herrschte ruhige, solide Prosa. Das Festliche fehlte. Wenn man an
Münchner Fastnachtsfeiern denkt, so weiß man, wie mit geringen Mitteln — ohne
ordinär oder überladen zu werden — festliche Wirkungen sich erzielen lassen. In
diesem Kapitel, das »Ausstellungsarchitektur« heißt, müssen wir noch viel leinen. Es
herrscht da eine ängstliche Befangenheit, die gründlich überwunden werden muß.
Und damit verabschieden wir uns von den beiden Büchern, die nachdrücklichst
empfohlen werden können: das des Werkbundes als Volksbuch für weiteste Kreise,
und das von Alexander Koch als vornehme und edle Gabe für Kenner.
Rostock.
___ Emil Utitz.
Hugo Kehrer, Die Kunst des Greco. Verlag von H.Schmidt, München 1914.
8°. 97 S. mit 55 Tafeln.
Hugo Kehrer hat sich in seiner Monographie die Aufgabe gestellt, »zu ent-
wickeln, wie Greco verstanden sein will, wie die Besonderheiten seines Wesens zu
erklären sind, was die Größe seiner Kunst ausmacht«. Zunächst wird die Geburts-
stätte seiner Kunst, Toledo, gezeichnet, Toledo, »dieser Schrei in der Wüste«, der
Grecos ekstatischer Seele verwandt ist. Darauf wird die Lebensgeschichte des
Griechen erzählt, und schon stehen wir vor den »Hauptwerken der Toledanischen
Frühzeit«. Vor allem sind es neben den Daten der Entstehung Kompositions-
gesetze, die hier aufgewiesen werden. Die Toledanische Frühzeit, die erste Periode
in Toledo, findet ihren Abschluß in der »Bestattung des Grafen Orgaz«. Mit dem
letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts datiert Kehrer Grecos neuen Stil, den »Stil
des Seelischen und Visionären, das Schaffen mit unwirklichem Lichte und mit einem
grandiosen Kolorit«. »Wilde Größe und erhabene Zerrissenheit«, das sind die
ästhetischen Stimmungsfaktoren dieser Werke und zugleich die Charakterzüge ihres
Schöpfers. »Sentimentales und Süßliches kennt er nicht, überall zeigt sich die ur-
sprüngliche Kraft, die fast elementare Gewalt«. — »Er übertreibt den Grad des
Ausdruckes und das Maß der Bewegungsrhythmen, und in der schrankenlosen Ver-
geistigung der Materie sieht er das Heil der Kunst.«
Ein anderer Stil eignet Greco, dem Porträtisten. Scharfe Beobachtungsgabe
tritt an die Stelle seiner sonst so dramatischen Art, wenn es gilt, »die Träger
spanisch-kastilianischer Kultur, die Untertanen Philipps IL«, darzustellen.
Grecos Mystik wird ein eigenes Kapitel gewidmet. Der fanatische Christ, der
sich mit inbrünstiger Phantasie ins Reich der Mystik eingelebt hat, vermag als
»Grübler und Metaphysiker die höchsten Stufen der Empfindung zu erklimmen. In
uns nicht jeder neue Stuhl oder jedes neue Olas verblüffen, sondern überzeugen,
falls diese Gegenstände einwandfrei sind. Wir wollen ja gar nicht den Irrlichtertanz
kurzlebiger Moden, vielmehr das langsame Reifen einer organischen Kulturbewegung.
Es handelt sich doch nicht um Kunst, wo jedes Werk eine Einzigartigkeit bedeutet,
sondern um Kunstgewerbe und Kunsthandwerk. Weiterhin erhebt sich allerdings
wieder eine wichtige Frage der Ausstellungstechnik, die überraschenderweise fast
gar nicht erörtert wurde: man hat — wie dies jetzt häufig geschieht — aus Gründen
der Solidität und Gediegenheit die Ausstellungsbauten meistens so errichtet, als
handle es sich um Zweckbauten für längere Zeitdauer. Ich halte das für falsch:
eine Ausstellung ist wie ein Plakat. Und das Plakat gehorcht anderen Kunst-
gesetzen als das Ölgemälde. Das Trautsche Glashaus war echte Ausstellungskunst:
ein architektonisches Plakat. Und darum gefiel es allgemein. Auf dem Plakat
regiert der künstlerische Einfall, der die Sache ins schärfste Licht rückt. Fast alle
Ausstellungsgebäude waren zu nüchtern, zu alltäglich. Da man auf billigen Schmuck
verzichtete, herrschte ruhige, solide Prosa. Das Festliche fehlte. Wenn man an
Münchner Fastnachtsfeiern denkt, so weiß man, wie mit geringen Mitteln — ohne
ordinär oder überladen zu werden — festliche Wirkungen sich erzielen lassen. In
diesem Kapitel, das »Ausstellungsarchitektur« heißt, müssen wir noch viel leinen. Es
herrscht da eine ängstliche Befangenheit, die gründlich überwunden werden muß.
Und damit verabschieden wir uns von den beiden Büchern, die nachdrücklichst
empfohlen werden können: das des Werkbundes als Volksbuch für weiteste Kreise,
und das von Alexander Koch als vornehme und edle Gabe für Kenner.
Rostock.
___ Emil Utitz.
Hugo Kehrer, Die Kunst des Greco. Verlag von H.Schmidt, München 1914.
8°. 97 S. mit 55 Tafeln.
Hugo Kehrer hat sich in seiner Monographie die Aufgabe gestellt, »zu ent-
wickeln, wie Greco verstanden sein will, wie die Besonderheiten seines Wesens zu
erklären sind, was die Größe seiner Kunst ausmacht«. Zunächst wird die Geburts-
stätte seiner Kunst, Toledo, gezeichnet, Toledo, »dieser Schrei in der Wüste«, der
Grecos ekstatischer Seele verwandt ist. Darauf wird die Lebensgeschichte des
Griechen erzählt, und schon stehen wir vor den »Hauptwerken der Toledanischen
Frühzeit«. Vor allem sind es neben den Daten der Entstehung Kompositions-
gesetze, die hier aufgewiesen werden. Die Toledanische Frühzeit, die erste Periode
in Toledo, findet ihren Abschluß in der »Bestattung des Grafen Orgaz«. Mit dem
letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts datiert Kehrer Grecos neuen Stil, den »Stil
des Seelischen und Visionären, das Schaffen mit unwirklichem Lichte und mit einem
grandiosen Kolorit«. »Wilde Größe und erhabene Zerrissenheit«, das sind die
ästhetischen Stimmungsfaktoren dieser Werke und zugleich die Charakterzüge ihres
Schöpfers. »Sentimentales und Süßliches kennt er nicht, überall zeigt sich die ur-
sprüngliche Kraft, die fast elementare Gewalt«. — »Er übertreibt den Grad des
Ausdruckes und das Maß der Bewegungsrhythmen, und in der schrankenlosen Ver-
geistigung der Materie sieht er das Heil der Kunst.«
Ein anderer Stil eignet Greco, dem Porträtisten. Scharfe Beobachtungsgabe
tritt an die Stelle seiner sonst so dramatischen Art, wenn es gilt, »die Träger
spanisch-kastilianischer Kultur, die Untertanen Philipps IL«, darzustellen.
Grecos Mystik wird ein eigenes Kapitel gewidmet. Der fanatische Christ, der
sich mit inbrünstiger Phantasie ins Reich der Mystik eingelebt hat, vermag als
»Grübler und Metaphysiker die höchsten Stufen der Empfindung zu erklimmen. In