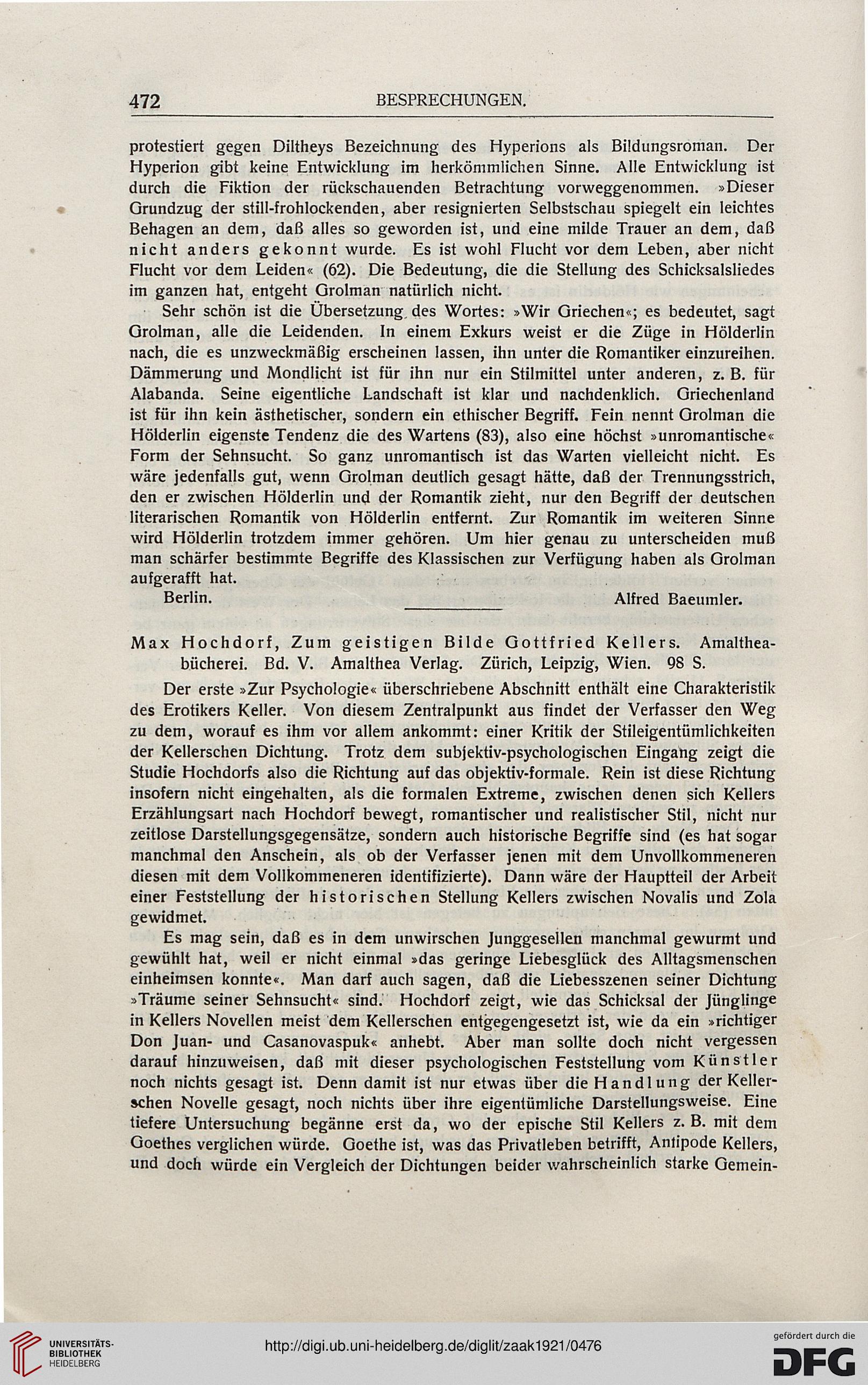472 BESPRECHUNGEN.
protestiert gegen Diltheys Bezeichnung des Hyperions als Büdungsroman. Der
Hyperion gibt keine Entwicklung im herkömmlichen Sinne. Alle Entwicklung ist
durch die Fiktion der rückschauenden Betrachtung vorweggenommen. »Dieser
Grundzug der still-frohlockenden, aber resignierten Selbstschau spiegelt ein leichtes
Behagen an dem, daß alles so geworden ist, und eine milde Trauer an dem, daß
nicht anders gekonnt wurde. Es ist wohl Flucht vor dem Leben, aber nicht
Flucht vor dem Leiden« (62). Die Bedeutung, die die Stellung des Schicksalsliedes
im ganzen hat, entgeht Grolman natürlich nicht.
■ Sehr schön ist die Übersetzung, des Wortes: »Wir Griechen«; es bedeutet, sagt
Grolman, alle die Leidenden. In einem Exkurs weist er die Züge in Hölderlin
nach, die es unzweckmäßig erscheinen lassen, ihn unter die Romantiker einzureihen.
Dämmerung und Mondlicht ist für ihn nur ein Stilmittel unter anderen, z.B. für
Alabanda. Seine eigentliche Landschaft ist klar und nachdenklich. Griechenland
ist für ihn kein ästhetischer, sondern ein ethischer Begriff. Fein nennt Grolman die
Hölderlin eigenste Tendenz die des Wartens (83), also eine höchst »unromantische«
Form der Sehnsucht. So ganz unromantisch ist das Warten vielleicht nicht. Es
wäre jedenfalls gut, wenn Grolman deutlich gesagt hätte, daß der Trennungsstrich,
den er zwischen Hölderlin und der Romantik zieht, nur den Begriff der deutschen
literarischen Romantik von Hölderlin entfernt. Zur Romantik im weiteren Sinne
wird Hölderlin trotzdem immer gehören. Um hier genau zu unterscheiden muß
man schärfer bestimmte Begriffe des Klassischen zur Verfügung haben als Grolman
aufgerafft hat.
Berlin. ___________ Alfred Baeumler.
Max Hochdorf, Zum geistigen Bilde Gottfried Kellers. Amalthea-
bücherei. Bd. V. Amalthea Verlag. Zürich, Leipzig, Wien. 98 S.
Der erste »Zur Psychologie« überschriebene Abschnitt enthält eine Charakteristik
des Erotikers Keller. Von diesem Zentralpunkt aus findet der Verfasser den Weg
zu dem, worauf es ihm vor allem ankommt: einer Kritik der Stileigentümlichkeiten
der Kellerschen Dichtung. Trotz dem subjektiv-psychologischen Eingang zeigt die
Studie Hochdorfs also die Richtung auf das objektiv-formale. Rein ist diese Richtung
insofern nicht eingehalten, als die formalen Extreme, zwischen denen sich Kellers
Erzählungsart nach Hochdorf bewegt, romantischer und realistischer Stil, nicht nur
zeitlose Darstellungsgegensätze, sondern auch historische Begriffe sind (es hat sogar
manchmal den Anschein, als ob der Verfasser jenen mit dem Unvollkommeneren
diesen mit dem Vollkommeneren identifizierte). Dann wäre der Hauptteil der Arbeit
einer Feststellung der historischen Stellung Kellers zwischen Novalis und Zola
gewidmet.
Es mag sein, daß es in dem unwirschen Junggeseilen manchmal gewurmt und
gewühlt hat, weil er nicht einmal »das geringe Liebesglück des Alltagsmenschen
einheimsen konnte«. Man darf auch sagen, daß die Liebesszenen seiner Dichtung
»Träume seiner Sehnsucht« sind. Hochdorf zeigt, wie das Schicksal der Jünglinge
in Kellers Novellen meist dem Kellerschen entgegengesetzt ist, wie da ein »richtiger
Don Juan- und Casanovaspuk« anhebt. Aber man sollte doch nicht vergessen
darauf hinzuweisen, daß mit dieser psychologischen Feststellung vom Künstler
noch nichts gesagt ist. Denn damit ist nur etwas über die Handlung der Keller-
schen Novelle gesagt, noch nichts über ihre eigentümliche Darstellungsweise. Eine
tiefere Untersuchung begänne erst da, wo der epische Stil Kellers z. B. mit dem
Goethes verglichen würde. Goethe ist, was das Privatleben betrifft, Antipode Kellers,
und doch würde ein Vergleich der Dichtungen beider wahrscheinlich starke Gemein-
protestiert gegen Diltheys Bezeichnung des Hyperions als Büdungsroman. Der
Hyperion gibt keine Entwicklung im herkömmlichen Sinne. Alle Entwicklung ist
durch die Fiktion der rückschauenden Betrachtung vorweggenommen. »Dieser
Grundzug der still-frohlockenden, aber resignierten Selbstschau spiegelt ein leichtes
Behagen an dem, daß alles so geworden ist, und eine milde Trauer an dem, daß
nicht anders gekonnt wurde. Es ist wohl Flucht vor dem Leben, aber nicht
Flucht vor dem Leiden« (62). Die Bedeutung, die die Stellung des Schicksalsliedes
im ganzen hat, entgeht Grolman natürlich nicht.
■ Sehr schön ist die Übersetzung, des Wortes: »Wir Griechen«; es bedeutet, sagt
Grolman, alle die Leidenden. In einem Exkurs weist er die Züge in Hölderlin
nach, die es unzweckmäßig erscheinen lassen, ihn unter die Romantiker einzureihen.
Dämmerung und Mondlicht ist für ihn nur ein Stilmittel unter anderen, z.B. für
Alabanda. Seine eigentliche Landschaft ist klar und nachdenklich. Griechenland
ist für ihn kein ästhetischer, sondern ein ethischer Begriff. Fein nennt Grolman die
Hölderlin eigenste Tendenz die des Wartens (83), also eine höchst »unromantische«
Form der Sehnsucht. So ganz unromantisch ist das Warten vielleicht nicht. Es
wäre jedenfalls gut, wenn Grolman deutlich gesagt hätte, daß der Trennungsstrich,
den er zwischen Hölderlin und der Romantik zieht, nur den Begriff der deutschen
literarischen Romantik von Hölderlin entfernt. Zur Romantik im weiteren Sinne
wird Hölderlin trotzdem immer gehören. Um hier genau zu unterscheiden muß
man schärfer bestimmte Begriffe des Klassischen zur Verfügung haben als Grolman
aufgerafft hat.
Berlin. ___________ Alfred Baeumler.
Max Hochdorf, Zum geistigen Bilde Gottfried Kellers. Amalthea-
bücherei. Bd. V. Amalthea Verlag. Zürich, Leipzig, Wien. 98 S.
Der erste »Zur Psychologie« überschriebene Abschnitt enthält eine Charakteristik
des Erotikers Keller. Von diesem Zentralpunkt aus findet der Verfasser den Weg
zu dem, worauf es ihm vor allem ankommt: einer Kritik der Stileigentümlichkeiten
der Kellerschen Dichtung. Trotz dem subjektiv-psychologischen Eingang zeigt die
Studie Hochdorfs also die Richtung auf das objektiv-formale. Rein ist diese Richtung
insofern nicht eingehalten, als die formalen Extreme, zwischen denen sich Kellers
Erzählungsart nach Hochdorf bewegt, romantischer und realistischer Stil, nicht nur
zeitlose Darstellungsgegensätze, sondern auch historische Begriffe sind (es hat sogar
manchmal den Anschein, als ob der Verfasser jenen mit dem Unvollkommeneren
diesen mit dem Vollkommeneren identifizierte). Dann wäre der Hauptteil der Arbeit
einer Feststellung der historischen Stellung Kellers zwischen Novalis und Zola
gewidmet.
Es mag sein, daß es in dem unwirschen Junggeseilen manchmal gewurmt und
gewühlt hat, weil er nicht einmal »das geringe Liebesglück des Alltagsmenschen
einheimsen konnte«. Man darf auch sagen, daß die Liebesszenen seiner Dichtung
»Träume seiner Sehnsucht« sind. Hochdorf zeigt, wie das Schicksal der Jünglinge
in Kellers Novellen meist dem Kellerschen entgegengesetzt ist, wie da ein »richtiger
Don Juan- und Casanovaspuk« anhebt. Aber man sollte doch nicht vergessen
darauf hinzuweisen, daß mit dieser psychologischen Feststellung vom Künstler
noch nichts gesagt ist. Denn damit ist nur etwas über die Handlung der Keller-
schen Novelle gesagt, noch nichts über ihre eigentümliche Darstellungsweise. Eine
tiefere Untersuchung begänne erst da, wo der epische Stil Kellers z. B. mit dem
Goethes verglichen würde. Goethe ist, was das Privatleben betrifft, Antipode Kellers,
und doch würde ein Vergleich der Dichtungen beider wahrscheinlich starke Gemein-