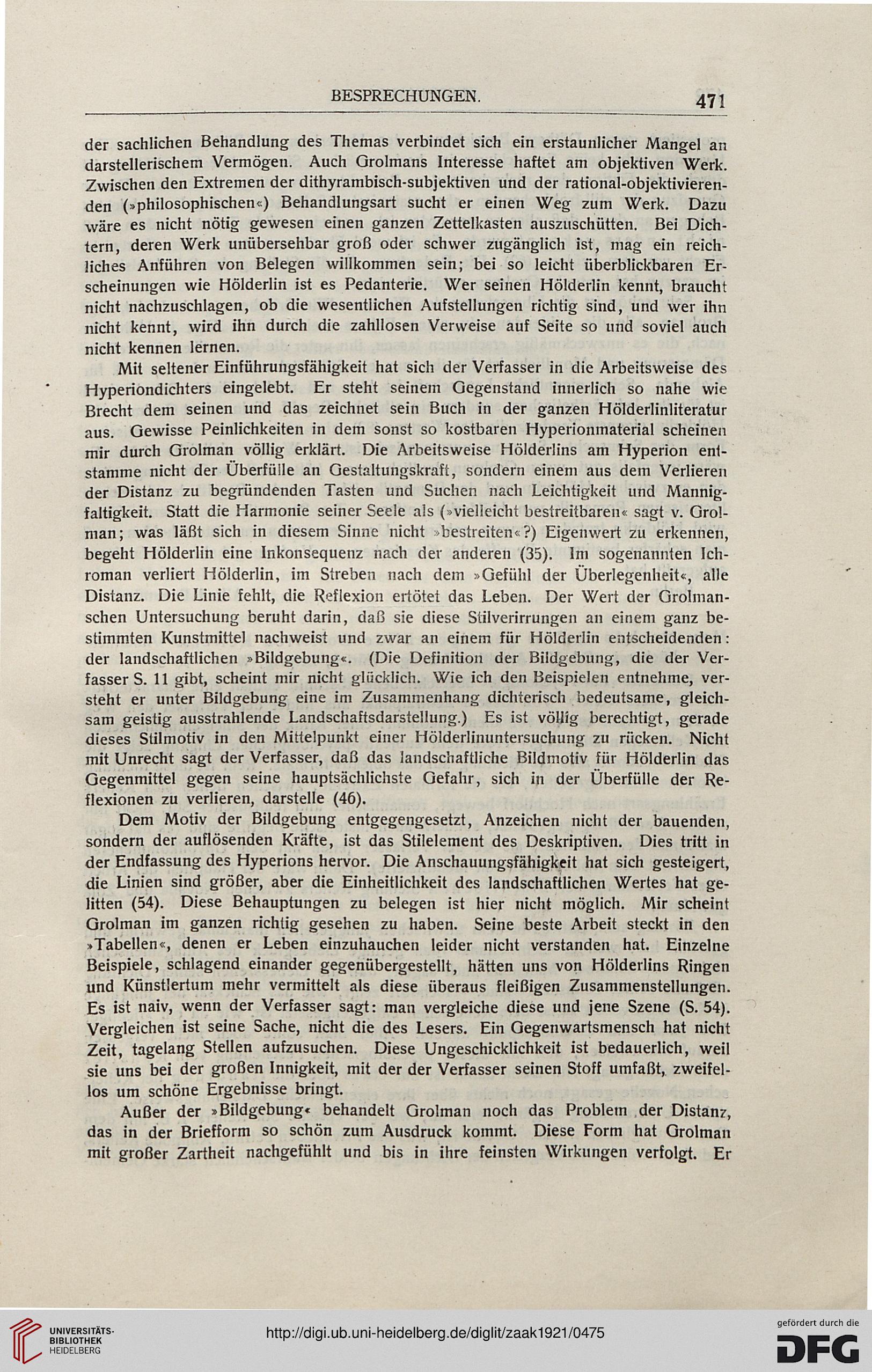BESPRECHUNGEN. 471
der sachlichen Behandlung des Themas verbindet sich ein erstaunlicher Mangel an
darstellerischem Vermögen. Auch Grolmans Interesse haftet am objektiven Werk.
Zwischen den Extremen der dithyrambisch-subjektiven und der rational-objektivieren-
den (»philosophischen«) Behandlungsart sucht er einen Weg zum Werk. Dazu
wäre es nicht nötig gewesen einen ganzen Zettelkasten auszuschütten. Bei Dich-
tern, deren Werk unübersehbar groß oder schwer zugänglich ist, mag ein reich-
liches Anführen von Belegen willkommen sein; bei so leicht überblickbaren Er-
scheinungen wie Hölderlin ist es Pedanterie. Wer seinen Hölderlin kennt, braucht
nicht nachzuschlagen, ob die wesentlichen Aufstellungen richtig sind, und wer ihn
nicht kennt, wird ihn durch die zahllosen Verweise auf Seite so und soviel auch
nicht kennen lernen.
Mit seltener Einführungsfähigkeit hat sich der Verfasser in die Arbeitsweise des
Hyperiondichters eingelebt. Er steht seinem Gegenstand innerlich so nahe wie
Brecht dem seinen und das zeichnet sein Buch in der ganzen Hölderlinliteratur
aus. Gewisse Peinlichkeiten in dem sonst so kostbaren Hyperionmaterial scheinen
mir durch Grolman völlig erklärt. Die Arbeitsweise Hölderlins am Hyperion ent-
stamme nicht der Überfülle an Gestaltungskraft, sondern einem aus dem Verlieren
der Distanz zu begründenden Tasten und Suchen nach Leichtigkeit und Mannig-
faltigkeit. Statt die Harmonie seiner Seele als (»vielleicht bestreitbaren« sagt v. Grol-
man; was läßt sich in diesem Sinne nicht »bestreiten«?) Eigenwert zu erkennen,
begeht Hölderlin eine Inkonsequenz nach der anderen (35). Im sogenannten Ich-
roman verliert Hölderlin, im Streben nach dem »Gefühl der Überlegenheit«, alle
Distanz. Die Linie fehlt, die Reflexion ertötet das Leben. Der Wert der Grolman-
schen Untersuchung beruht darin, daß sie diese Stilverirrungen an einem ganz be-
stimmten Kunstmittel nachweist und zwar an einem für Hölderlin entscheidenden:
der landschaftlichen »Bildgebung«. (Die Definition der Bildgebung, die der Ver-
fasser S. 11 gibt, scheint mir nicht glücklich. Wie ich den Beispielen entnehme, ver-
steht er unter Bildgebung eine im Zusammenhang dichterisch bedeutsame, gleich-
sam geistig ausstrahlende Landschaftsdarstellung.) Es ist völlig berechtigt, gerade
dieses Stilmotiv in den Mittelpunkt einer Hölderlinuntersuchung zu rücken. Nicht
mit Unrecht sagt der Verfasser, daß das landschaftliche Bildmotiv für Hölderlin das
Gegenmittel gegen seine hauptsächlichste Gefahr, sich in der Überfülle der Re-
flexionen zu verlieren, darstelle (46).
Dem Motiv der Bildgebung entgegengesetzt, Anzeichen nicht der bauenden,
sondern der auflösenden Kräfte, ist das Stilelement des Deskriptiven. Dies tritt in
der Endfassung des Hyperions hervor. Die Anschauungsfähigkeit hat sich gesteigert,
die Linien sind größer, aber die Einheitlichkeit des landschaftlichen Wertes hat ge-
litten (54). Diese Behauptungen zu belegen ist hier nicht möglich. Mir scheint
Grolman im ganzen richtig gesehen zu haben. Seine beste Arbeit steckt in den
»Tabellen«, denen er Leben einzuhauchen leider nicht verstanden hat. Einzelne
Beispiele, schlagend einander gegenübergestellt, hätten uns von Hölderlins Ringen
und Künstlertum mehr vermittelt als diese überaus fleißigen Zusammenstellungen.
Es ist naiv, wenn der Verfasser sagt: man vergleiche diese und jene Szene (S. 54).
Vergleichen ist seine Sache, nicht die des Lesers. Ein Gegenwartsmensch hat nicht
Zeit, tagelang Stellen aufzusuchen. Diese Ungeschicklichkeit ist bedauerlich, weil
sie uns bei der großen Innigkeit, mit der der Verfasser seinen Stoff umfaßt, zweifel-
los um schöne Ergebnisse bringt.
Außer der »Bildgebung« behandelt Grolman noch das Problem der Distanz,
das in der Briefform so schön zum Ausdruck kommt. Diese Form hat Grolman
mit großer Zartheit nachgefühlt und bis in ihre feinsten Wirkungen verfolgt. Er
der sachlichen Behandlung des Themas verbindet sich ein erstaunlicher Mangel an
darstellerischem Vermögen. Auch Grolmans Interesse haftet am objektiven Werk.
Zwischen den Extremen der dithyrambisch-subjektiven und der rational-objektivieren-
den (»philosophischen«) Behandlungsart sucht er einen Weg zum Werk. Dazu
wäre es nicht nötig gewesen einen ganzen Zettelkasten auszuschütten. Bei Dich-
tern, deren Werk unübersehbar groß oder schwer zugänglich ist, mag ein reich-
liches Anführen von Belegen willkommen sein; bei so leicht überblickbaren Er-
scheinungen wie Hölderlin ist es Pedanterie. Wer seinen Hölderlin kennt, braucht
nicht nachzuschlagen, ob die wesentlichen Aufstellungen richtig sind, und wer ihn
nicht kennt, wird ihn durch die zahllosen Verweise auf Seite so und soviel auch
nicht kennen lernen.
Mit seltener Einführungsfähigkeit hat sich der Verfasser in die Arbeitsweise des
Hyperiondichters eingelebt. Er steht seinem Gegenstand innerlich so nahe wie
Brecht dem seinen und das zeichnet sein Buch in der ganzen Hölderlinliteratur
aus. Gewisse Peinlichkeiten in dem sonst so kostbaren Hyperionmaterial scheinen
mir durch Grolman völlig erklärt. Die Arbeitsweise Hölderlins am Hyperion ent-
stamme nicht der Überfülle an Gestaltungskraft, sondern einem aus dem Verlieren
der Distanz zu begründenden Tasten und Suchen nach Leichtigkeit und Mannig-
faltigkeit. Statt die Harmonie seiner Seele als (»vielleicht bestreitbaren« sagt v. Grol-
man; was läßt sich in diesem Sinne nicht »bestreiten«?) Eigenwert zu erkennen,
begeht Hölderlin eine Inkonsequenz nach der anderen (35). Im sogenannten Ich-
roman verliert Hölderlin, im Streben nach dem »Gefühl der Überlegenheit«, alle
Distanz. Die Linie fehlt, die Reflexion ertötet das Leben. Der Wert der Grolman-
schen Untersuchung beruht darin, daß sie diese Stilverirrungen an einem ganz be-
stimmten Kunstmittel nachweist und zwar an einem für Hölderlin entscheidenden:
der landschaftlichen »Bildgebung«. (Die Definition der Bildgebung, die der Ver-
fasser S. 11 gibt, scheint mir nicht glücklich. Wie ich den Beispielen entnehme, ver-
steht er unter Bildgebung eine im Zusammenhang dichterisch bedeutsame, gleich-
sam geistig ausstrahlende Landschaftsdarstellung.) Es ist völlig berechtigt, gerade
dieses Stilmotiv in den Mittelpunkt einer Hölderlinuntersuchung zu rücken. Nicht
mit Unrecht sagt der Verfasser, daß das landschaftliche Bildmotiv für Hölderlin das
Gegenmittel gegen seine hauptsächlichste Gefahr, sich in der Überfülle der Re-
flexionen zu verlieren, darstelle (46).
Dem Motiv der Bildgebung entgegengesetzt, Anzeichen nicht der bauenden,
sondern der auflösenden Kräfte, ist das Stilelement des Deskriptiven. Dies tritt in
der Endfassung des Hyperions hervor. Die Anschauungsfähigkeit hat sich gesteigert,
die Linien sind größer, aber die Einheitlichkeit des landschaftlichen Wertes hat ge-
litten (54). Diese Behauptungen zu belegen ist hier nicht möglich. Mir scheint
Grolman im ganzen richtig gesehen zu haben. Seine beste Arbeit steckt in den
»Tabellen«, denen er Leben einzuhauchen leider nicht verstanden hat. Einzelne
Beispiele, schlagend einander gegenübergestellt, hätten uns von Hölderlins Ringen
und Künstlertum mehr vermittelt als diese überaus fleißigen Zusammenstellungen.
Es ist naiv, wenn der Verfasser sagt: man vergleiche diese und jene Szene (S. 54).
Vergleichen ist seine Sache, nicht die des Lesers. Ein Gegenwartsmensch hat nicht
Zeit, tagelang Stellen aufzusuchen. Diese Ungeschicklichkeit ist bedauerlich, weil
sie uns bei der großen Innigkeit, mit der der Verfasser seinen Stoff umfaßt, zweifel-
los um schöne Ergebnisse bringt.
Außer der »Bildgebung« behandelt Grolman noch das Problem der Distanz,
das in der Briefform so schön zum Ausdruck kommt. Diese Form hat Grolman
mit großer Zartheit nachgefühlt und bis in ihre feinsten Wirkungen verfolgt. Er