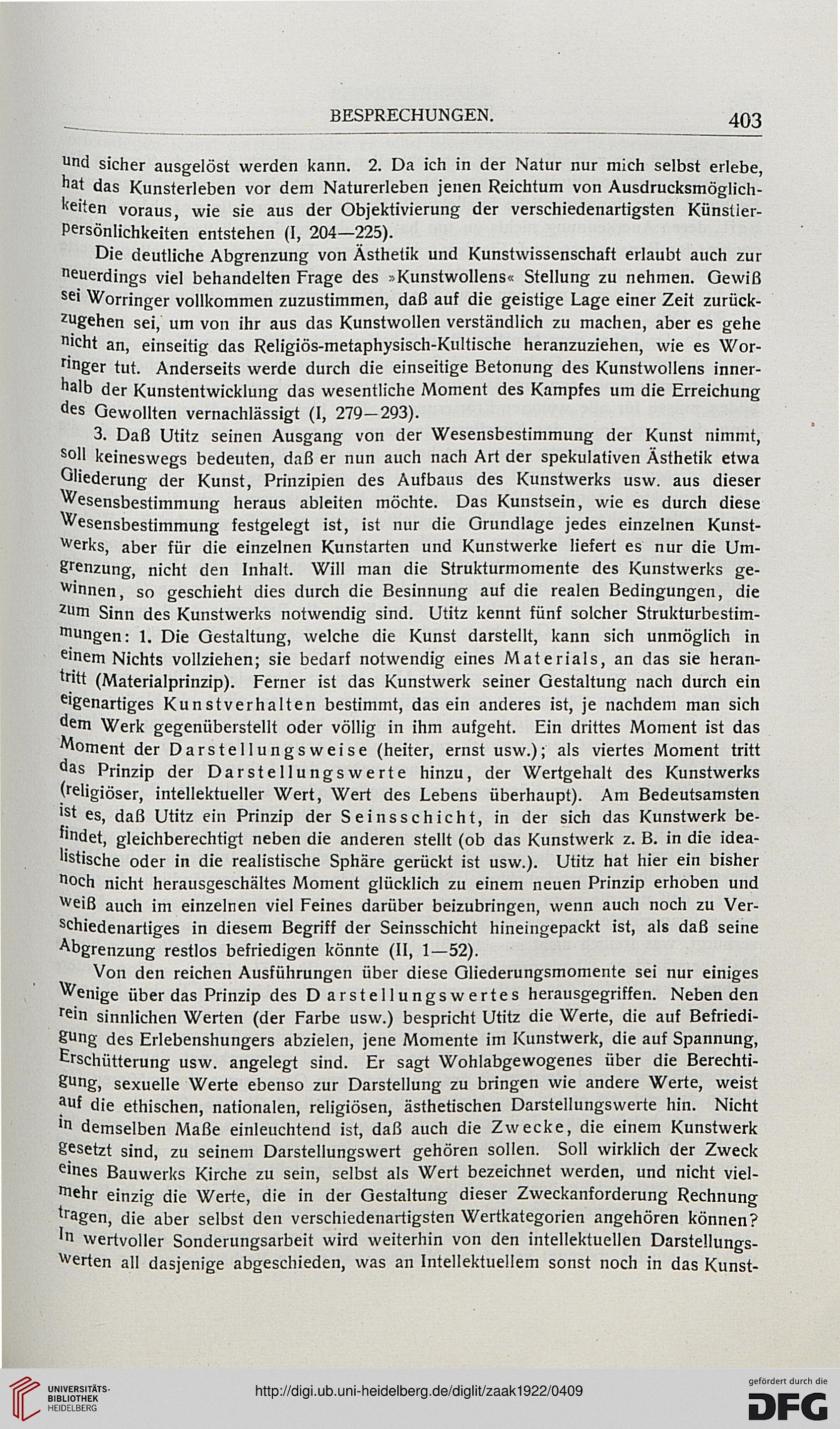und sicher ausgelöst werden kann. 2. Da ich in der Natur nur mich selbst erlebe,
hat das Kunsterleben vor dem Naturerleben jenen Reichtum von Ausdrucksmöglich-
keiten voraus, wie sie aus der Objektivierung der verschiedenartigsten Künstler-
Persönlichkeiten entstehen (I, 204—225).
Die deutliche Abgrenzung von Ästhetik und Kunstwissenschaft erlaubt auch zur
neuerdings viel behandelten Frage des :>Kunstwollens« Stellung zu nehmen. Gewiß
sei Worringer vollkommen zuzustimmen, daß auf die geistige Lage einer Zeit zurück-
gehen sei, um von ihr aus das Kunstwollen verständlich zu machen, aber es gehe
nicht an, einseitig das Religiös-metaphysisch-KuItische heranzuziehen, wie es Wor-
r'nger tut. Anderseits werde durch die einseitige Betonung des Kunstwollens inner-
halb der Kunstentwicklung das wesentliche Moment des Kampfes um die Erreichung
des Gewollten vernachlässigt (I, 279-293).
3. Daß Utitz seinen Ausgang von der Wesensbestimmung der Kunst nimmt,
S°H keineswegs bedeuten, daß er nun auch nach Art der spekulativen Ästhetik etwa
Gliederung der Kunst, Prinzipien des Aufbaus des Kunstwerks usw. aus dieser
Wesensbestimmung heraus ableiten möchte. Das Kunstsein, wie es durch diese
Wesensbestimmung festgelegt ist, ist nur die Grundlage jedes einzelnen Kunst-
werks, aber für die einzelnen Kunstarten und Kunstwerke liefert es nur die Um-
grenzung, nicht den Inhalt. Will man die Strukturmomente des Kunstwerks ge-
winnen, so geschieht dies durch die Besinnung auf die realen Bedingungen, die
*um Sinn des Kunstwerks notwendig sind. Utitz kennt fünf solcher Strukturbestim-
mungen : 1. Die Gestaltung, welche die Kunst darstellt, kann sich unmöglich in
einem Nichts vollziehen; sie bedarf notwendig eines Materials, an das sie heran-
tritt (Materialprinzip). Ferner ist das Kunstwerk seiner Gestaltung nach durch ein
e'genartiges Kunstverhalten bestimmt, das ein anderes ist, je nachdem man sich
dem Werk gegenüberstellt oder völlig in ihm aufgeht. Ein drittes Moment ist das
Moment der Darstellungsweise (heiter, ernst usw.); als viertes Moment tritt
das Prinzip der Darstellungswerte hinzu, der Wertgehalt des Kunstwerks
(religiöser, intellektueller Wert, Wert des Lebens überhaupt). Am Bedeutsamsten
'S' es, daß Utitz ein Prinzip der Seinsschicht, in der sich das Kunstwerk be-
findet, gleichberechtigt neben die anderen stellt (ob das Kunstwerk z. B. in die idea-
listische oder in die realistische Sphäre gerückt ist usw.). Utitz hat hier ein bisher
noch nicht herausgeschältes Moment glücklich zu einem neuen Prinzip erhoben und
weiß auch im einzelnen viel Feines darüber beizubringen, wenn auch noch zu Ver-
schiedenartiges in diesem Begriff der Seinsschicht hineingepackt ist, als daß seine
Abgrenzung restlos befriedigen könnte (II, 1—52).
Von den reichen Ausführungen über diese Gliederungsmomente sei nur einiges
wenige über das Prinzip des Darstellungswertes herausgegriffen. Nebenden
rein sinnlichen Werten (der Farbe usw.) bespricht Utitz die Werte, die auf Befriedi-
gung des Erlebenshungers abzielen, jene Momente im Kunstwerk, die auf Spannung,
Erschütterung usw. angelegt sind. Er sagt Wohlabgewogenes über die Berechti-
gung, sexuelle Werte ebenso zur Darstellung zu bringen wie andere Werte, weist
fuf die ethischen, nationalen, religiösen, ästhetischen Darstellungswerte hin. Nicht
ln demselben Maße einleuchtend ist, daß auch die Zwecke, die einem Kunstwerk
gesetzt sind, zu seinem Darstellungswert gehören sollen. Soll wirklich der Zweck
eines Bauwerks Kirche zu sein, selbst als Wert bezeichnet werden, und nicht viel-
mehr einzig die Werte, die in der Gestaltung dieser Zweckanforderung Rechnung
tragen, die aber selbst den verschiedenartigsten Wertkategorien angehören können?
ln wertvoller Sonderungsarbeit wird weiterhin von den intellektuellen Darstellungs-
Werten all dasjenige abgeschieden, was an Intellektuellem sonst noch in das Kunst-
hat das Kunsterleben vor dem Naturerleben jenen Reichtum von Ausdrucksmöglich-
keiten voraus, wie sie aus der Objektivierung der verschiedenartigsten Künstler-
Persönlichkeiten entstehen (I, 204—225).
Die deutliche Abgrenzung von Ästhetik und Kunstwissenschaft erlaubt auch zur
neuerdings viel behandelten Frage des :>Kunstwollens« Stellung zu nehmen. Gewiß
sei Worringer vollkommen zuzustimmen, daß auf die geistige Lage einer Zeit zurück-
gehen sei, um von ihr aus das Kunstwollen verständlich zu machen, aber es gehe
nicht an, einseitig das Religiös-metaphysisch-KuItische heranzuziehen, wie es Wor-
r'nger tut. Anderseits werde durch die einseitige Betonung des Kunstwollens inner-
halb der Kunstentwicklung das wesentliche Moment des Kampfes um die Erreichung
des Gewollten vernachlässigt (I, 279-293).
3. Daß Utitz seinen Ausgang von der Wesensbestimmung der Kunst nimmt,
S°H keineswegs bedeuten, daß er nun auch nach Art der spekulativen Ästhetik etwa
Gliederung der Kunst, Prinzipien des Aufbaus des Kunstwerks usw. aus dieser
Wesensbestimmung heraus ableiten möchte. Das Kunstsein, wie es durch diese
Wesensbestimmung festgelegt ist, ist nur die Grundlage jedes einzelnen Kunst-
werks, aber für die einzelnen Kunstarten und Kunstwerke liefert es nur die Um-
grenzung, nicht den Inhalt. Will man die Strukturmomente des Kunstwerks ge-
winnen, so geschieht dies durch die Besinnung auf die realen Bedingungen, die
*um Sinn des Kunstwerks notwendig sind. Utitz kennt fünf solcher Strukturbestim-
mungen : 1. Die Gestaltung, welche die Kunst darstellt, kann sich unmöglich in
einem Nichts vollziehen; sie bedarf notwendig eines Materials, an das sie heran-
tritt (Materialprinzip). Ferner ist das Kunstwerk seiner Gestaltung nach durch ein
e'genartiges Kunstverhalten bestimmt, das ein anderes ist, je nachdem man sich
dem Werk gegenüberstellt oder völlig in ihm aufgeht. Ein drittes Moment ist das
Moment der Darstellungsweise (heiter, ernst usw.); als viertes Moment tritt
das Prinzip der Darstellungswerte hinzu, der Wertgehalt des Kunstwerks
(religiöser, intellektueller Wert, Wert des Lebens überhaupt). Am Bedeutsamsten
'S' es, daß Utitz ein Prinzip der Seinsschicht, in der sich das Kunstwerk be-
findet, gleichberechtigt neben die anderen stellt (ob das Kunstwerk z. B. in die idea-
listische oder in die realistische Sphäre gerückt ist usw.). Utitz hat hier ein bisher
noch nicht herausgeschältes Moment glücklich zu einem neuen Prinzip erhoben und
weiß auch im einzelnen viel Feines darüber beizubringen, wenn auch noch zu Ver-
schiedenartiges in diesem Begriff der Seinsschicht hineingepackt ist, als daß seine
Abgrenzung restlos befriedigen könnte (II, 1—52).
Von den reichen Ausführungen über diese Gliederungsmomente sei nur einiges
wenige über das Prinzip des Darstellungswertes herausgegriffen. Nebenden
rein sinnlichen Werten (der Farbe usw.) bespricht Utitz die Werte, die auf Befriedi-
gung des Erlebenshungers abzielen, jene Momente im Kunstwerk, die auf Spannung,
Erschütterung usw. angelegt sind. Er sagt Wohlabgewogenes über die Berechti-
gung, sexuelle Werte ebenso zur Darstellung zu bringen wie andere Werte, weist
fuf die ethischen, nationalen, religiösen, ästhetischen Darstellungswerte hin. Nicht
ln demselben Maße einleuchtend ist, daß auch die Zwecke, die einem Kunstwerk
gesetzt sind, zu seinem Darstellungswert gehören sollen. Soll wirklich der Zweck
eines Bauwerks Kirche zu sein, selbst als Wert bezeichnet werden, und nicht viel-
mehr einzig die Werte, die in der Gestaltung dieser Zweckanforderung Rechnung
tragen, die aber selbst den verschiedenartigsten Wertkategorien angehören können?
ln wertvoller Sonderungsarbeit wird weiterhin von den intellektuellen Darstellungs-
Werten all dasjenige abgeschieden, was an Intellektuellem sonst noch in das Kunst-