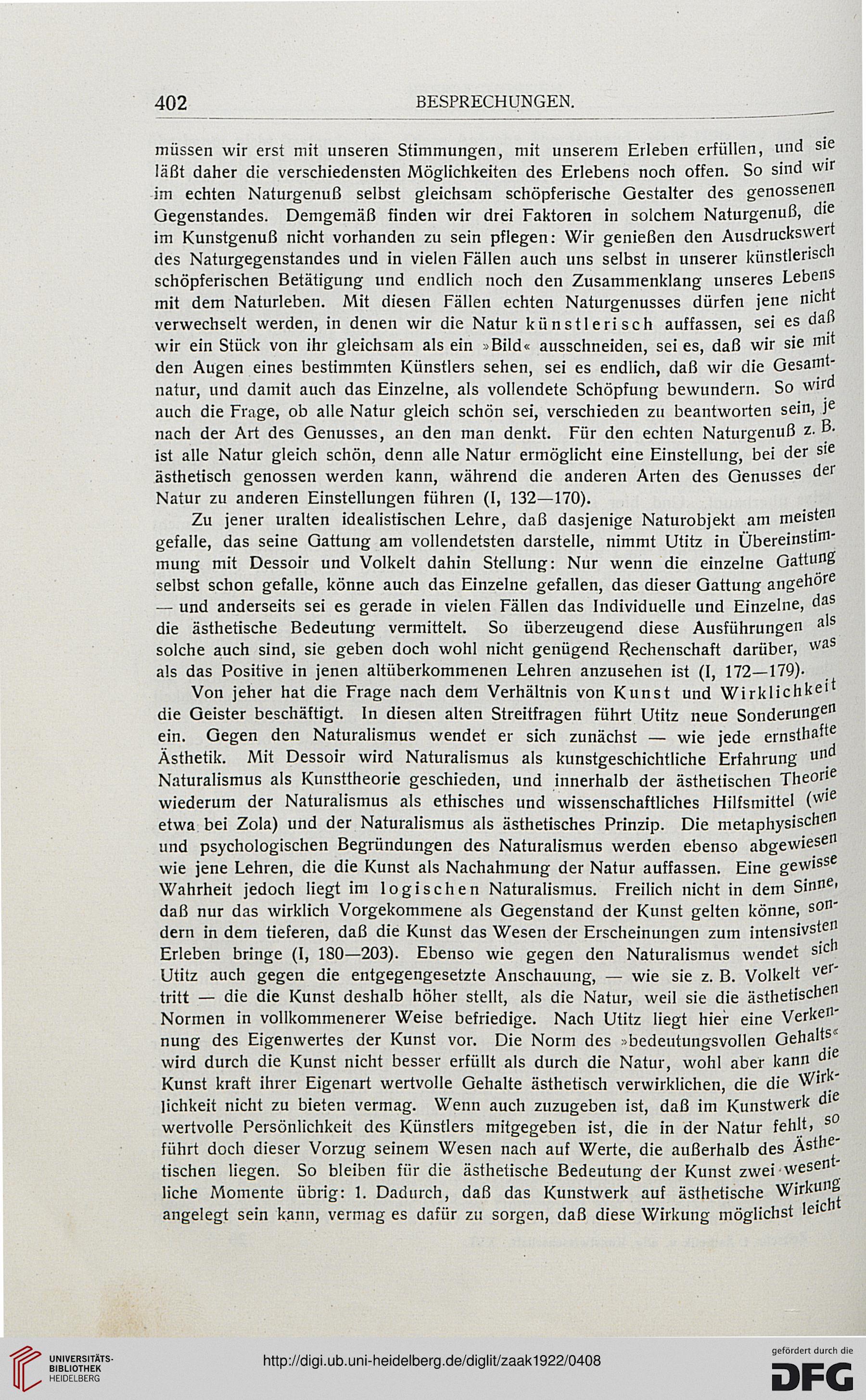402 BESPRECHUNGEN.
müssen wir erst mit unseren Stimmungen, mit unserem Erleben erfüllen, und sie
läßt daher die verschiedensten Möglichkeiten des Erlebens noch offen. So sind wir
im echten Naturgenuß selbst gleichsam schöpferische Gestalter des genossenen
Gegenstandes. Demgemäß finden wir drei Faktoren in solchem Naturgenuß, die
im Kunstgenuß nicht vorhanden zu sein pflegen: Wir genießen den Ausdruckswer
des Naturgegenstandes und in vielen Fällen auch uns selbst in unserer künstlerisch
schöpferischen Betätigung und endlich noch den Zusammenklang unseres Lebens
mit dem Naturleben. Mit diesen Fällen echten Naturgenusses dürfen jene nicht
verwechselt werden, in denen wir die Natur künstlerisch auffassen, sei es daß
wir ein Stück von ihr gleichsam als ein »Bild« ausschneiden, sei es, daß wir sie mit
den Augen eines bestimmten Künstlers sehen, sei es endlich, daß wir die Gesanrt-
natur, und damit auch das Einzelne, als vollendete Schöpfung bewundern. So wird
auch die Frage, ob alle Natur gleich schön sei, verschieden zu beantworten sein, Je
nach der Art des Genusses, an den man denkt. Für den echten Naturgenuß z- "■
ist alle Natur gleich schön, denn alle Natur ermöglicht eine Einstellung, bei der sie
ästhetisch genossen werden kann, während die anderen Arten des Genusses der
Natur zu anderen Einstellungen führen (1, 132—170).
Zu jener uralten idealistischen Lehre, daß dasjenige Naturobjekt am meisten
gefalle, das seine Gattung am vollendetsten darstelle, nimmt Utitz in Übereinstini-
mung mit Dessoir und Volkelt dahin Stellung: Nur wenn die einzelne Gattung
selbst schon gefalle, könne auch das Einzelne gefallen, das dieser Gattung angehor
— und anderseits sei es gerade in vielen Fällen das Individuelle und Einzelne, das
die ästhetische Bedeutung vermittelt. So überzeugend diese Ausführungen al
solche auch sind, sie geben doch wohl nicht genügend Rechenschaft darüber, was
als das Positive in jenen altüberkommenen Lehren anzusehen ist (I, 172—179)-
Von jeher hat die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit
die Geister beschäftigt. In diesen alten Streitfragen führt Utitz neue Sonderungerl
ein. Gegen den Naturalismus wendet er sich zunächst — wie jede ernsthaft
Ästhetik. Mit Dessoir wird Naturalismus als kunstgeschichtliche Erfahrung un_
Naturalismus als Kunsttheorie geschieden, und innerhalb der ästhetischen Theorie
wiederum der Naturalismus als ethisches und wissenschaftliches Hilfsmittel (wie
etwa bei Zola) und der Naturalismus als ästhetisches Prinzip. Die metaphysischen
und psychologischen Begründungen des Naturalismus werden ebenso abgewiesen
wie jene Lehren, die die Kunst als Nachahmung der Natur auffassen. Eine gewiss
Wahrheit jedoch liegt im logischen Naturalismus. Freilich nicht in dem Sinne,
daß nur das wirklich Vorgekommene als Gegenstand der Kunst gelten könne, son-
dern in dem tieferen, daß die Kunst das Wesen der Erscheinungen zum intensivsten
Erleben bringe (I, 180—203). Ebenso wie gegen den Naturalismus wendet sie
Utitz auch gegen die entgegengesetzte Anschauung, — wie sie z. B. Volkelt ver-
tritt — die die Kunst deshalb höher stellt, als die Natur, weil sie die ästhetischen
Normen in vollkommenerer Weise befriedige. Nach Utitz liegt hier eine Verke"'
nung des Eigenwertes der Kunst vor. Die Norm des »bedeutungsvollen Gehalts*
wird durch die Kunst nicht besser erfüllt als durch die Natur, wohl aber kann °
Kunst kraft ihrer Eigenart wertvolle Gehalte ästhetisch verwirklichen, die die \V"y
lichkeit nicht zu bieten vermag. Wenn auch zuzugeben ist, daß im Kunstwerk oi
wertvolle Persönlichkeit des Künstlers mitgegeben ist, die in der Natur fehlt, s
führt doch dieser Vorzug seinem Wesen nach auf Werte, die außerhalb des Astne'
tischen liegen. So bleiben für die ästhetische Bedeutung der Kunst zwei wesen
liehe Momente übrig: 1. Dadurch, daß das Kunstwerk auf ästhetische Wirl<ul &
angelegt sein kann, vermag es dafür zu sorgen, daß diese Wirkung möglichst le>
müssen wir erst mit unseren Stimmungen, mit unserem Erleben erfüllen, und sie
läßt daher die verschiedensten Möglichkeiten des Erlebens noch offen. So sind wir
im echten Naturgenuß selbst gleichsam schöpferische Gestalter des genossenen
Gegenstandes. Demgemäß finden wir drei Faktoren in solchem Naturgenuß, die
im Kunstgenuß nicht vorhanden zu sein pflegen: Wir genießen den Ausdruckswer
des Naturgegenstandes und in vielen Fällen auch uns selbst in unserer künstlerisch
schöpferischen Betätigung und endlich noch den Zusammenklang unseres Lebens
mit dem Naturleben. Mit diesen Fällen echten Naturgenusses dürfen jene nicht
verwechselt werden, in denen wir die Natur künstlerisch auffassen, sei es daß
wir ein Stück von ihr gleichsam als ein »Bild« ausschneiden, sei es, daß wir sie mit
den Augen eines bestimmten Künstlers sehen, sei es endlich, daß wir die Gesanrt-
natur, und damit auch das Einzelne, als vollendete Schöpfung bewundern. So wird
auch die Frage, ob alle Natur gleich schön sei, verschieden zu beantworten sein, Je
nach der Art des Genusses, an den man denkt. Für den echten Naturgenuß z- "■
ist alle Natur gleich schön, denn alle Natur ermöglicht eine Einstellung, bei der sie
ästhetisch genossen werden kann, während die anderen Arten des Genusses der
Natur zu anderen Einstellungen führen (1, 132—170).
Zu jener uralten idealistischen Lehre, daß dasjenige Naturobjekt am meisten
gefalle, das seine Gattung am vollendetsten darstelle, nimmt Utitz in Übereinstini-
mung mit Dessoir und Volkelt dahin Stellung: Nur wenn die einzelne Gattung
selbst schon gefalle, könne auch das Einzelne gefallen, das dieser Gattung angehor
— und anderseits sei es gerade in vielen Fällen das Individuelle und Einzelne, das
die ästhetische Bedeutung vermittelt. So überzeugend diese Ausführungen al
solche auch sind, sie geben doch wohl nicht genügend Rechenschaft darüber, was
als das Positive in jenen altüberkommenen Lehren anzusehen ist (I, 172—179)-
Von jeher hat die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit
die Geister beschäftigt. In diesen alten Streitfragen führt Utitz neue Sonderungerl
ein. Gegen den Naturalismus wendet er sich zunächst — wie jede ernsthaft
Ästhetik. Mit Dessoir wird Naturalismus als kunstgeschichtliche Erfahrung un_
Naturalismus als Kunsttheorie geschieden, und innerhalb der ästhetischen Theorie
wiederum der Naturalismus als ethisches und wissenschaftliches Hilfsmittel (wie
etwa bei Zola) und der Naturalismus als ästhetisches Prinzip. Die metaphysischen
und psychologischen Begründungen des Naturalismus werden ebenso abgewiesen
wie jene Lehren, die die Kunst als Nachahmung der Natur auffassen. Eine gewiss
Wahrheit jedoch liegt im logischen Naturalismus. Freilich nicht in dem Sinne,
daß nur das wirklich Vorgekommene als Gegenstand der Kunst gelten könne, son-
dern in dem tieferen, daß die Kunst das Wesen der Erscheinungen zum intensivsten
Erleben bringe (I, 180—203). Ebenso wie gegen den Naturalismus wendet sie
Utitz auch gegen die entgegengesetzte Anschauung, — wie sie z. B. Volkelt ver-
tritt — die die Kunst deshalb höher stellt, als die Natur, weil sie die ästhetischen
Normen in vollkommenerer Weise befriedige. Nach Utitz liegt hier eine Verke"'
nung des Eigenwertes der Kunst vor. Die Norm des »bedeutungsvollen Gehalts*
wird durch die Kunst nicht besser erfüllt als durch die Natur, wohl aber kann °
Kunst kraft ihrer Eigenart wertvolle Gehalte ästhetisch verwirklichen, die die \V"y
lichkeit nicht zu bieten vermag. Wenn auch zuzugeben ist, daß im Kunstwerk oi
wertvolle Persönlichkeit des Künstlers mitgegeben ist, die in der Natur fehlt, s
führt doch dieser Vorzug seinem Wesen nach auf Werte, die außerhalb des Astne'
tischen liegen. So bleiben für die ästhetische Bedeutung der Kunst zwei wesen
liehe Momente übrig: 1. Dadurch, daß das Kunstwerk auf ästhetische Wirl<ul &
angelegt sein kann, vermag es dafür zu sorgen, daß diese Wirkung möglichst le>