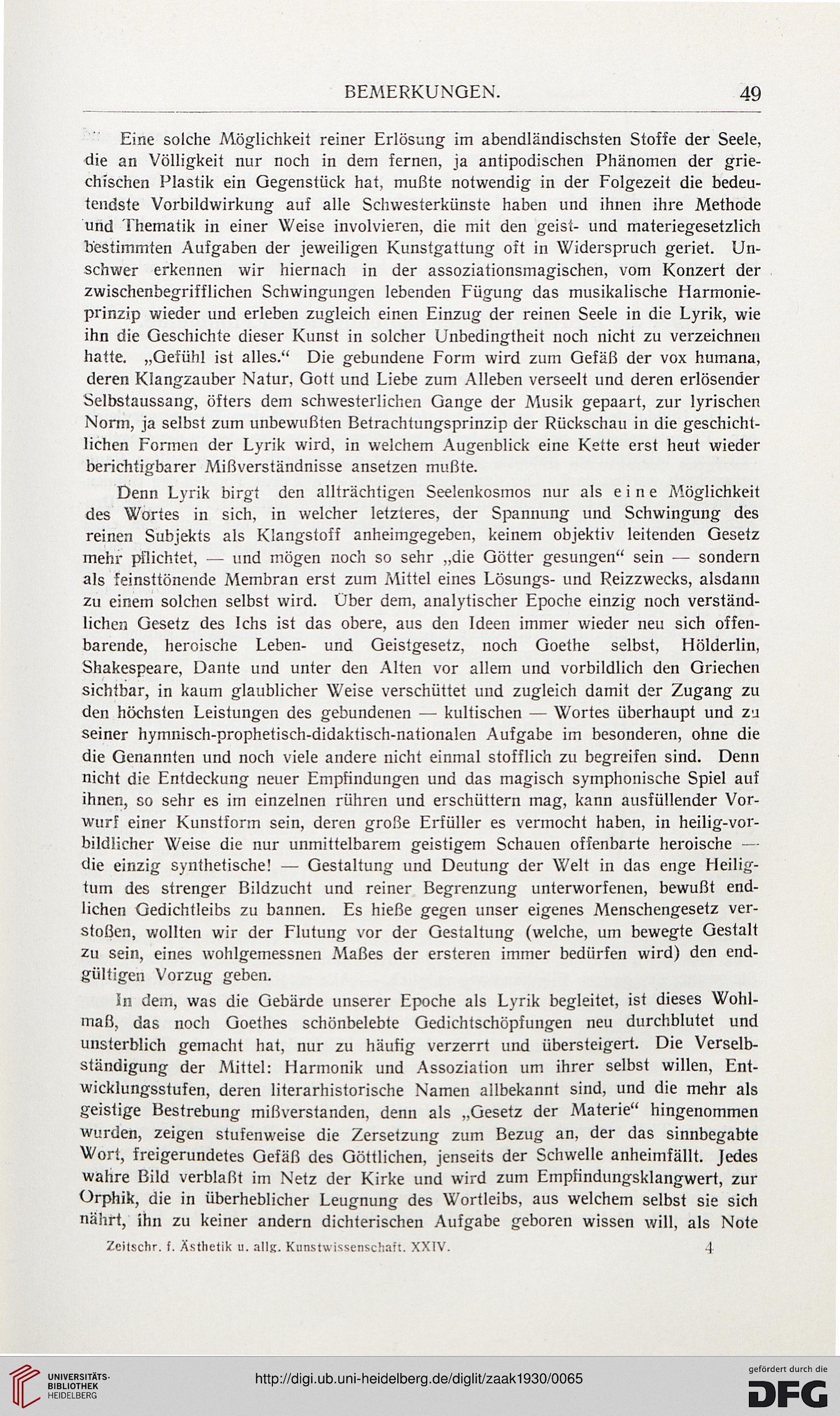BEMERKUNGEN.
49
Eine solche Möglichkeit reiner Erlösung im abendländischsten Stoffe der Seele,
•die an Völligkeit nur noch in dem fernen, ja antipodischen Phänomen der grie-
chischen Plastik ein Gegenstück hat, mußte notwendig in der Folgezeit die bedeu-
tendste Vorbildwirkung auf alle Schwesterkünste haben und ihnen ihre Methode
und Thematik in einer Weise involvieren, die mit den geist- und materiegesetzlich
bestimmten Aufgaben der jeweiligen Kunstgattung oft in Widerspruch geriet. Un-
schwer erkennen wir hiernach in der assoziationsmagischen, vom Konzert der
zwischenbegrifflichen Schwingungen lebenden Fügung das musikalische Harmonie-
prinzip wieder und erleben zugleich einen Einzug der reinen Seele in die Lyrik, wie
ihn die Geschichte dieser Kunst in solcher Unbedingtheit noch nicht zu verzeichnen
hatte. „Gefühl ist alles." Die gebundene Form wird zum Gefäß der vox humana,
deren Klangzauber Natur, Gott und Liebe zum Alleben verseelt und deren erlösender
Selbstaussang, öfters dem schwesterlichen Gange der Musik gepaart, zur lyrischen
Norm, ja selbst zum unbewußten Betrachtungsprinzip der Rückschau in die geschicht-
lichen Formen der Lyrik wird, in welchem Augenblick eine Kette erst heut wieder
berichtigbarer Mißverständnisse ansetzen mußte.
Denn Lyrik birgt den allträchtigen Seelenkosmos nur als eine Möglichkeit
des Wortes in sich, in welcher letzteres, der Spannung und Schwingung des
reinen Subjekts als Klangstoff anheimgegeben, keinem objektiv leitenden Gesetz
mehr pflichtet, — und mögen noch so sehr „die Götter gesungen" sein — sondern
als feinsttönende Membran erst zum Mittel eines Lösungs- und Reizzwecks, alsdann
zu einem solchen selbst wird. Über dem, analytischer Epoche einzig noch verständ-
lichen Gesetz des Ichs ist das obere, aus den Ideen immer wieder neu sich offen-
barende, heroische Leben- und Geistgesetz, noch Goethe selbst, Hölderlin,
Shakespeare, Dante und unter den Alten vor allem und vorbildlich den Griechen
sichtbar, in kaum glaublicher Weise verschüttet und zugleich damit der Zugang zu
den höchsten Leistungen des gebundenen — kultischen — Wortes überhaupt und zu
seiner hymnisch-prophetisch-didaktisch-nationalen Aufgabe im besonderen, ohne die
die Genannten und noch viele andere nicht einmal stofflich zu begreifen sind. Denn
nicht die Entdeckung neuer Empfindungen und das magisch symphonische Spiel auf
ihnen, so sehr es im einzelnen rühren und erschüttern mag, kann ausfüllender Vor-
wurf einer Kunstform sein, deren große Erfüller es vermocht haben, in heilig-vor-
bildlicher Weise die nur unmittelbarem geistigem Schauen offenbarte heroische —
die einzig synthetische! — Gestaltung und Deutung der Welt in das enge Heilig-
tum des strenger Bildzucht und reiner Begrenzung unterworfenen, bewußt end-
lichen Gedichtleibs zu bannen. Es hieße gegen unser eigenes Menschengesetz ver-
stoßen, wollten wir der Flutung vor der Gestaltung (welche, um bewegte Gestalt
zu sein, eines wohlgemessnen Maßes der ersteren immer bedürfen wird) den end-
gültigen Vorzug geben.
Jn dem, was die Gebärde unserer Epoche als Lyrik begleitet, ist dieses Wohl-
maß, das noch Goethes schönbelebte Gedichtschöpfungen neu durchblutet und
unsterblich gemacht hat, nur zu häufig verzerrt und übersteigert. Die Verselb-
ständigung der Mittel: Harmonik und Assoziation um ihrer selbst willen, Ent-
wicklungsstufen, deren literarhistorische Namen allbekannt sind, und die mehr als
geistige Bestrebung mißverstanden, denn als „Gesetz der Materie" hingenommen
wurden, zeigen stufenweise die Zersetzung zum Bezug an, der das sinnbegabte
Wort, freigerundetes Gefäß des Göttlichen, jenseits der Schwelle anheimfällt. Jedes
wahre Bild verblaßt im Netz der Kirke und wird zum Emphndungsklangwert, zur
ürphik, die in überheblicher Leugnung des Wortleibs, aus welchem selbst sie sich
nährt, ihn zu keiner andern dichterischen Aufgabe geboren wissen will, als Note
Zeilschr. f. Ästhetik u. alln. Kunstwissenschaft. XXIV. 4
49
Eine solche Möglichkeit reiner Erlösung im abendländischsten Stoffe der Seele,
•die an Völligkeit nur noch in dem fernen, ja antipodischen Phänomen der grie-
chischen Plastik ein Gegenstück hat, mußte notwendig in der Folgezeit die bedeu-
tendste Vorbildwirkung auf alle Schwesterkünste haben und ihnen ihre Methode
und Thematik in einer Weise involvieren, die mit den geist- und materiegesetzlich
bestimmten Aufgaben der jeweiligen Kunstgattung oft in Widerspruch geriet. Un-
schwer erkennen wir hiernach in der assoziationsmagischen, vom Konzert der
zwischenbegrifflichen Schwingungen lebenden Fügung das musikalische Harmonie-
prinzip wieder und erleben zugleich einen Einzug der reinen Seele in die Lyrik, wie
ihn die Geschichte dieser Kunst in solcher Unbedingtheit noch nicht zu verzeichnen
hatte. „Gefühl ist alles." Die gebundene Form wird zum Gefäß der vox humana,
deren Klangzauber Natur, Gott und Liebe zum Alleben verseelt und deren erlösender
Selbstaussang, öfters dem schwesterlichen Gange der Musik gepaart, zur lyrischen
Norm, ja selbst zum unbewußten Betrachtungsprinzip der Rückschau in die geschicht-
lichen Formen der Lyrik wird, in welchem Augenblick eine Kette erst heut wieder
berichtigbarer Mißverständnisse ansetzen mußte.
Denn Lyrik birgt den allträchtigen Seelenkosmos nur als eine Möglichkeit
des Wortes in sich, in welcher letzteres, der Spannung und Schwingung des
reinen Subjekts als Klangstoff anheimgegeben, keinem objektiv leitenden Gesetz
mehr pflichtet, — und mögen noch so sehr „die Götter gesungen" sein — sondern
als feinsttönende Membran erst zum Mittel eines Lösungs- und Reizzwecks, alsdann
zu einem solchen selbst wird. Über dem, analytischer Epoche einzig noch verständ-
lichen Gesetz des Ichs ist das obere, aus den Ideen immer wieder neu sich offen-
barende, heroische Leben- und Geistgesetz, noch Goethe selbst, Hölderlin,
Shakespeare, Dante und unter den Alten vor allem und vorbildlich den Griechen
sichtbar, in kaum glaublicher Weise verschüttet und zugleich damit der Zugang zu
den höchsten Leistungen des gebundenen — kultischen — Wortes überhaupt und zu
seiner hymnisch-prophetisch-didaktisch-nationalen Aufgabe im besonderen, ohne die
die Genannten und noch viele andere nicht einmal stofflich zu begreifen sind. Denn
nicht die Entdeckung neuer Empfindungen und das magisch symphonische Spiel auf
ihnen, so sehr es im einzelnen rühren und erschüttern mag, kann ausfüllender Vor-
wurf einer Kunstform sein, deren große Erfüller es vermocht haben, in heilig-vor-
bildlicher Weise die nur unmittelbarem geistigem Schauen offenbarte heroische —
die einzig synthetische! — Gestaltung und Deutung der Welt in das enge Heilig-
tum des strenger Bildzucht und reiner Begrenzung unterworfenen, bewußt end-
lichen Gedichtleibs zu bannen. Es hieße gegen unser eigenes Menschengesetz ver-
stoßen, wollten wir der Flutung vor der Gestaltung (welche, um bewegte Gestalt
zu sein, eines wohlgemessnen Maßes der ersteren immer bedürfen wird) den end-
gültigen Vorzug geben.
Jn dem, was die Gebärde unserer Epoche als Lyrik begleitet, ist dieses Wohl-
maß, das noch Goethes schönbelebte Gedichtschöpfungen neu durchblutet und
unsterblich gemacht hat, nur zu häufig verzerrt und übersteigert. Die Verselb-
ständigung der Mittel: Harmonik und Assoziation um ihrer selbst willen, Ent-
wicklungsstufen, deren literarhistorische Namen allbekannt sind, und die mehr als
geistige Bestrebung mißverstanden, denn als „Gesetz der Materie" hingenommen
wurden, zeigen stufenweise die Zersetzung zum Bezug an, der das sinnbegabte
Wort, freigerundetes Gefäß des Göttlichen, jenseits der Schwelle anheimfällt. Jedes
wahre Bild verblaßt im Netz der Kirke und wird zum Emphndungsklangwert, zur
ürphik, die in überheblicher Leugnung des Wortleibs, aus welchem selbst sie sich
nährt, ihn zu keiner andern dichterischen Aufgabe geboren wissen will, als Note
Zeilschr. f. Ästhetik u. alln. Kunstwissenschaft. XXIV. 4