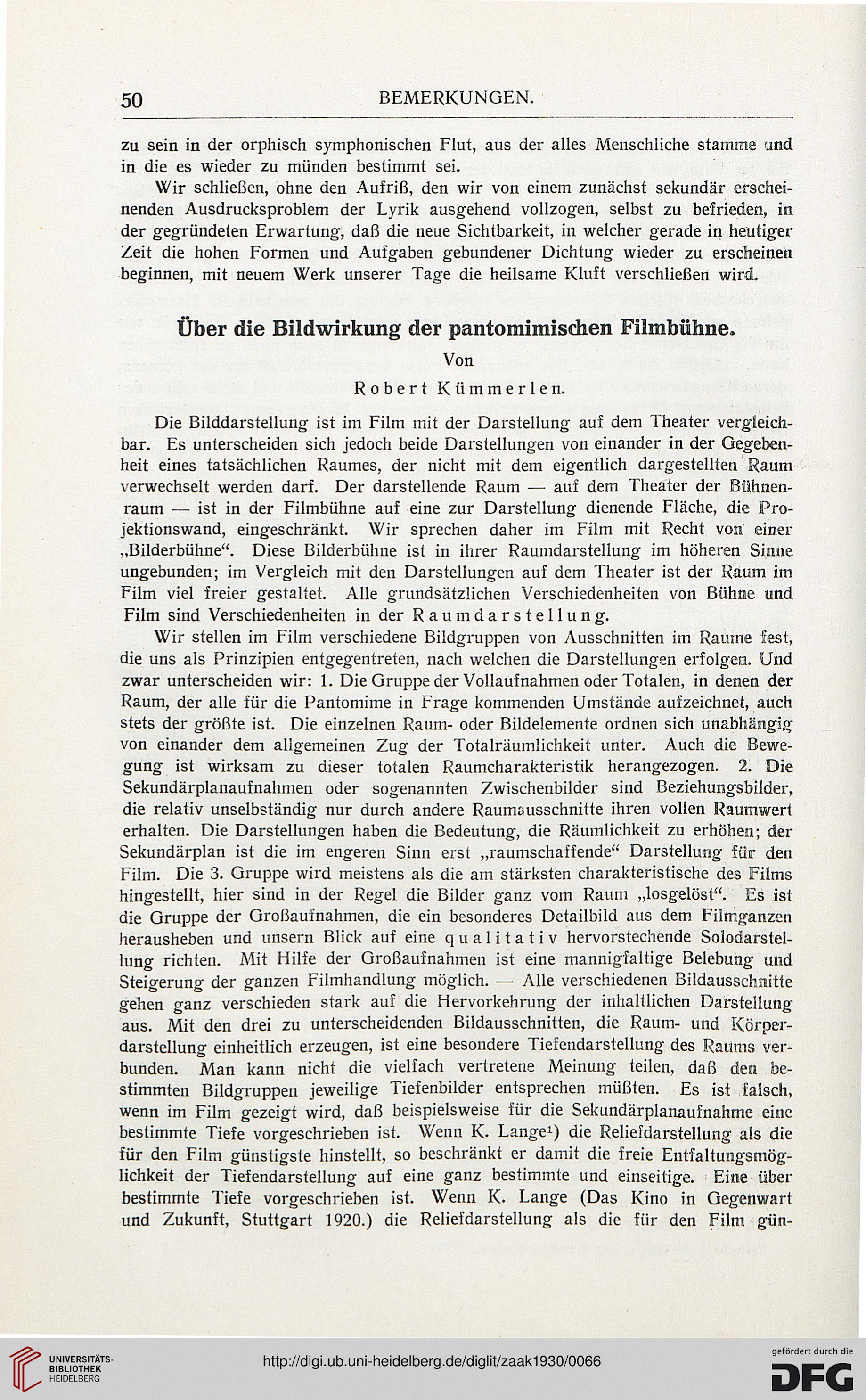50
BEMERKUNGEN.
zu sein in der orphisch symphonischen Flut, aus der alles Menschliche stamme und
in die es wieder zu münden bestimmt sei.
Wir schließen, ohne den Aufriß, den wir von einem zunächst sekundär erschei-
nenden Ausdrucksproblem der Lyrik ausgehend vollzogen, selbst zu befrieden, in
der gegründeten Erwartung, daß die neue Sichtbarkeit, in welcher gerade in heutiger
Zeit die hohen Formen und Aufgaben gebundener Dichtung wieder zu erscheinen
beginnen, mit neuem Werk unserer Tage die heilsame Kluft verschließen wird.
Über die Bildwirkung der pantomimischen Filmbühne.
Von
Robert Kümmerlen.
Die Bilddarstellung ist im Film mit der Darstellung auf dem Theater vergleich-
bar. Es unterscheiden sich jedoch beide Darstellungen von einander in der Gegeben-
heit eines tatsächlichen Raumes, der nicht mit dem eigentlich dargestellten Raum
verwechselt werden darf. Der darstellende Raum — auf dem Theater der Bühnen-
raum — ist in der Filmbühne auf eine zur Darstellung dienende Fläche, die Pro-
jektionswand, eingeschränkt. Wir sprechen daher im Film mit Recht von einer
„Bilderbühne". Diese Bilderbühne ist in ihrer Raumdarstellung im höheren Sinne
ungebunden; im Vergleich mit den Darstellungen auf dem Theater ist der Raum im
Film viel freier gestaltet. Alle grundsätzlichen Verschiedenheiten von Bühne und
Film sind Verschiedenheiten in der Raumdarstellung.
Wir stellen im Film verschiedene Bildgruppen von Ausschnitten im Räume fest,
die uns als Prinzipien entgegentreten, nach welchen die Darstellungen erfolgen. Und
zwar unterscheiden wir: 1. Die Gruppe der Vollaufnahmen oder Totalen, in denen der
Raum, der alle für die Pantomime in Frage kommenden Umstände aufzeichnet, auch
stets der größte ist. Die einzelnen Raum- oder Bildelemente ordnen sich unabhängig
von einander dem allgemeinen Zug der Totalräumlichkeit unter. Auch die Bewe-
gung ist wirksam zu dieser totalen Raumcharakteristik herangezogen. 2. Die
Sekundärplanaufnahmen oder sogenannten Zwischenbilder sind Beziehungsbilder,
die relativ unselbständig nur durch andere Raumsusschnitte ihren vollen Raumwert
erhalten. Die Darstellungen haben die Bedeutung, die Räumlichkeit zu erhöhen; der
Sekundärplan ist die im engeren Sinn erst „raumschaffende" Darstellung für den
Film. Die 3. Gruppe wird meistens als die am stärksten charakteristische des Films
hingestellt, hier sind in der Regel die Bilder ganz vom Raum „losgelöst". Es ist
die Gruppe der Großaufnahmen, die ein besonderes Detailbild aus dem Filmganzen
herausheben und unsern Blick auf eine qualitativ hervorstechende Solodarstel-
lung richten. Mit Hilfe der Großaufnahmen ist eine mannigfaltige Belebung und
Steigerung der ganzen Filmhandlung möglich. — Alle verschiedenen Bildausschnitte
gehen ganz verschieden stark auf die Hervorkehrung der inhaltlichen Darstellung
aus. Mit den drei zu unterscheidenden Bildausschnitten, die Raum- und Körper-
darstellung einheitlich erzeugen, ist eine besondere Tiefendarstellung des Raüms ver-
bunden. Man kann nicht die vielfach vertretene Meinung teilen, daß den be-
stimmten Bildgruppen jeweilige Tiefenbilder entsprechen müßten. Es ist falsch,
wenn im Film gezeigt wird, daß beispielsweise für die Sekundärplanaufnahme eine
bestimmte Tiefe vorgeschrieben ist. Wenn K. Lange1) die Reliefdarstellung als die
für den Film günstigste hinstellt, so beschränkt er damit die freie Entfaltungsmög-
lichkeit der Tiefendarstellung auf eine ganz bestimmte und einseitige. Eine über
bestimmte Tiefe vorgeschrieben ist. Wenn K. Lange (Das Kino in Gegenwart
und Zukunft, Stuttgart 1920.) die Reliefdarstellung als die für den Film gün-
BEMERKUNGEN.
zu sein in der orphisch symphonischen Flut, aus der alles Menschliche stamme und
in die es wieder zu münden bestimmt sei.
Wir schließen, ohne den Aufriß, den wir von einem zunächst sekundär erschei-
nenden Ausdrucksproblem der Lyrik ausgehend vollzogen, selbst zu befrieden, in
der gegründeten Erwartung, daß die neue Sichtbarkeit, in welcher gerade in heutiger
Zeit die hohen Formen und Aufgaben gebundener Dichtung wieder zu erscheinen
beginnen, mit neuem Werk unserer Tage die heilsame Kluft verschließen wird.
Über die Bildwirkung der pantomimischen Filmbühne.
Von
Robert Kümmerlen.
Die Bilddarstellung ist im Film mit der Darstellung auf dem Theater vergleich-
bar. Es unterscheiden sich jedoch beide Darstellungen von einander in der Gegeben-
heit eines tatsächlichen Raumes, der nicht mit dem eigentlich dargestellten Raum
verwechselt werden darf. Der darstellende Raum — auf dem Theater der Bühnen-
raum — ist in der Filmbühne auf eine zur Darstellung dienende Fläche, die Pro-
jektionswand, eingeschränkt. Wir sprechen daher im Film mit Recht von einer
„Bilderbühne". Diese Bilderbühne ist in ihrer Raumdarstellung im höheren Sinne
ungebunden; im Vergleich mit den Darstellungen auf dem Theater ist der Raum im
Film viel freier gestaltet. Alle grundsätzlichen Verschiedenheiten von Bühne und
Film sind Verschiedenheiten in der Raumdarstellung.
Wir stellen im Film verschiedene Bildgruppen von Ausschnitten im Räume fest,
die uns als Prinzipien entgegentreten, nach welchen die Darstellungen erfolgen. Und
zwar unterscheiden wir: 1. Die Gruppe der Vollaufnahmen oder Totalen, in denen der
Raum, der alle für die Pantomime in Frage kommenden Umstände aufzeichnet, auch
stets der größte ist. Die einzelnen Raum- oder Bildelemente ordnen sich unabhängig
von einander dem allgemeinen Zug der Totalräumlichkeit unter. Auch die Bewe-
gung ist wirksam zu dieser totalen Raumcharakteristik herangezogen. 2. Die
Sekundärplanaufnahmen oder sogenannten Zwischenbilder sind Beziehungsbilder,
die relativ unselbständig nur durch andere Raumsusschnitte ihren vollen Raumwert
erhalten. Die Darstellungen haben die Bedeutung, die Räumlichkeit zu erhöhen; der
Sekundärplan ist die im engeren Sinn erst „raumschaffende" Darstellung für den
Film. Die 3. Gruppe wird meistens als die am stärksten charakteristische des Films
hingestellt, hier sind in der Regel die Bilder ganz vom Raum „losgelöst". Es ist
die Gruppe der Großaufnahmen, die ein besonderes Detailbild aus dem Filmganzen
herausheben und unsern Blick auf eine qualitativ hervorstechende Solodarstel-
lung richten. Mit Hilfe der Großaufnahmen ist eine mannigfaltige Belebung und
Steigerung der ganzen Filmhandlung möglich. — Alle verschiedenen Bildausschnitte
gehen ganz verschieden stark auf die Hervorkehrung der inhaltlichen Darstellung
aus. Mit den drei zu unterscheidenden Bildausschnitten, die Raum- und Körper-
darstellung einheitlich erzeugen, ist eine besondere Tiefendarstellung des Raüms ver-
bunden. Man kann nicht die vielfach vertretene Meinung teilen, daß den be-
stimmten Bildgruppen jeweilige Tiefenbilder entsprechen müßten. Es ist falsch,
wenn im Film gezeigt wird, daß beispielsweise für die Sekundärplanaufnahme eine
bestimmte Tiefe vorgeschrieben ist. Wenn K. Lange1) die Reliefdarstellung als die
für den Film günstigste hinstellt, so beschränkt er damit die freie Entfaltungsmög-
lichkeit der Tiefendarstellung auf eine ganz bestimmte und einseitige. Eine über
bestimmte Tiefe vorgeschrieben ist. Wenn K. Lange (Das Kino in Gegenwart
und Zukunft, Stuttgart 1920.) die Reliefdarstellung als die für den Film gün-